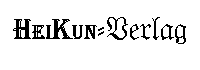|
|
|
Klaus Kunze
Der totale Parteienstaat
- Abschied vom idealen Staat:
Der Weg aus der Krise des deutschen
Parteiensystems -
Uslar 1998
HeiKun - Verlag
Titelaufnahme
Klaus Kunze
Der totale Parteienstaat
- Abschied vom idealen Staat -
Der Weg aus der Krise des deutschen Parteiensystems
(1.
Auflage 1994 ISBN 3-924329-9)
2. neu
bearbeitete Auflage 1998 ISBN 3-933334-01-2
Gedruckt in
Deutschland, Eigendruck
Inhaltsverzeichnis

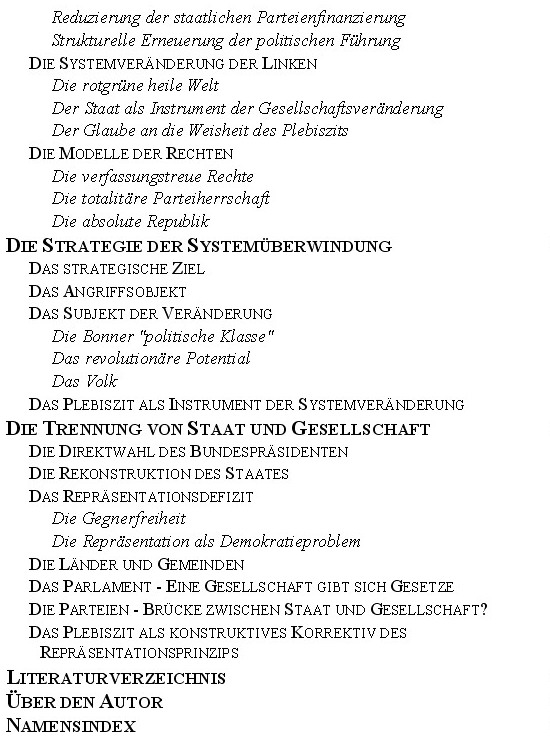
Für eine gute Sace unterzugehen,
ist viel hüb<er,
al+ mit einer <lecten zu prosperieren.
Ern#
Ludwig von Gerlac
(1795-1877)
Die Suche nach der idealen Staatsform ist so alt wie die Geschichte
abendländischen Denkens. Platon
bescherte uns nicht nur die
Suche nach dem sagenhaften Atlantis, sondern auch die nach der ebenso sagenumwobenen
idealen Herrschaft. Mit dem Diesseits hatte es der alte Philosoph nicht so
sehr. Viel lieber versetzte er sich in Gedanken in eine Höhle und wähnte, das
Reich seiner Gedanken: jenseitige "Dinge hinter den Dingen",
seien realer als die handgreifliche Wirklichkeit; sie gingen den Gegenständen
voraus, so wie die Dinge in der Höhle ein Stück wirklicher sind als ihre
Schattenbilder an den Wänden. Von dieser Ideengläubigkeit hat unser Denken
sich bis heute nicht erholt. Wie die Vision eines Atlantis die Phantasien
beflügelte, entzündete die Vorstellung einer idealisierten Ideenwelt die
Herzen unzähliger Generationen. Ihr entstammt auch die Vision einer irdischen
Welt vollkommener Gerechtigkeit als Abbild jener Vorstellung von einer
himmlischen Sphäre, regiert vom göttlichen "Guten an sich".
Offiziell wähnte die Bonner Republik sich diesem Staatsideal
so nah wie kein historisches Vorbild: der freieste Staat unserer Geschichte!
Dagegen steht die Auffassung, eine ideale Staatsform gebe es nicht. Jedes
System müsse sich immer neu bewähren und dadurch legitimieren, was es für
ein konkretes Volk in einer gegebenen historischen Situation leiste. Die
erste Ansicht wird entschieden von dem Teil des politischen Spektrums und
der veröffentlichten Meinung vertreten, der seinen Vorteil aus dem
Status quo zieht: Das ist vor allem das multinational organisierte Unternehmertum
mit seinem parlamentarischen Arm, der FDP, es ist der radikalliberale
Flügel der CDU, und es sind alle jene, die zwar keine Meinung haben, aber
etabliert sind im Parteiensystem, der Wirtschaft, den Gewerkschaften oder
den Medien und deshalb am Fortbestehen dieser Machtstrukturen ein konservatorisches
Interesse haben.
Wir kritischen anderen, die wir von dieser selbsternannten
Mitte als Störenfriede abgestempelt werden, sehen das alles nicht in so rosigem
Licht. Wir kennen natürlich aus der Schulzeit jene rührende Geschichte,
nach der wir im freiesten Staat leben, den es je auf deutschem Boden gab;
daß unsere Verfassung eine Würde habe, daß wir sie lieben und als gute Verfassungspatrioten
stolz auf sie sein sollen. Im Fernsehen und bei jenen salbungsvollen Weihnachts-
und Neujahrsansprachen wird diese Erinnerung immer wieder aufgefrischt.
Es ist wie mit Kindheitserinnerungen an die Konfirmandenzeit: Wir können
alles noch auswendig, nur ist uns der Glaube an die alten Sprüche abhanden
gekommen. Wie viele Kirchensteuerzahler regelmäßig einmal im Jahr zur Kirche
gehen, so gehen etwa 7O% der Zahler weltlicher Steuern gewohnheitsmäßig
zu Wahlen. Doch der Glaube ist selten geworden, dadurch etwas ändern zu
können, mit seinen Fundamentalinteressen repräsentiert zu sein oder
gar an der Herrschaft konkret teilzuhaben. Mit diesem Gefühl der Ohnmacht
nimmt die sogenannte Parteienverdrossenheit gesetzmäßig zu.
Nachdenkliche Bürger hatten schon lange bemerkt, daß die in
Bonn so genannte Demokratie zwar
wörtlich übersetzt Volksherrschaft heißt, aber keine Herrschaft des Volkes über sich selbst ist, sondern
die von Parteien und Interessenverbänden über das Volk. Das Volk herrscht nur der Idee nach, aber nicht in der Wirklichkeit.
Demgegenüber hatte sich der demokratische Mythos immer von der Erinnerung
an goldene demokratische Zeitalter genährt: dem der Athener Polis, des
Things, also der germanischen Volksversammlung, die unter einer mächtigen
Linde zusammentrat und in der freie Männer ein freies Wort führten, sich
selbst Gesetze gaben und niemandem untertan waren. Im Gedenken an den Rütlischwur
und in Schweizer Formen direkter Volksherrschaft ist dieses Idealbild
noch lebendig.
Nach der demokratischen Grundidee sollte das Volk über
sich selbst herrschen, was gedanklich voraussetzt, daß die befehlenden
und die gehorchenden Personen identisch sind:
Das Volk würde nach dieser Vorstellung tatsächlich
in seiner Gesamtheit die Regierungsgewalt über sich selbst ausüben.
Das kann es aber nur, indem es sich zu festgesetzter
Zeit an einem Ort versammelt und über die Angelegenheiten des Staates beschließt;
anders kann sein Wille nicht ermittelt werden.
In der Monarchie hingegen herrscht einer
über das Volk, in der Aristokratie seine Besten und in der Oligarchie wenige.
Mit der Realisierbarkeit dieser demokratischen Idee
als Regierungsform sieht es schlecht aus: Daß alle Bürger gleichzeitig und
anteilig persönlich Herrschaftsmacht ausüben und ihr zugleich als Regierte
unterworfen sind, ist im Massenzeitalter praktisch und theoretisch irreal
und daher eine nicht einlösbare Utopie.
Ohne Über- und Unterordnung läßt sich überhaupt
keine Staatsordnung errichten. Da nicht wirklich Alle alles entscheiden
können, läßt sich eine Regierungsform nicht anders als durch Führung oder
Herrschaft einzelner Personen oder einzelner Gruppen denken. Auch die
Bundesrepublik ist keine "herrschaftsfreie Gesellschaft", sondern
gründet sich auf die Herrschaft der Parteien durch den Bundestag. Robert
Michels formulierte treffend, daß die Organisation die Mutter der Herrschaft der Gewählten über die Wähler
ist. Die "Ungläubigen an den Gott der Demokratie" werden nicht
müde, darauf hinzuweisen, daß auch unter demokratischen Verhältnissen
nur Wenige wirkliche Macht ausüben. "Daß das Volk in pyramidenförmigem
Aufbau sich selbst regiere", bezeichnete Edgar Julius Jung
1930 treffend als "ein
witziges Märchen." Viele westliche
Demokratien sind der Regierungsform nach Parlamentarismen, in
denen nach einem ausgeklügelten Auszählverfahren Repräsentanten gewählt
werden, die über die Repräsentierten herrschen, aber keinesfalls Staaten,
in denen das Volk persönlich über sich selbst herrscht oder gar herrschaftsfreie
Gesellschaften. Die Macht geht nur vom Volk aus und damit von ihm weg. Die Herrschenden
nehmen für sich in Anspruch, im Sinne des Volkes zu entscheiden; gewiß
aber wird über und keineswegs durch das Volk geherrscht.
Mit Demokratie im
ursprünglichen Sinne hat die parlamentarische Regierungsform also nichts
zu tun. Wer den Parlamentarismus "Demokratie" nennt, verwechselt die
Staatsform mit der Regierungsform und mit der weltanschauliche Rechtfertigung
der Staatsgewalt: Staatsformen gibt
es zwei, nämlich Monarchie oder Republik. Die innere Rechtfertigung der
Republik gründet auf den Glauben das Volk und seine Souveränität über sich
selbst. Damit über die Regierungsform der Republik aber noch nichts gesagt: Auch ein Monarch kann sich einer
Parlamentsregierung bedienen, während eine Republik ebenso von einem Einzelnen
regiert werden kann wie von einer Ratsversammlung oder - in einer kleinen
Stadtrepublik etwa - vom Volk selbst, das sich dann eben für alle
Entscheidungen versammeln und abstimmen muß. Nur diese letzte Regierungsform
ist die eigentlich demokratische. Für eine Zukunft, in der jeder Bürger seinen
Computeranschluß zum Staat besitzen könnte, können wir uns vorstellen, vom
Wohnzimmer aus mitzuentscheiden: nicht nur alle paar Jahre über unsere
Vertreter, sondern wann immer eine Mehrheit der Bürger das will. Die Utopie der
Demokratie als Regierungsform ist heute schon technisch denkbar.
Wesentliche Merkmale unserer heutigen, auf dem Repräsentationsprinzip
beruhenden Verfassungsordnung sind mit dem rein demokratischen Grundkonzept
unvereinbar wie die Gewaltenteilung
und das Selbstverständnis als bloßes Konfliktregulierungssystem
zum allseitigen Interessenausgleich. Den Parlamentarismus als
Demokratie zu bezeichnen hielten unsere Altvorderen für undenkbar. Demokratie
und Repräsentation schließen sich begrifflich aus. Für Rousseau
war der demokratische Gemeinwille
schlechthin unvertretbar. Das Volk könne überhaupt nicht repräsentiert
werden. Nach Robert Michels
ist die Idee von der Vertretbarkeit
der Volksinteressen eine durch einen falschen Lichteffekt hervorgerufene
Wahnidee. Montesquieu
hatte die Staatsform, in der das Volk die oberste
Gewalt hat, korrekt Republik genannt
und nicht Demokratie. Daß Demokratie und repräsentierende Republik
Gegensätze sind, wußten Kant
und die amerikanischen Verfassungsväter.
Auch 1968 vermißten viele in der Republik
die Demokratie: Sie träumten den Traum von der Aufhebung aller Herrschaft
des Menschen über den Menschen in der anderen
Republik, ohne das Problem zu lösen, wie im Zeitalter der Millionenmassen
jeder einzelne persönlich Herrschaftsmacht mit ausüben soll.
Die zeitgenössischen Staatsrechtler leugnen das nicht. Heute
ist unbestritten, daß das Volk sich nur durch Repräsentation artikulieren
kann, so daß es jedenfalls eine andere Verwirklichungsform für so etwas
ähnliches wie Demokratie nicht gibt.
Ob diese Repräsentation dann als Regierungsform oder, als "Lebensform
einer pluralistischen Zivilgesellschaft"
,
noch "Demokratie" zu nennen ist, ist eine reine Etikettenfrage.
Im philosophischen, historischen und staatsrechtlichen Sinne ist sie es
nicht. Nach Hans Herbert von Arnim
liegt "das Grundübel
unserer Demokratie
...
darin, daß sie keine
ist." Neuerdings spricht er sogar offen von einer "Pseudodemokratie". Weil aber das Volk nun einmal an den Gott der
Demokratie glaubt, rettet man ihn mit einem semantischen Trick: So bezeichnet
Roman Herzog
den Parlamentarismus einfach
als "offene Demokratie", wohingegen er die eigentliche Demokratie
im Sinne ihrer frühneuzeitlichen Theoretiker wie Pufendorf
und Protagonisten wie Rousseau
mit dem Bannwort
"totalitäre" Demokratie in den Orkus verbannt. So kann man das eigene System weiter unter
der geweihten Fahne Demokratie segeln
lassen, ohne - eingestandenermaßen - eine solche zu haben, und wenn jemand
keck zu fragen wagt, wo denn die Identität von Herrschern und Beherrschten
und damit die erhoffte Aufhebung der Herrschaft des Menschen über den Menschen
bleibe, kann man ihm einfach antworten: So wörtlich sei das mit der Demokratie
ja nicht gemeint gewesen!
Die absolute Demokratie muß sich in Herzogs Grundgesetzkommentar
überdies den berechtigten und entlarvenden Zusatz "totalitär" gefallen
lassen: Die buchstäbliche Herrschaft des Volks über sich selbst, mag sie
auch utopisch sein, würde nämlich jedenfalls eine gewisse Homogenität
des Volkes und seines Willens voraussetzen, was zwangsläufig diejenigen
zu Feinden des "wahren Volkswillens" stempelt, die abweichender
Meinung sind. Ein einheitlicher Volkswille wird von demokratischen
Theoretikern wie Rousseau seit der Aufklärung übereinstimmend fingiert,
weil das Gedankenkonstrukt der Herrschaft des Volks insgesamt als Regierungssubjekt anders gar nicht
denkmöglich ist. Von ihm führt eine direkte gedankliche Ahnenreihe
selbstberufener Interpreten des Volkswillens über Robespierre,
Marx
und Lenin
zu Stalin
und seinen Todeslagern.
Alle forderten die fiktive demokratische Homogenität praktisch ein
und vollstreckten den von ihnen erkannten, wahren Willen des Volks als seine Avantgarde. Der Jakobinismus
des richtigen Bewußtseins und sein
eingebildeter Einklang mit einem Willen
des Volkes eignen sich vorzüglich zur Legitimation gewaltsamer Homogenisierung
und damit Liquidierung alles dem wahren Volkswillen Entgegenstehenden
und Abweichenden, weshalb Herzog
die absolute Demokratie
mit ehrlichem Abscheu und flinkem Etikettenwechsel überhaupt nicht mehr
mit dem edlen Ausdruck Demokratie bezeichnen möchte. Wie man heute das ursprüngliche, identitäre
Demokratiekonzept auch nennen mag: Ihm wohnt eine die Freiheit gefährdendes
Tendenz inne, und es muß notwendig in eine jakobinische Diktatur münden.
Der eigentliche demokratische Gedanke ist höchst feindselig
gegen jeden gerichtet, der anderer als der Meinung "des Volks"
ist. Aus der demokratischen Grundidee folgt, daß "das" Volk mit
sich selbst als Subjekt politischen Handelns identisch ist, was gedanklich
eine Willensübereinstimmung aller voraussetzt, die nur fiktiv sein kann.
Ohne eine innere Homogenität des Volks als Subjekt dieses Willens ist sie
nicht denkbar. Ihre Vorstellung führt zum Dogma des einmütigen Volkswillens,
der volonté générale. Aus ihm
leitet Rousseau
die demokratische
Identität von Regierenden und Regierten ab.
In der Demokratie gibt es daher nur die
Gleichheit der Gleichen, die mit dem Volkswillen übereinstimmen, und
es gilt nur der Wille derer, die zu diesen Gleichen gehören.
Bemerkt der einzelne nach einer Abstimmung,
daß er anders als die Mehrheit gestimmt hat, so hat er sich - Rousseau
zufolge - über den wirklichen Inhalt des Gemeinwillens eben getäuscht; und
weil, wie Rousseau
ausdrücklich fortfährt,
dieser Generalwillen der wahren Freiheit entspricht, war der Überstimmte
nicht frei.
Diesem demokratischen Denkansatz ist der
Gedanke gegen den Staat gerichteter Abwehr-, Bürger- oder Menschenrechte
völlig fremd; Minderheitenschutz ist nicht vorgesehen. Einem gegen den
Generalwillen gerichteten Handeln einer Minderheit würde jede innere
Legitimation fehlen.
-
Auch das Bundesverfassungsgericht spricht vom Bonner parlamentarischen
System bekanntlich nicht als von einer Demokratie, weil der in dem Wort
steckende utopische Anspruch eben nicht einlösbar ist, sondern als von einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung,
die es ausdrücklich eine "Herrschaftsordnung" nennt, in der das
demokratische Element nur als Adjektiv unter mehreren erscheint und durch
"demokratische" Wahlen zu rechtfertigen ist, womit allgemeine
und gleiche Wahlen gemeint sind; sowie durch die Souveränität des Volkes.
Diese allein rechtfertigt das Prädikat demokratisch.
Schon Bodin
hatte sehr scharfsinnig unterschieden
zwischen der Staatsform und der Regierungsform: Die eine fragt nur nach dem
Träger der Souveränität, die andere nach der Regierungsweise. Beides hat
miteinander nicht notwendig zu tun und ist darum beliebig kombinierbar. So bleibt das Volk Träger der Staatsgewalt und
bleibt die Staatsform eine Demokratie auch dann, wenn das Volk sich einen
König wählt, also der monarchischen Regierungsform bedient.
Das spezifisch Demokratische unserer Staatsform liegt
darin, daß nicht ein König, sondern das Volk berechtigt ist, die
konstituierende Gewalt auszuüben.
Deshalb liegt unserer parlamentarischen Republik die Demokratie als Staatsform zugrunde.
Ihre Verfassung rechtfertigt sich aus der stillschweigenden tätigen
Zustimmung des Volkes zu ihren Institutionen und Verfahrensweisen: Die
Mehrheit der Bürger bekundet diese Zustimmung an Wahltagen, indem sie
den die Verfassung stützenden Parteien ihre Stimme gibt. Dagegen wendet das
Grundgesetz nicht die demokratische Regierungsform an. Wie wir gesehen hatten,
ist das gegenwärtig technisch undurchführbar. Deutschland ist heute der Regierungsform
nach ein demokratischer Parlamentarismus, nicht aber eine parlamentarische Demokratie. Für sein Verständnis ist unerläßlich, die demokratischen und die liberalen
Elemente auseinanderzuhalten. Demokratisch ist die Staatsform, liberal
ist dagegen die Regierungsform der parlamentarischen Stellvertreterherrschaft,
und liberal ist das rechtsstaatliche Element.
Noch vor einigen Jahren war die Bonner Staatsdoktrin bescheiden.
Zu ihrer Rechtfertigung berief sie sich gern auf einen Churchill zugeschriebenen
Satz, nach dem die parlamentarische Regierungsform zwar eine denkbar
schlechte sei - indessen sei auch gerade keine bessere zur Hand. Heute ist
von solcher Bescheidenheit nichts mehr zu spüren. Je offensichtlicher
die Mängel des Systems
werden, je mehr Bürger sich von den Parteien
abwenden, desto impertinenter stilisieren diese sich hoch zu alleinigen
Vertretern der reinen demokratischen Lehre. Es greift ein Zungenschlag
um sich, nach dem die Würde der Demokratie verteidigt werden oder befreundeten
Demokratien geholfen werden muß. Diesem Verfassungspatriotismus
stehen nicht mehr Menschen im Vordergrund,
die allein eine Würde haben können, sondern ein System. Er ist demzufolge nicht primär human, sondern ideologisch.
Das Nachbarvolk, die lebendigen Menschen, geraten aus dem Blickfeld. Ähnlichkeiten
der innenpolitischen Spielregeln sind Grund genug für Millionenzahlungen.
Nicht Litauern oder Kroaten sollen wir nach dieser Meinung helfen, nein: Jungen Demokratien sollen wir unter
die Arme greifen, so wie früher im Ostblock weltweit der Sozialismus wechselseitig gestärkt wurde.
Die Gretchenfrage ist immer die, ob ein System von
Verfassungsregeln und Rechtsnormen dem Menschen - welchen Menschen? - dienen
soll oder der Mensch einem System. "Der Maßstab des Rechts ist nicht der
absolute der Wahrheit, [...] sondern der relative des Zwecks."
Regelsysteme haben keine Würde, sondern
nur eine dem Menschen dienende Aufgabe. Ihr Zweck ist es, den Menschen,
die sich ihrer bedienen, größtmöglichen Vorteil zu ermöglichen. Daher muß
jede Staats- und Regierungsform sich immer wieder neu für diejenigen Menschen
bewähren, die sich ihrer in einer konkreten historischen Lage bedienen.
Keine normative Regel kann sich an sich selbst legitimieren.
Sie beruht ausschließlich auf dem
existentiellen Willen dessen, der sie zu seinem Nutzen erläßt.
Gesetzes- und Verfassungssysteme sind nicht verkörperte
religiöse oder sittliche Ideale, sondern je nach Bedarf wechselnde Einrichtungen
zur Erreichung irdischer Zwecke.
Allein diese zweckbezogene Betrachtung
politischer Ordnungsvorstellungen eröffnet den nüchternen Blick auf
die Doppelfunktion jeder Systembildung: Je nach innerem Zustand eines
Staatswesens vermag dieses bei äußeren Gefährdungen größere oder geringere
Gegenkräfte zu mobilisieren. Man kann politische Ordnungssysteme aber nicht
nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, daß ein Volk insgesamt sich eines
Systems von Rechtsregeln zur Sicherung seiner inneren Wohlfahrt und äußeren
Sicherheit bedient. Auch innerhalb des Volkes gibt es Interessengruppen,
die zur Absicherung ihrer innergesellschaftlichen Macht ein
"System" errichten und verteidigen.
Zum System in diesem Sinne gehören neben dem rein faktischen Herrschaftsinstrumentarium
alle konkreten Gesetzes- und Verfassungsbestimmungen, deren sich die
Gruppe zur Erhaltung ihrer Macht bedient.
Schon in ihrem geistigen Vorfeld benötigen diese
menschlichen Regelwerke eine tiefere metaphysische Rechtfertigung, die
sich im Fundus der Geistesgeschichte für jede beliebige Herrschaft unschwer
finden läßt. Das "belebende Prinzip jeder Regierung", ihre
"Grundlage" und ihr "Widerhalt", ist der feste Glaube der
Regierten an ein "Ganzes von anerkannten Doktrinen."
Jede Weltanschauung ist in ihrem funktionalen
Kern Herrschaftsideologie und kann daher nur verstanden werden, wenn sie
in ihrer konkreten historischen Lage,
und jede einzelne politische Begrifflichkeit,
wenn sie in ihrer situationsbedingten polemischen Funktion erfaßt
wird.
"Da keine zeitgenössische Partei
ohne ein System von philosophischen oder spekulativen Grundsätzen,
die sie an ihre politischen und praktischen anschließt, auskommt, so finden
wir, daß jede dieser Parteien, in die die Nation gespalten ist, ein solches
Lehrgebäude errichtet hat, um ihre Absichten und Handlungen abzuschirmen."
"Jedes politische System braucht seine
Systemideologie, um damit die bestehende Form der Herrschaft und der
Machtausübung zu legitimieren."
Das gilt für alle Gesellschaftsformationen.
Das vielfach proklamierte Ende der Ideologien ist bloßer Bestandteil ihres
eigenen ideologischen Selbstverständnisses.
Die Requisitenkammern menschlicher Phantasie bersten von
Glaubenslehren und hochtönenden Worthülsen, die sich, wenn sie nicht schon
eigens zur Stabilisierung der Herrschaft konkreter Menschen ersonnen wurden,
doch bestens dazu eignen. Kluge Gesetzgeber lassen nicht nur die guten Gründe
ihres Werkes für sich sprechen, sondern nehmen zur Gottheit ihre Zuflucht,
weil ihre Gesetze dann leichter angenommen werden.
So herrschen unter Berufung auf göttliches
oder Naturrecht bequem diejenigen, die jeweils die Definitionsmacht besitzen,
welche konkreten Forderungen der angebetete Gott an die Beherrschten
richtet oder welchen konkreten Inhalt das Naturrecht angeblich hat.
Die normativistische Fiktion läßt ihren Interpreten
getarnt im Hintergrund und soll seine Macht über diejenigen rechtfertigen,
die an seine Normen glauben. Der Glaube an ewige Götter hat den Angebeteten
selbst nur Psalmenschall und Opferrauch gebracht; den Managern ihres Kultes
aber gewöhnlich soziale Privilegien und eine stabile Herrschaft.
Selbst im Kultus der Gleichheit - dem Sozialismus - waren bekanntlich die
Funktionäre "gleicher" als die anderen.
Nach dem Verfall der geschlossenen ideologischen und religiösen
Weltbilder setzen wir jedem Pochen
auf angeblich höheres Recht oder auf eine metaphysische Gerechtigkeit die soziologische Frage
entgegen: Wem konkret nützt ein Recht? Ernst von Hippel
seufzte darüber resignierend:
Nach Verlorengehen der "höheren Rechtsstufen" des göttlichen
und des Naturrechts sei "endlich nur noch der Rechtsbegriff als leere
Form und Tarnung bloßer Interessen wie politischer Macht übrig" geblieben. In einer Welt, in der keine Ordnung über dem
Staat für die friedliche Austragung unterschiedlicher Vorstellungen
von Moral oder der Natur des Menschen die Garantie übernimmt, hat es keinen
Sinn, sich auf Naturrecht zu berufen. So ist es eine typische Leerformel,
wenn Thomas von Aquin
als Grundgebot des Naturrechts
bezeichnet: "Das Gute ist zu
tun und ihm nachzufolgen, und das Böse ist zu meiden." Niemand wird da widersprechen, doch bestimmt
jeder das Gute nach seinen eigenen
Zielen und Möglichkeiten,
also letztlich danach, was ihm angenehm ist,
und das Böse als das, was ihm
widerstrebt,
so daß die allgemeine Akzeptanz eines
amorphen Guten den Streit nicht entscheiden
kann. Auch eine konkrete "höhere" Gerechtigkeit "an
sich" können wir nicht finden, ohne das formale Gerechtigkeitsprinzip - nämlich Gleiches gleich zu
behandeln - mit unserer ganz persönlichen Weltanschauung zu kombinieren:
Kraft deren bestimmen wir, welche konkreten Kriterien beispielsweise für eine Gleich- oder Ungleichbehandlung
ausschlaggebend sein sollen.
Diese Kriterien pflegt jeder interessegeleitet
auszuwählen und hält gewöhnlich diejenigen Gesichtspunkte oder abstrakten
Werte für ausschlaggebend für die Frage, ob zweierlei gleich sei, die gerade ihm nützen. Die Fragen nach der Natur des
Menschen, den konkreten Kriterien der Gerechtigkeit und den moralischen
Idealen lassen sich nur durch willkürliche Entscheidung beantworten, welche
die ideellen Achsen der höchstpersönlichen Weltsicht festlegt.
Mit der Betonung der Zweckhaftigkeit des Rechts nehmen
wir in der Neuzeit die schon von Thrasymachos
ins Feld geführte Beobachtung
auf, nach der "jegliche Regierung die Gesetze nach dem gibt, was ihr vorteilhaft
ist: die Demokratie demokratische, die Tyrannei tyrannische und die anderen
ebenso. Und indem sie so gesetzgeben, zeigen sie also, daß dieses ihr Interesse
(óýìöåñïí) Recht (äßêáéïí)
zu sein habe für die Regierten. Und den dieses Übertretenden strafen sie
als außerhalb des Gesetzes Stehenden und unrecht Handelnden." In
allen Staaten werde zum Recht gemacht,
was der bestehenden Regierung nütze.
"Sie sollten nicht archaische und überholte
Rechtsvorstellungen des Aurelius Augustinus
oder des heiligen Augustin
aus 'De Civitate Dei' zitieren," empfahl daher ein Richter am Bundesgerichtshof
bitter bedauernd: "Recht hat mit Moral nichts zu tun. Recht ist das, was
durchzusetzen man die politische Macht hat und was dem Volke nützt, wobei
der Nutzen des Volkes von denen bestimmt wird, die die Macht haben."
Offenherzig erklärte die Gemeinsame Verfassungskommission
des 12.Bundestages in ihrem Bericht vom 5.November 1993: "Probleme der
Verfassung und der Verfassungsreform sind letztlich politische Machtfragen."
Wer sich beherrscht fühlt und sich befreien möchte, muß das
Wechselspiel zwischen faktischer Herrschaftsmacht und überwölbender
Herrschaftsideologie ebenso durchschauen wie jeder, der selbst gern herrschen
möchte. Herrschen bedeutet, die Spielregeln des Zusammenlebens so zu setzen,
daß die anderen zu tun haben, was die einen wollen. Solange die
"herrschaftslose" Gesellschaft eine Utopie ist und wir alle diesen
Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, mag sich jeder frei aussuchen, ob er lieber
Hammer oder Amboß sein möchte. Herrschaftsideologien sind abstrakte Ideengebäude
und vermitteln Akzeptanz von Herrschaft: Solange die einen tatsächlich an sie glauben, gehorchen sie "freiwillig"
den anderen. So gehorchen Monarchisten
im Glauben an das Königtum dem Monarchen,
Marxisten im Glauben an den Diamat oder
den Fortschritt ihrem Parteisekretär,
Muslime im Glauben an Allahs Willen dem Imam und Demokraten im Glauben an die
Demokratie den Bundestagsabgeordneten, ihren Gesetzen und den
politischen Entscheidungen ihres Kanzlers. Es gehört zu den erfolgreichen
Herrschaftstechniken, den Beherrschten das glückliche Gefühl zu schenken,
ihr Gehorsam diene Gott oder stehe
wenigsten mit einem universalen Gesetz in Einklang, zum Beispiel der Humanität,
dem Weltfrieden, dem historischen Sieg des Sozialismus oder der Demokratie. Darum pflegte
man früher von Gottes Gnaden und
heute im Namen des Volkes zu herrschen.
"Je paradiesischer das vorgegaukelte Trugbild, um so schmerzloser
die seelische Versklavung."
Es waren und sind die glücklichen Sklaven
der Freiheit größter Feind. Die meisten Menschen wollen aus innerem Bedürfnis einfach glauben und lassen sich willig indoktrinieren, weil sie stets auf
der Suche nach sinnstiftenden Angeboten sind und diese aus sich selbst heraus
selten entwickeln können. Wer aber selbst sittlich begründet frei entscheiden will, darf an keine
anbefohlenen metaphysischen Normen glauben.
Wer an das wirkliche Walten ihm vorgeschriebener metaphysischer
Normen glaubt, aufgrund deren alle Menschen in eine übersinnliche moralische
Ordnung gestellt sind und diese zu verwirklichen haben, liefert sich
denjenigen aus, die sich auf sie berufen und zu ihrem Nutzen konkrete Verhaltensanweisungen
auf sie stützen.
Der Preis für das Erkennen dieser Zusammenhänge ist
manchem zu hoch: "Eine Zerstörung jeder übergreifenden Idee, jeder geschichtstranszendenten
Norm," seufzt der Liberale Christian Graf von Krockow,
"die Zerstörung aller
naturrechtlichen Universalismen kann folgerichtig nur zu einer Reduktion
aller politischen und staatstheoretischen Probleme auf die 'Macht der
Tatsachen' bzw. die tatsächliche Macht führen." Wie Adam und Eva vom Baume der Erkenntnis aßen
und sahen, daß sie nackt waren, läßt das Durchschauen aller "naturrechtlichen
Universalismen" deren Apostel in ihrer Machtausübung nackt dastehen,
ihrer Herrschaftsideologie entkleidet nämlich. Nicht jeder verträgt den
Verlust des trügerischen schönen Scheins und beginnt beim Erkennen seines
Nacktseins zu frösteln. So muß unser nüchterner Blick auf die konkrete
Funktion allen Rechtes als von Menschen über Menschen gesetztes Recht alle
diejenigen unbefriedigt lassen, die nicht die Funktion jeder Idee als
Waffe im Vordergrund sehen, sondern aus dem Elfenbeinturm esoterischer Moral-
oder Gotterkenntnis her argumentieren. Ihr Reich ist nicht von dieser Welt,
und unsere Überlegungen sind unfruchtbar für sie. Wir dagegen fragen
bewußt nicht nach der Faktizität einer metaphysischen Letztrechtfertigung
des Rechts, sondern beschränken uns pragmatisch darauf, die Anmaßung der
Bonner Politikerkaste zu durchschauen: Sie verlangen uns mit der Herrschaft
ihres Rechts gleich auch die Anerkennung ihrer Moral ab und gründen darauf
den Anspruch, an ihrem Recht dürfe in Ewigkeit niemals gerüttelt werden.
Neugierig wagen wir kritisch zu hinterfragen: Warum eigentlich? Mit welcher
höheren Weihe aus dem Arsenal der Herrschaftsideologien haben sie sich
versehen? Und vor allem: Wem nützt ihre Herrschaft?
Ihr umfassendes metaphysisches Rechtfertigungssystem
ist der Liberalismus.
Sein politisches Ordnungssystem ist der Parlamentarismus:
heute ein "wirres Gedankengebräu unserer Urgroßväter", das sich
"inzwischen verbraucht" hat.
Er tritt uns in Deutschland
heute in Gestalt eines umfassenden Parteienstaates gegenüber. Beide, die
metaphysische Legitimierung als Liberalismus und ihre politische Ordnungsform Parlamentarismus,
dienen letztlich der Aufrechterhaltung eines bestimmten Status quo, in
dem sich die faktische Machtposition derjenigen normativ ausprägt
und stabilisiert, die ihren
ökonomischen Vorteil aus einer Wirtschaftsverfassung ziehen,
in der ein freies Spiel der Kräfte weitestmöglich
ist. Für diese Wirtschaftsform hat sich die Bezeichnung Kapitalismus eingebürgert. Wir werden uns die Frage stellen
müssen, ob diese Erscheinung: die Dominanz des unmittelbar nur dem
Einzelnen Nützlichen ohne primäre Rücksicht auf das Ganze, diese Gemeinschaft
schließlich zerstört und damit auch dem egoistischen Einzelnen die Grundlage
seiner Existenz entzieht.
Während in Bonn am Rhein eine Verfassungskommission aus Parteienvertretern
der Fassade des Grundgesetzes Verzierungen und Erkerchen anflickte, wankte
bereits das ganze auf Treibsand errichtete Gebäude. Ungeachtet der immer
bedrohlicher werdenden existentiellen Sorgen und Probleme der einfachen
Menschen des Volkes befassen die Bundestagsparteien sich nur noch mit ihren
internen Rivalitäten und der Sicherung ihrer Macht. Sie spielen nach einem
Wort Armin Mohlers
die "Beste aller Welten",
und ihre Hofjournalisten sitzen im Parkett und klatschen dazu Beifall. Die
Zustimmung der Regierten zu den herrschenden Politikern aber schwindet,
und mit ihr schwindet die Zustimmung zu den von ihnen installierten Spielregeln,
jenem Repräsentationssystem, aufgrund dessen die einen oben und die anderen
unten bleiben. Mit dem Bekanntwerden systemkritischer Untersuchungen
und Schlußfolgerungen artikuliert sich das Unbehagen selbst in hohen Regierungskreisen
des Bonner Establishments, und hinter vorgehaltener Hand raunt man sich in
den Amtsstuben der Ministerialbürokratie zu, daß es so nicht weitergehen
kann.
Der real existierende Parlamentarismus ist auch an der notwendigen
Bildung einer qualifizierten politischen Elite gescheitert. Das dem Anspruche
nach demokratische System ist zu einem parteiübergreifenden Kartell zur
Postenverteilung auf Dauer entartet, in dem zwangsläufig die größten Opportunisten
nach oben gespült werden. Die Parteien haben ein oligarchisches Feudalsystem
gebildet. Damit verwirklichten sich exemplarisch die von Robert Michels
schon 1911 erkannten Gesetzmäßigkeiten von Parteiorganisationen und
die 1923 von Carl Schmitt
geübte grundsätzliche
Kritik am Parlamentarismus. Der Parteienstaat setzte die freiheitliche
demokratische Grundordnung im Sinne des Bundesverfassungsgerichts außer
Kraft und ist nicht mehr in deren Sinne demokratisch. Er besitzt keine Lösungskompetenz
für die existentiellen Fragen des Gemeinwohls, weil er Eigensucht, Opportunismus
und Korruption zu Prinzipien erhoben hat.
Für die westlichen Bundesländer hatten Soziologen schon vor
der Wiedervereinigung ein zentrales Einflußnetzwerk von nicht ganz 600
Personen festgestellt. 40% davon sind Politiker, 12% Ministerialbürokraten,
8% Gewerkschaftler, 8% vertreten Wirtschaftsverbände, und 8% sind Unternehmer.
Es herrscht der Trend zum Berufspolitiker
vor. Am weitesten ist die Willensbildung in der Politik miteinander vernetzt.
Durch vielfache Ämterhäufung und Cliquenbildung übt dieser Einflußzirkel
eine zentrale Wirkung aus.
"Als neue Obrigkeit wickelt der innere
Kreis dieses politischen Hochadels alle Staatsgeschäfte unter seinesgleichen
ab. Von den Gefolgschaften wird bedingungslose Treue verlangt, wofür diese
dann allerlei Brosamen erhalten."
"Zwischenparteilich entsteht" so
"eine Gruppe von Eingeweihten, die nur noch Scheingefechte
gegeneinander liefern, um das Herz des Wählers zu erfreuen. In Wahrheit sind
sie sehr einig, und nur manchmal fechten sie stille, aber erbitterte Kämpfe
aus um den Anteil an der großen Futterkrippe, die Macht heißt."
In der bloßen Existenz politischer Eliten liegt nicht das
Problem. Nach jeder Staatsumwälzung und Verdrängung einer alten Elite von
der Macht pflegt sich alsbald eine "neue Aristokratie" aufzuschwingen
und die Rolle der alten zu besetzen.
Robert Michels
fand das "Eherne Gesetz
der Oligarchie", nach dem in jedem Herrschaftssystem nur wenige wirkliche
Macht ausüben.
Man hat errechnet, daß die Anzahl der Aristokraten
im zaristischen Rußland, der ausschlaggebenden Lobbyisten in den USA und
der Nomenklatura in der Sowjetunion mit 4%-6% der Bevölkerung immer annähernd
gleich ist.
Zentrales Problem ist aber, durch
welches Ausleseprinzip welche Art von Menschen Zugang zur Funktionselite
bekommt und dadurch an der tatsächlichen Ausübung der Herrschaft Teil hat.
Daß in der heutigen Bundesrepublik die Art der Auswahl von Berufspolitikern
und ihre Karriere die entscheidende Schwachstelle des politischen Systems
ist, sieht der Kölner Soziologe Erwin Scheuch
als nicht kontrovers an. Die Personalauswahl werde durch das Instrument
der Wahlliste bestimmt, und hier dominieren Einflußcliquen und Seilschaften.
Für den Berufspolitiker wird der Kampf um seine Wiederaufstellung zur
persönlichen Existenzfrage, und darum wird er gnadenlos geführt.
Nach de Jouvenels
bekanntem Scherzwort braucht
man, nachdem man einmal Abgeordneter geworden ist, nur noch eine Sorge zu haben,
nämlich Abgeordneter zu bleiben.
Hat der Abgeordnete einen Listenplatz von
seiner Partei Gnaden in der Tasche, ist die Wiederwahl meist nur noch Formsache.
Was das Volk von ihm hält, kann ihm gleichgültig sein. Das Risiko des Mandatsverlusts
durch eine Wahl ist mit 2%-3%, im Extremfall 5% der Abgeordneten außerordentlich
gering.
Die Eigenabsicherung auf einem sicheren Listenplatz wird
nach zwei Richtungen durchgeführt. Nach innen richtet der Berufspolitiker
seine Loyalität auf seine Seilschaft, allenfalls auf seine Partei aus:
Ganze Personalpakete werden in kleinem Kreis informell abgesprochen und
die Cliquenmitglieder darauf festgelegt, sich gegenseitig zu wählen.
Nach außen wird die Wahl jedes Dritten verhindert. So berichtet Scheuch
von schriftlichen Verträgen einzelner Seilschaften
innerhalb der Kölner CDU-Ratsfraktion mit konkurrierenden Seilschaften
über die Aufteilung aller erreichbaren Mandate. Konkurrenten werden ausgebootet
oder nach Absprache mit lukrativen Posten versorgt, um sie ruhigzustellen. Die Aufstellung von Alternativkandidaten
wird möglichst durch Satzungstricks verhindert, wie beim Urteil des Hanseatischen
Staatsgerichtshofs vom 4.5.1993 für Unrecht erkannt, als eine Hamburger
Bürgerschaftswahl wegen undemokratischer Methoden bei der Kandidatenaufstellung
der CDU für ungültig erklärt wurde.
Auf Bundesebene und in einer Anzahl größerer Städte haben
solche Seilschaften sich bereits zu voll ausgebildeten Feudalsystemen
fortentwickelt.
Grundlegend für jedes Feudalsystem ist der
Tausch von Treue gegen Privilegien. Wer auch nur einmal ausschert, wird verstoßen.
Wer aber mitspielt und sich der Cliquenräson
beugt, darf mit seiner Wiederaufstellung rechnen, denn die Clique benötigt
ihn als Baustein ihrer Einflußzone ebenso, wie er auf sie zu seiner persönlichen
Existenzabsicherung angewiesen ist. Die Kleinstrukturen der Cliquen und
Seilschaften
setzen sich in größerem Zusammenhang auf
Bundes-, Landes- und Kommunalebene fort. Die Parteien haben Quasi-Kartelle
gebildet und die Versorgungsposten des staatlichen und halbstaatlichen
Bereichs wie eine Beutemasse
unter sich aufgeteilt. "Solche
Quasi-Kartelle, die von den Betroffenen oft als Beleg für die »Einigkeit der
Demokraten« verharmlost werden, schalten den politischen Wettbewerb aus und
entmachten den Wähler: Welche Partei auch immer er wählt, alle sind in das
Kartell eingebunden."
Sie greifen direkt über sogenannte Wahlkampfkostenerstattungen
und andere unmittelbare Zuwendungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde DM
jährlich in den gefüllten Steuertopf
und erzielen damit 60% ihrer Einkünfte. Die
Gesetze, die ihnen das erlauben, haben sie im Bundestag selbst beschlossen
und reproduzieren den sie umhüllenden Nährspeck ständig selbst wie eine
Spinnerraupe ihren Kokon. Die Parteien haben sich als "Absahner die
Gesetze derart hingebogen, daß sie ihr Treiben vor aller Öffentlichkeit
fortsetzen können. Wenn ein Skandal wie die Süßmuthsche Dienstwagenaffäre
ruchbar wird, ändert man einfach die Rechtslage, nach der Frau Süßmuth
ihrem Gatten nunmehr ganz
legal ihren Dienstwagen überlassen darf.
Rechnet man zu ihrer Beutemasse noch die
staatliche Finanzierung ihrer Parteistiftungen mit jährlich 500 Mio.
DM, die Fraktionszuschüsse mit 100 Mio. DM und sämtliche Dienstbezüge
der unter Verstoß gegen das Leistungsprinzip (Art.33 GG) Protegierten hinzu,
steigt sie ins Unermeßliche.
Diese Dienstbezüge sind der wichtigste Gegenstand persönlicher
Vorteilnahme. Durch Zugriff auf die Besetzung lukrativer Posten haben die
Parteien sich die Ressource "Privilegien" unbeschränkt verfügbar
gemacht, um sich der Treue ihrer Günstlinge zu versichern. Im kommunalen
Bereich führen die meisten Gemeinden ihre Dienstleistungsunternehmen
privatrechtlich, bleiben aber im Besitz der Kapitalmehrheiten und behalten
damit den maßgeblichen Einfluß bei der Besetzung der Aufsichtsräte und anderer
Posten. Die Parteien versorgen mit diesen lukrativen Positionen ihre Stadtverordneten,
die mit den gezahlten Spitzenverdiensten ihr Einkommen ergänzen.
Noch wichtiger sind die Aufsichtsratsposten
nach Aufgabe eines politischen Amtes zur "Endlagerung"
abgehalfterter Politrentner. So wechselte
der Vorstandsposten bei den Kölner Verkehrsbetrieben, dotiert mit
250.-350.000 DM jährlich, zwischen SPD- und CDU-Fraktionsvorsitzenden ebenso,
wie die Großaufträge zum Anstreichen der Kölner Rheinbrücken und die
anwaltlichen Mandate für die Rechtsvertretung der Stadt im Wechsel CDU-
und SPD-Ratsherren zugute kommen. Ein weiteres "Endlager" für
ausgediente Parteifunktionäre fand der SPIEGEL in der Bundeszentrale für politische Bildung.
Die Parteien haben den Zugriff auf die öffentlichen Ämter in
kaum vorstellbarem Maße monopolisiert.
Sie erweitern den zu ihrer Beutemasse gehörenden
Kreis systematisch
.
Selbst Behörden werden wie Tendenzbetriebe behandelt.
Die Parteien geben sich neuerdings keinerlei
Mühe mehr, dies zu bemänteln: Nach dem Tode des Weser-Ems-Regierungspräsidenten
verkündete Uwe-Karsten Heye
als Sprecher der niedersächsischen
Landesregierung verblüffend offen, als Nachfolger komme der parteilose
Oldenburger Vizepräsident nicht in Frage, weil es ihm an der "nötigen
Farbennähe" zur SPD-Landesregierung fehle, was selbst das SPD-nahe
Göttinger Tageblatt zu dem Eingeständnis veranlaßte: "Jetzt ist es
amtlich. In Niedersachsen gilt das Prinzip der Parteibuchwirtschaft."
Durch unverhohlene Ämterpatronage und
Parteibuchwirtschaft
fest in ihrer Hand sind der Rundfunk, die
kommunale Selbstverwaltung, Schulen, Universitäten, Bahn, Post und
Sparkassen.
Ferner soll auch der vorpolitische Raum mit
Wohlfahrts-, Bauern- und Vertriebenenverbänden parteipolitischer
Unterwanderung ausgesetzt sein.
Ihr Einfluß hat sich quasi fettfleckartig
über alle staatlichen Institutionen ausgebreitet.
Selbst wohlwollende Autoren sprechen von
einer "Kolonialisierung" aller gesellschaftlichen Lebensbereiche
durch den Parteienstaat.
Den Begriff totaler Parteienstaat
formulierte Carl Schmitt
angesichts derselben Problematik
immerhin schon 1932;
und von Arnim nennt ihn neuerdings den "absoluten Parteienstaat".
Wie drückte es Scheuch
so schön aus: "Es
organisiert sich ein parteiübergreifendes Kartell zur Postenverteilung auf
Dauer."
Es nutzt alle "Möglichkeiten, welche den
Parteien zur Belohnung ihrer Getreuen gegeben sind. Man geht deshalb dazu
über, auch die höheren Beamtenstellen zu parlamentarisieren und auf Grund
stiller Handelsgeschäfte zwischen den Parteien zu besetzen."
Das System der Machtübernahme durch Cliquen
ist nach Scheuch außer Kontrolle. Es ist nur noch auf sich selbst bezogen,
oder, wie es in der Soziologie heißt: selbstreferentiell. In der Systemtheorie nach Niklas Luhmann
bedeutet das, daß es nur
noch auf Veränderungen im eigenen System reagiert. Die Politik in der
Bundesrepublik ist selbstreferentiell als Koalition von beamteten
Politikern und politisierten Beamten, umgeben von Journalisten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Derartige Systeme haben die Tendenz, sich zunehmend zu verselbständigen
- hier gegenüber dem Gesamtsystem "Gesellschaft".
Damit ist aber der Elitenpluralismus und
damit eine tragende Säule der Selbstrechtfertigung des Systems außer Kraft
gesetzt. Sie lautet, daß die "Demokratie" institutionell und
tatsächlich offen und durchlässig für konkurrierende Eliten sein muß.
Heute dagegen gleichen die Führungsgremien der Bundestagsparteien geschlossenen
Gesellschaften,
in die Zutritt nur demjenigen gestattet
wird, der den Insidern aus Gründen der internen Räson genehm ist.
Die Auswahl des gesamten politischen Personals
ist in ihre Hände übergegangen.
Die Führungspersonen spielen eine so
entscheidende Rolle dabei, daß Wahlen nur ein legitimierendes Moment in einem
umfassenden Prozeß der Kooptation und Selbstrekrutierung der Führungsgruppen
darstellen.
"Das wesentliche der oligarchischen
Herrschaft ist
...
der Fortbestand einer
gewissen Weltanschauung und einer gewissen Lebensweise.
...
Eine herrschende
Gruppe ist so lange eine herrschende Gruppe, wie sie ihre Nachfolger bestimmen
kann. Der Partei geht es nicht darum, ewig ihr Blut, sondern sich selbst ewig
zu behaupten."
Die traditionellen Volksparteien haben durch ihre
oligarchischen Binnenstrukturen nicht nur den Kontakt zur Gesellschaft in
weiten Teilen verloren.
Ihre Führungseliten orientieren sich auch innerparteilich
nicht an den Bedürfnissen und Interessen der schweigenden Mehrheit der
Mitglieder, sondern, z.B. in der SPD, "weitgehend an den politischen
Präferenzen der aktiven Minderheiten, die das Parteileben bestimmen. Sie
vergeben Delegierten- und Vorstandsposten; ihre Zustimmung ist für die
Erlangung von Kandidaturen für öffentliche Ämter unabdingbar [...] Damit aber birgt die - aus Sicht der Parteieliten durchaus rationale - Orientierung
der politischen Eliten der SPD an dieser engagierten Minderheit der
Parteiaktivisten stets die Gefahr, programmatisch und ideologisch an den
Bedürfnissen und Interessen der schweigenden Mehrheit der Parteimitglieder
und erst recht der Wähler vorbeizudenken und im politischen Abseits zu
landen."
Dieses Fehlanpassungssyndrom führt dazu,
daß die Probleme der einfachen Menschen bei den fehlangepaßten Parteieliten
ganz unten auf der Tagesordnung stehen.
Scheuch
befürchtet, daß es zu einem
Kartell der großen Parteien auf Dauer kommen wird, und fordert daher: "Das System selbst,
die Vorherrschaft von Cliquen auf der Ebene der Kreise, der Unterbezirke
bzw. Bezirke, ist auf Bundesebene zu beseitigen". Er fordert eine rasche Ergänzung des
jetzigen Führungspersonals durch fachlich qualifizierte Personen,
sonst werde sich der Qualitätsverfall beschleunigen.
- Doch Systeme, deren einziges formales Kriterium
für die Qualifikation von Kandidaten darin besteht, mehrheitsfähig zu
sein, haben eine eingebaute Tendenz zur Mittelmäßigkeit.
Da die hauptsächlichen Kriterien der politischen
Kandidatenauswahl und Selektion nur die Cliquenloyalität und -konformität
sind, kann das System nur massenhaft Exponenten hervorbringen, die sich
durch Konformität, Cliquengeist und die Bereitschaft auszeichnen, Treue
gegen Vorteile zu geben und zu nehmen. Parteiaktivisten, denen es noch um
die Sache selbst geht, stören
und bleiben chancenlos. Amtsinhaber sperren
sich gegen eine Zufuhr von Intelligenz, Fachwissen und Unabhängigkeit von
außen. Nachwuchsförderung wird hintertrieben, weil gute Leute als Konkurrenten
die eigene Existenz gefährden könnten. Jede Oligarchie ist ihrem eigenen
Nachwuchs gegenüber argwöhnisch. Sie wittert in ihm Nachfolger bei Lebzeiten.
Rückgrate sind vor Betreten des politischen Parketts an der
Garderobe abzugeben. Die Zöglinge dieses Systems sitzen fest im Sattel.
Sie können und werden die sie begünstigenden Systemregeln nicht ändern.
Darum ist das System nach Ansicht des Soziologen Scheuch aus sich selbst
heraus reformunfähig. Es gehorcht eben nur noch seinen eigenen Gesetzen.
Scheuch sieht keine Chancen, daß "diese Mafia-Strukturen" aus den
Parteien selbst heraus beseitigt werden könnten. Wie die böse Tat, die immer nur Böses gebiert,
bringt das System vorwiegend charakterlosen und mediokren Parteinachwuchs
nach oben und stabilisiert sich so fortwährend selbst. "Nur wer den
klassenspezifischen Politsprech inklusive sämtlicher Tabus und ritueller
Verbeugungen beziehungweise Abscheubezeugungen beherrscht, wird zum Klub
zugelassen."
Wenn die Studie Scheuchs
auch bei ihren Auftraggebern
in der Düsseldorfer CDU wie eine kalte Dusche gewirkt hatte - die Auslieferung
wurde zunächst gestoppt, die Studie dann "zurückgezogen" und dem
Autor mit Verleumdungsanzeigen und Parteiausschlußverfahren gedroht -
sind ihre Erkenntnisse doch keineswegs neu. Sie bestätigen allenfalls aufs
neue empirisch, was an grundsätzlicher Kritik am liberalen Parlamentarismus
seit Jahrzehnten vorliegt. Nur weil man glaubte, in der besten aller Welten
zu leben und mit dem Bonner System den ganz großen Wurf gemacht und den Gipfel
deutscher Verfassungsmäßigkeit erklommen zu haben, verpönte und verdrängte
man Carl Schmitt.
Dieser hatte schon 1923
erkannt: "In manchen Staaten hat es der Parlamentarismus schon dahin
gebracht, daß sich alle öffentlichen Angelegenheiten in Beute- und Kompromißobjekte
von Parteien und Gefolgschaften verwandeln und die Politik, weit davon
entfernt, die Angelegenheit einer Elite zu sein, zu dem ziemlich verachteten
Geschäft einer ziemlich verachteten Klasse von Menschen geworden
ist". Über denselben Befund besteht auch heute
wieder Einigkeit vom Stammtisch bis ins Parlament:
Statt von Politik- und Parteienverdrossenheit muß von einer Parteien- und
Politikverachtung gesprochen werden.
Liberale Verteidiger des Status quo möchten die Schuld an
der 1923 wie 1994 gleichartigen Misere gern vom liberalen Parlamentssystem
auf seine real existierenden Parteien schieben. So erklärte Hartmut Schiedermair
unter der Überschrift
"Hände weg vom Grundgesetz!", die Ursache der "Staatsverdrossenheit"
seien "bekanntlich die politischen Parteien, deren Integrationskraft
in erschreckender Weise nachgelassen habe. Korrekturen am parlamentarischen
System seien hier eine falsche Therapie." Diese Ausrede ist so falsch wie die Behauptung
aus der Endphase des real existierenden Sozialismus, eigentlich sei die Idee
ja schön gewesen - nur die SED und ihre Führer seien ihr leider menschlich
nicht gewachsen gewesen. Es gab aber keinen wirklich anderen als den real
existierenden Sozialismus, und ebenso hatten und haben andere
Parlamentarismen in allen Ländern mit denselben Strukturproblemen zu
kämpfen wie der unserer.
Diese Schwierigkeiten hatten schon 1985 die Juristen der
Staatsrechtslehrertagung unter die Lupe genommen und die Tagung unter ein
Carl Schmitt
entlehntes Motto gestellt:
"Parteienstaatlichkeit - Krise des demokratischen Verfassungsstaates?"
Sie befanden, daß die derzeitige Situation des Parteienstaats und seine
Krise des Repräsentativsystems Anlaß zu größter Besorgnis seien,
womit sie auf die Problematik des Parlamentarismus
anspielten. Von einer Krise der Demokratie hatten sie mit Recht nicht gesprochen.
Bereits Carl Schmitt
hatte die Krise der
Demokratie von der des modernen Staates und der des Parlamentarismus unterschieden und die Krise des letzteren darin erkannt, daß
seine axiomatischen Grundprinzipien nicht funktionieren: Diese sind die
Willensbildung in öffentlicher Diskussion und die Gewaltenteilung. So
stellt sich die Geschichte des Parlamentarismus im 20. Jahrhundert als eine
fortwährende Krise dar: von Carl Schmitts Krisenanalyse schon 1923 bis hin zu
v.Arnims Diktum von 1995 über die "Legitimationskrise des
Parlamentarismus".
Ein typisch liberales Ordnungsprinzip ist das der Balance.
In aufklärerischer Tradition will der Liberale überall eine ausbalancierte
Vielheit schaffen und erhofft sich aus der Ausbalancierung der Kräfte eine höhere
Harmonie. Im politischen Raum führt dieses Prinzip zur Idee des Parlaments.
Seine Ratio liegt in der Auseinandersetzung von Gegensätzen und
Meinungen, aus der sich die richtige Entscheidung als Resultat ergeben
soll. Aus dem freien Kampf der Ideen soll aufklärerisch-rationalistischem
Glauben nach die Wahrheit entstehen als die aus dem Wettbewerb sich von
selbst ergebende Harmonie.
Heute wird dieser Glaube als "Theorie der
kommunikativen Vernunft" von Jürgen Habermas
vertreten. Mit der praktischen Einlösung dieses Dogmas
steht und fällt die parlamentarische Idee. Zur bloßen Konfliktregulierung
und zum reinen innergesellschaftlichen Interessenausgleich
bedürfte es nämlich keiner vom ganzen Volk
gewählten Abgeordneten. Es würde ein Gremium genügen, in das die "gesellschaftlich
relevanten Gruppen" ihre Vertreter entsenden.
Wie sehr das Dogma von der sich aus dem freien Gedankenaustausch
ergebenden höheren Harmonie und der sich ihm ergebenden
"Wahrheit" noch heute Leitidee der Verfassung ist, zeigte das Bundesverfassungsgericht: Es geht von einem Verfassungsgebot des
grundsätzlich staatsfreien und offenen Meinungs- und Willensbildungsprozesses
vom Volk zu den Staatsorganen aus. Die Rechtfertigung staatlichen Handelns
beruht danach letztlich darauf, daß der aus einem freien Prozeß der Meinungsauseinandersetzung
resultierenden Entscheidung eine höhere formale Legitimation innewohnen
soll. Was so für das Volk insgesamt gelten soll, spiegelt sich im kleinen im
Parlament wider.
Tatsächlich war demgegenüber das Dogma der Entscheidungsfindung
auf Grund freien Gedanken- und Meinungsaustauschs schon 1923 gefallen, als
Carl Schmitt
mit bis heute unveränderter
Aktualität notieren konnte: "Die Parteien treten heute nicht mehr als
diskutierende Meinungen, sondern als soziale oder wirtschaftliche Machtgruppen
einander gegenüber, berechnen die beiderseitigen Interessen und Machtmöglichkeiten
und schließen auf dieser faktischen Grundlage Kompromisse und Koalitionen."
"Nach liberaler Auffassung ist die Politik
wesentlich ein Kampf um Positionen, die Verfügung über administrative Macht
einräumen. Der politische Meinungs- und Willensbildungsprozeß in Öffentlichkeit
und Parlament ist durch die Konkurrenz strategisch handelnder kollektiver
Aktoren um den Erhalt oder den Erwerb von Machtpositionen bestimmt."
"Die Massen werden durch einen Propaganda-Apparat
gewonnen, dessen größte Wirkungen auf einem Appell an nächstliegende Interessen
und Leidenschaften beruhen. Das Argument im eigentlichen Sinne, das für
die echte Diskussion charakteristisch ist, verschwindet."
"Heute wirkt es wie eine Satire, wenn
man einen Satz von Bentham
zitiert: 'Im Parlament treffen sich die
Ideen, die Berührung der Ideen schlägt Funken und führt zur Evidenz.'"
Das parlamentarische Formprinzip der Entscheidungsfindung
aufgrund öffentlicher Diskussion ist längst zur inhaltsleeren Formalie
degeneriert. Von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, fallen die wesentlichen
Entscheidungen nicht mehr im Parlament. Die wünschenswerte demokratische
Willensbildung im Volke aufgrund freier geistiger Auseinandersetzung,
die Willensbildung "von unten nach oben", führt ihren Reigen allenfalls
noch über dem Sternenzelt des Ideenhimmels, nicht aber hienieden im allgegenwärtigen
Medienstaat oder gar im Bundestag. Wirklich entschieden wird auf Parteitagen,
informellen Treffen von Spitzenpolitikern,
in schriftlichen "Verträgen" einzelner
Seilschaften zur Aufteilung der Beutemasse, bestenfalls noch in der Koalitionsrunde,
aber nicht in den verfassungsmäßig vorgesehenen Staatsorganen. "Fraktionsdisziplin
und -zwang bestehen fort. Koalitionsvereinbarungen legen fest, wann das
Abstimmungsverhalten im Parlament den Abgeordneten - horribile dictu - freigestellt werden soll."
Koalitionen sind in der Verfassung nicht vorgesehen und
beeinträchtigen verfassungsrechtliche Kompetenzen von Staatsorganen, nämlich
die Personalhoheit (Art.64 I GG) und Richtlinienkompetenz (Art.65 S.1 GG)
des Kanzlers und die Ressortkompetenz der Bundesminister (Art.65 S.2 GG).
Koalitionsentscheidungen unterliegen, da im Gesetz nicht vorgesehen,
keiner verfassungsrechtlichen oder sonst richterlichen Kontrolle.
Wie drastisch die nach der Idee des Parlamentarismus
und dem Willen des Bonner Grundgesetzes vorgesehene Entscheidung aller
Fragen des Gemeinwohls durch demokratisch legitimierte Institutionen zur
Farce geworden ist, schildert uns Waldemar Schreckenberger,
der von 1982 bis 1989 Staatssekretär
im Bundeskanzleramt war und es daher wohl wissen muß. Der heutige Professor
an der Verwaltungshochschule in Speyer sieht die Koalitionsrunden als ein
Symptom auf dem Wege zum Parteienstaat an.
Er berichtet aus seiner Erfahrung, daß die Entscheidungsverfahren
in den staatlichen Gremien Bundestag und -kabinett zunehmend überlagert
werden durch interne Beschlüsse der Parteien, den wirklichen Trägern der
Macht. Zwischen Kabinett und Koalitionsrunde habe sich eine Arbeitsteilung
ergeben, nach der die massenhaften Routinesachen dem Kabinett verbleiben,
die wichtigsten Sach- und Personalfragen aber im Regelfall von der Koalition
vorentschieden werden. Die nachfolgenden Kabinetts- und Parlamentsbeschlüsse
erscheinen nur noch als Vollzugsakt vorausgegangener Parteivereinbarungen.
Es entsteht zumindest der Schein, als sei die Regierung ein bloßes Durchführungsorgan
oder das geschäftsführende Management der sie stützenden Parteien.
Diese Beobachtung hatte Carl Schmitt
schon 1923 gemacht: Die wesentlichen
Entscheidungen fallen in geheimen Sitzungen der Fraktionsführer oder gar
in außerparlamentarischen Komitees, so daß eine Verschiebung und Aufhebung
jeder Verantwortlichkeit eintritt und auf diese Weise das ganze parlamentarische
System nur noch eine schlechte Fassade vor der Herrschaft von Parteien und
wirtschaftlichen Interessenten ist. Koalitionsentscheidungen sind nicht transparent,
obwohl sie im nachhinein Wahlentscheidungen verändern, womit sie im Ergebnis
das demokratische Prinzip selbst einschränken. Und Schreckenberger folgert in diesem Sinne
1992 weiter, daß diese institutionalisierten Formen der Einflußnahme und
des Zugriffs auf den Staat zwar für die Koalitionsparteien einen Machtgewinn
bedeuten. Für eine nur dem Parlament verantwortliche Regierung bedeutet
es dagegen eine Herabstufung zu einem Ausführungsgehilfen von Parteioligarchen.
Die Regierungsmitglieder fungieren damit als Repräsentanten von Gremien
der Parteienkoalition, statt von demokratisch legitimierten Staatsorganen,
was Schreckenberger "schwer erträglich" findet: Eine
"Oligarchie der führenden Politiker bei geringer Transparenz."
Nicht weniger bedeutsam sei die Einflußnahme
von Koalitionsparteien auf den parlamentarischen Entscheidungsprozeß:
Wesentliche Regelungen eines Gesetzesentwurfs, die bereits die Billigung
der Koalitonsrunde gefunden haben, lassen sich im Parlament nur noch
schwer verändern. So wird der Staat nicht aus seinen verfassungsmäßigen
Institutionen gelenkt, sondern aus Parteigremien ferngesteuert.
Über die Koalitionsvereinbarung zwischen den Grünen und der
SDP in Nordrhein-Westfalen schrieb Scheuch
sogar: "Waren die Abgeordneten bislang schon
durch die starke Stellung der Fraktionsspitzen als Einzelpersonen weitgehend
entmachtet, so ist dies in diesen Koalitionsvereinbarungen noch ein Stück
weiter getrieben hin zu dem Abgeordneten als Abstimmungssoldaten. Das Koalitionspapier
ist nicht nur ein weiterer Schritt weg von einer parlamentarischen Demokratie,
die diesen Namen verdient. Es ist auch zugleich ein Schritt hinzu einer Art
Fünf-Jahres-Plan, wie man ihn aus nichtdemokratischen Regimen kennt."
Wie hatte es doch in einer Rede Hitlers
auf dem Reichsparteitag Triumph des Willens geheißen: Nicht
der Staat hat der Partei zu befehlen, nein, die Partei schafft sich ihren
Staat. Und wie war es in den kommunistischen Diktaturen des Ostblocks?
"Die Partei führt, der Staat verwaltet."
Nicht die Regierung war also Träger der
Macht, sondern das hinter ihr stehende Politbüro, die Partei. Genau hier verläuft
die Scheidelinie zwischen der heute so bezeichneten parlamentarischen
Demokratie in Gestalt der bloßen Parteiendemokratie und einem Parteienstaat.
Bei ihm ist die Macht des Volkes höchstens noch Fiktion und damit zur
Fassade verkommen. Tatsächlich herrschen eine oder mehrere Blockparteien,
die sich, wozu jede zur Macht gelangte Gruppe neigt, nach außen für das Allgemeine
ausgeben
und mit dem Staat identifizieren. Die Identifizierung
von Staat bzw. Regierung und Parteien bedeutet aber schon begrifflich den
reinen Parteienstaat.
Nicht besser steht es mit dem anderen parlamentarischen
Grundaxiom, der Ausbalancierung der Gewalten.
Die von Locke und Montesquieu
entwickelte Lehre zur Ausbalancierung der
Gewalten ist eine typisch liberal-aufklärerische Verfassungsidee. Sie
beruht auf der bürgerlichen Überzeugung vom Gleichgewicht. Stünden
wiederstreitende Kräfte im Gleichgewicht, würden sie sich wechselseitig ausbalancieren
und bildeten eine höhere Harmonie. Von dieser "mechanischen Gleichgewichtsmetapher"
machte auch Montesquieu ausgiebigen Gebrauch und gab ihr eine spezifische
Wendung, indem er das Gleichgewicht als wünschenswerte "Mäßigung" der
souveränen Staatsgewalt umschreibt.
Von der Lehre Montesquieus ist heute vornehmlich der Grundgedanke
anwendbar geblieben: Die Idee, dem Bürger möglichst viel Sicherheit zu
geben, indem die Staatsbefugnisse auf verschiedene Häupter verteilt
werden. Sobald in ein und derselben Person oder "Beamtenschaft"
die legislative Befugnis mit der exekutiven verbunden werde, gebe es keine
Freiheit.
Es gab im 18. Jahrhundert andere gesellschaftliche Machtfaktoren.
Während heute machtvoll organisierte Interessengruppen, Parteien und Massenmedien
den Ton angeben, hatte Montesquieu als Mächtige den König, den Adel und das
Bürgertum vorgefunden. Diesen Gruppen versuchte er die einzelnen
staatlichen Machtbefugnisse zuzuordnen, die sogenannten Gewalten: Adel
und Bürgertum sollten, in Vertretungskörperschaften organisiert, gemeinsam
die Gesetze machen, gegen die der König nur ein Einspruchsrecht hatte. Die
Richter sollten jährlich aus der Menge des Volkes ausgesucht werden. Weil
die gesellschaftliche Realität und ihre Akteure sich grundlegend gewandelt
haben, können Montesquieus Zuordnungen der Befugnisse zu bestimmten Gruppen
so nicht mehr funktionieren. Seine Grundidee kann heute nur sinngemäß auf
die heutigen Machtfaktoren der Gesellschaft angewandt werden.
Der gedankliche Kern der Trennung von Befugnissen und der
Aufteilung der Macht drückt sich in Inkompatibilitäten aus, das heißt dem
Verbot, nach dem ein und dieselbe Person oder Personengruppe nicht
gleichzeitig zwei verschiedene Gewalten innehaben oder an ihnen teilhaben
darf. Das entspricht der Idee nach der heute gängigen Staats- und Verfassungslehre,
ist im Grundgesetz aber nur in bezug auf einzelne Personen verwirklicht. So
ist bekannt, daß es gesetzliche Verbote der gleichzeitigen Zugehörigkeit zu
mehreren Gewalten gibt.
Montesquieu hatte das Verbot aber ausdrücklich weiter als
heute gefaßt und auch mit der Freiheit für unvereinbar erklärt, wenn verschiedene
Einzelpersonen aus "derselben Beamtenschaft" mehrere Gewalten
inne hätten. Mit Bedacht hatte er jede der Staatsfunktionen einer bestimmten,
in sich als weitgehend homogen vorgestellten gesellschaftlichen Gruppe
zugeordnet, beispielsweise die Gesetzgebung derjenigen Kammer, die aus
dem Bürgertum hervorgegangen war und einer anderen aus dem Adel. Keiner
dieser Gruppen gehörte der König als Haupt der Exekutive persönlich an.
Montesquieu hätte sich nicht einfallen lassen, Personen aus ein und
derselben Gruppe, etwa dem Adel, gleichzeitig die Exekutive und die
Mitwirkung an der Gesetzgebung anzuvertrauen. Er betont mehrfach, daß
nicht nur eine Einzelperson keinesfalls Einfluß auf mehr als eine Staatsgewalt
gleichzeitig haben darf, sondern daß auch ein und dieselbe Personengruppe
nicht mehrere Staatsbefugnisse besetzen dürfe: "Alles wäre verloren, wenn
ein und derselbe Mann bzw. die gleiche Körperschaft entweder der Mächtigen
oder der Adligen oder des Volkes alle drei Machtvorkommen ausübte".
Als negatives Beispiel schildert Montesquieu die Situation
in den italienischen Republiken seiner Zeit: "Die gleiche Beamtenschaft
hat als Ausführer der Gesetze alle die Befugnisse, die sie sich als Gesetzgeber
selbst verliehen hat. Sie vermag den Staat durch ihren Willen zu verheeren.
Da sie auch noch die richterliche Gewalt innehat, vermag sie jeden Bürger
durch ihre Sonderbeschlüsse zugrundezurichten. Alle Befugnisse bilden
hier eine einzige. Obwohl hier keine äußere Pracht einen despotischen Herrscher
verrät, bekommt man ihn auf Schritt und Tritt zu spüren."
"Der Despotismus der modernen
Demokratie hat einen anderen Charakter, er ist viel weitergehender und
sanfter und erniedrigt die Menschen, ohne sie zu quälen."
Der "Despotismus der Vielen" war in
Montesquieus "Augen nicht viel besser als die Despotie des Einen".
Diesen Beobachtungen entspricht weitgehend der
politische Alltag der Bundesrepublik und markiert eine der beiden entscheidenden
Einbruchstellen des Parteienstaats in die gewaltenteilende Verfassungsordnung,
die deshalb, jedenfalls im klassischen Sinne, nicht mehr funktioniert. Dem
englischen Vorbild folgend sind die gesetzgebende Gewalt und die
Spitze der Exekutive in Bund und Ländern nämlich in doppelter Weise miteinander
verschmolzen:
Zum einen wird nach Art.63 und 67 GG der Kanzler vom Bundestag
gewählt und kann von ihm jederzeit durch einen anderen ersetzt werden.
Durch diesen Zustand ist die Bundesregierung (Art.62 GG) technisch auf die
Funktion eines Parlamentsausschusses beschränkt. Da auch der Kanzler
selbst - nicht zwangsläufig rechtlich, aber praktisch - Parlamentsmitglied
ist, rechtfertigt sich für dieses Regierungssystem der Begriff Parlamentsregierung. Dieses parlamentarische Regierungssystem ist nicht zu verwechseln
mit der parlamentarischen Demokratie.
Der erste Begriff ist eine extreme Unterform
des zweiten. Es widerspricht der Lehre von der Gewaltenteilung und verzerrt
diese bis zur Unkenntlichkeit.
Hier ist das Volk nicht, wie in der monarchischen
Regierungsform, durch einen König repräsentiert; es ist auch nicht als
handelnde politische Einheit - demokratisch - mit sich selbst identisch;
vielmehr ist die Herrschaft des Parlaments im Prinzip ein Fall von
Aristokratie, oder, in der entarteten Gestalt, eine Oligarchie.
Wenn die Exekutive von der Legislative
abhängig ist, besteht die Gewaltentrennung nur dem Namen nach und erfüllt ihren
Zweck nicht.
Zum anderen sind Exekutive und Legislative dadurch machtmäßig
verbunden, daß sie beide unter dem beherrschenden Einfluß einer Partei
oder Parteienkoalition stehen und keine selbständigen Entschlüsse zu
fassen pflegen. Regierung und Bundestag werden heute faktisch aus der
Parteizentrale der Mehrheitspartei oder der Koalitionsrunde ferngelenkt,
was jede Gewaltenteilung zur bloßen Fiktion werden läßt.
Nach der bürgerlichen Ideologie des Liberalismus soll eine
Balance auch innerhalb des Parlaments erforderlich sein.
Davon kann im Parteienstaat aber keine Rede
sein, weil im wesentlichen dieselben, durch die 5%-Klausel unter sich bleibenden
Kräfte im wesentlichen homogen sind. Durch die verbindende Klammer der Mehrheitspartei(en)
verschwindet zwischen den Gewalten jenes Spannungsverhältnis, das für
das Funktionieren der Gewaltenteilung grundlegend und unverzichtbar
ist. "Die entscheidenden handelnden Personen sind durchweg führende
Politiker der Parteien. Sie nehmen gleichsam eine Integrationsfunktion von
Regierung, Parlament und Koalitionsparteien wahr." "Wenn sich in der politischen Wirklichkeit
eines Staates nicht mehr wie bei Montesquieu Legislative und Exekutive als
miteinander echt konkurrierende Gewalten gegenüberstehen, sondern einerseits
ein Konglomerat aus Regierung und parlamentarischer Mehrheit und andererseits
die Opposition als parlamentarische Minderheit, die zudem durch das Mehrheitsprinzip
jederzeit überstimmt werden kann, kann von einer Gewaltenteilung vernünftigerweise
nicht mehr die Rede sein."
"Wir können daher von einer Art
'Oligarchie' der Spitzenpolitiker der Parteien sprechen."
Das Grundgesetz kennt keine Vorkehrungen dagegen, daß ein
und dieselbe Partei die Gesetze macht, anwendet und noch aus ihren Reihen
Richter bestimmt, die über die Auslegung des Gesetzes zu wachen haben. Es
ist gegenüber der Existenz politischer Parteien fast blind, und in
Ausnutzung dieses blinden Flecks konnten diese die Macht über Exekutive und Legislative
vollständig und über die Rechtsprechung im ausschlaggebenden Teilbereich
der Verfassungsgerichtsbarkeit und der oberen Gerichte usurpieren.
Das GG nennt die Parteien nur nebenbei in Art.21, nach dem
sie an der politischen Willensbildung mitwirken sollen. Die Schöpfer der
Verfassung hielten es für ausreichend, die drei Staatsgewalten institutionell
für voneinander unabhängig zu erklären. Es soll keine Gewalt der anderen
Anweisungen geben können. Die Fülle der Macht soll auf verschiedene Ämter
und Institutionen verteilt und ein System der "checks and balances" geschaffen werden. Die Fülle
verschiedener Ämter soll die Amtsträger in ihrer Machtentfaltung hemmen
und gegenseitig ausbalancieren. Das für eine ausreichende Sicherung gegen
Machtzusammenballungen anzusehen, ist aber naiv, weil es die
parteilichen, ämterübergreifenden Machtstrukturen ignoriert und jeden
Parteigänger im Amte als bloßen Einzelkämpfer ansieht. Die politischen
Parteien spielen sich immer mehr selbst als Interessengruppen in eigener
Sache auf. Weil sie die Gesetzgebung, die staatlichen Haushalte und die
Exekutive beherrschen, unterlaufen sie die überkommenen Elemente gewaltenteilender Checks and Balances.
"Die vorhandenen checks and balances verdanken sich eher den ausdrücklichen oder
stillschweigenden Spielregeln, die das Zusammenleben von Parteien, Verbänden
etc. auf der unentbehrlichen Basis einer ungestörten Reproduktion der materiellen
Voraussetzungen des sozialen Systems leiten, den verfassungsrechtlichen
Bestimmungen."
Wie Kondylis generalisierend
ausführt, gibt es "zwei Grundformen von Nichtrealisierung der Gewaltenteilung", von denen er unsere
beschreibt: "Die Legislative wird zwar vom souveränen Volk gewählt, wie
auch immer dessen Zusammensetzung ausfällt, und als Repräsentantin des Volkswillens
trifft sie souveräne Entscheidungen. Sie wird aber ihrerseits durch die
stärkste politische Partei beherrscht, deren ausführendes Organ faktisch die
Regierung ist. Die stärkste Parteiführung dominiert also im Parlament, sie
kontrolliert die Exekutive, und sie bestimmt direkt oder indirekt die
Zusammensetzung und die Zuständigkeiten der Judikative."
Schon Montesquieu hatte dieses Konzept als unzureichend mit
den Worten verworfen: "Die Ämterfülle mindert das Ämterwesen manchmal.
Nicht immer verfolgen alle Adligen dieselben Pläne. Gegensätzliche Tribunale,
die einander einschränken, bilden sich. Auf solche Weise hat in Venedig der große Rat die Legislation inne, der Pregadi die Durchführung, die Vierzig die Gerichtsbefugnis. Das
Übel besteht aber darin, daß diese unterschiedlichen Tribunale durch
Beamte aus der gleichen Körperschaft gebildet werden. So entsteht kaum etwas
anderes daraus, als die eine gleiche Befugnis."
In Deutschland besteht heute dasselbe Übel:
Alle Gewalten sind von Mitgliedern derselben Parteien besetzt. Sie konstituieren
letztlich den Staat und zwingen allen seinen Teilen ihre Gesetzlichkeit auf.
Ihre "fettfleckartige Ausbreitung"
über alle staatlichen und halbstaatlichen
Einflußbereiche bringt es mit sich, daß wir uns - wie im Märchen vom Hasen
und vom Igel - am Anblick der Staatsparteien tagtäglich erfreuen dürfen,
sei es im Bundestag, sei es in der parteiproportionierten Verwaltung,
bei den parteiproportionierten Obergerichten oder im Medienbereich,
dessen Chefsessel heißbegehrte Beutestücke der Parteien sind. Das Staats-Parteiensystem hat die klassische
Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt,
weil alle Gewalten gleichermaßen von partei(an)ge-hörigen
Seilschaften durchsetzt sind, denen Parteiräson vor Staatsräson geht. Der
Parteienstaat läßt die Gewaltenteilung "unwirklich und fassadenhaft"
erscheinen.

Schon Montesquieu hatte das System der Parlamentsregierung
mit den Worten verworfen: "Es gäbe keine Freiheit mehr, wenn es keinen
Monarchen gäbe und die exekutive Befugnis einer bestimmten, aus der
legislativen Körperschaft ausgesuchten Personenzahl anvertraut wäre,
denn diese beiden Befugnisse wären somit vereint. Dieselben Personen hätten
an der einen und der anderen manchmal teil - und somit könnten sie immer
daran teilhaben."
Genau dieser Zustand kennzeichnet die
Verfassungssituation des Grundgesetzes. Es gibt hier schon seit November
1918 keine institutionell unabhängige Regierungsgewalt mehr: Die
Regierung ist eben nur ein Parlamentsausschuß und kann vom Bundestag jederzeit
abgewählt werden. "Zwischen Parlament und Regierung besteht keine Verschiedenheit
mehr. Die ständige Angst der Parlamentsgewaltigen ist, daß sich eine Regierung
von ihnen unabhängig machen könnte," was sie nach der Theorie der Gewaltenteilung
doch müßte. "Das Parlament, sozusagen das Gehirn dieses machtgierigen
Systems, will unter Beseitigung jeder Gewaltenteilung alleinige
Machtquelle werden," warnte Edgar J. Jung
1930; und seit 1949 ist das
dem Parlament vollständig gelungen.
Im Vaterland von Montesquieus ist die Mitgliedschaft in der Regierung mit einem
Parlamentsmandat bis heute unvereinbar. "In der Bundesrepublik Deutschland",
klagt dagegen der Hamburger Professor von
Münch, " werden im Jahre
1998 anläßlich des zweihundertfünfzigjährigen Jubiläums des Erscheinens von Montesquieus berühmtem Werk "De
l'Esprit des lois" gewiß viele kluge Reden über Sinn und Notwendigkeit
der Gewaltenteilung gehalten werden. Die Verhöhnung des Grundsatzes der
Gewaltenteilung durch Minister und Abgeordnete in einer Person wird vermutlich
bleiben." Auch wenn das Grundgesetz die Unvereinbarkeit
von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat im Normalfall nicht ausdrücklich
vorschreibe so bleibt dennoch die Tatsache bestehen, daß die gleichzeitige
Innehabung von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat eine schwerwiegende Durchbrechung
des Grundsatzes der Gewaltenteilung darstelle, rügt v.Münch weiter und witzelt
für den Fall einer Rede eines Ministers und Abgeordneten vor dem Plenum:
"Der Doppelkopf muß vor Beginn seiner Rede im Bundestag kundtun, ob
er/sie als Abgeordneter oder als Minister spricht." Zur Gewaltenteilung
gehöre nämlich auch die personelle Gewaltenteilung, die sich in Unvereinbarkeiten
konkretisiert.
Suche man nach Rechtfertigungsgründen
für die Vereinbarkeit von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat, so finde man
nur mehr oder minder pauschale Hinweise auf "die parlamentarische Tradition" oder auf 'das parlamentarische Regierungssystem'.
Mit solchen Allgemeinplätzen lasse die Zwittergestalt eines Abgeordnetenministers
oder Ministerabgeordneten sich aber nicht halten.
Die Rechtfertigungsversuche aus Kreisen der Nutznießer der
Parteienstaatlichkeit laufen auf zwei Hauptargumente gegen den Befund
hinaus, nach dem es Gewaltenteilung im eigentlichen Sinn in Deutschland heute
nicht gibt: Zum einen werde die geballte Macht des relativen Absolutismus,
der durch die unumschränkte Herrschaft der Parlamentsmajorität (auf Dauer
einer Legislaturperiode) geschaffen wird, dadurch gemildert, daß es zwei
Parteien gebe, die sich in der Herrschaft regelmäßig ablösten. Zum anderen
gewährleiste der Föderalismus eine gänzlich neue Art vertikaler Gewaltenteilung.
Das Argument mit den einander ablösenden Parteien mag vielleicht im England
vergangener Jahrhunderte funktioniert haben. Die heutigen Großparteien
aber durchdringen alle Lebensbereiche und wollen gemeinsam jede Alternative
vom Zugang zu Macht und Pfründen ausschließen. Ein Wettbewerb mit gewaltenteilender
Nebenwirkung fällt daher aus.
Ihre politischen Positionen ähneln einander
zum Verwechseln. Überdies hat seit Bestehen der Bundesrepublik noch nicht
ein einziges Mal das Volk in einer Bundestagswahl einen Regierungswechsel
erreicht, weil ungeachtet der Stärke der beiden Großparteien stets die FDP
als Mehrheitsbeschaffer den Ausschlag für die eine oder die andere Koalitionsregierung
gab. Das Argument der Machtminderung durch zwei ausbalancierte Parteien
zieht also nicht. Auch das Argument, der Föderalismus schaffe eine Machtaufgliederung
neuer Art, ersetzt nicht die Notwendigkeit der klassischen Gewaltenteilung.
Die Übermacht der Großstrukturen politischer Massenparteien bricht sich
keineswegs an Ländergrenzen.
Das entscheidende Versagen des Grundgesetzes liegt darin,
daß es eine reine Parteienparlaments-Herrschaft zuläßt und seinen Parlamentsparteien
den unumschränkten Zugriff auf alle Gewalten ermöglicht, weil es ihn nicht
verbietet. So entstand das Gegenteil von einer Gewaltenteilung: eine Gewaltenverfilzung
nämlich. Die Gewaltenteilung ist hier und
heute kein echtes politisches Machtverteilungsprinzip mehr, sondern sie ist
zu einer reinen Zuständigkeitsaufteilung von Gremien verkommen, die allesamt
in den Händen derselben "Beamtenschaft" (Montesquieu) bzw.
Parteien liegen. Die Omnipotenz dieser Parteien
tendiert zum Einparteienstaat.
Dabei kann "die Partei" im funktionalen
Sinne durchaus auf mehrere unselbständige (Modell DDR) oder selbständige
(Modell BRD) Organisationen verteilt sein, wenn diese ihre Claims abgesteckt
haben, gemeinsam aber den wesentlichen Teil der Staatlichkeit besetzt
halten. Agnoli
hat das die plurale Form
einer Einheitspartei
genannt.
Auch v.Arnim
zieht ausdrücklich die
Parallele zu den früheren "kommunistischen Monopolparteien": Etwa
"hinsichtlich neuer Diätengesetze" sehe sich der Bürger
"regelmäßig einem Kollektivmonopol der etablierten Parteien gegenüber.
Diese verhalten sich also dort, wo sie durch Blockbildungen in Sachen Politikfinanzierung
die Konkurrenz ausschalten, partiell selbst wie Einheitsparteien östlichen
Musters." Sie tendieren dabei, mit den Worten v.Arnims, zu einem neuen
Absolutismus. Durch ihre Gesetzentwürfe anläßlich der Parteienfinanzierung 1995
versuchten die Parteien, "sich zum eigenen Wohl aller [demokratischen und
richterlichen] Kontrollen ein für allemal zu entledigen und sich dadurch in Sachen
eigener finanzieller Ausstattung jetzt und in Zukunft praktisch kontrollos zu stellen. Das ist das Gegenteil
dessen, was das Prinzip der Gewaltenteilung verlangt." "Hat sich die
"politische Klasse" aber erst einmal in bezug auf ihre eigene
Finanzierung der Kontrollen entledigt, wird dieses - aus ihrer Sicht -
bestechende und das Regieren scheinbar so sehr erleichternde Vorgehen auch auf nichtfinanzielle Bereiche übergreifen,
in denen es um Eigeninteressen der politischen Klasse geht."
"Je mehr sich
die Parteien den Staat zur Beute machen und damit zu Staatsparteien degenerieren,
desto mehr hebt sich der Parteienstaat nur noch durch das Mehr-Parteiensystem von der Parteidiktatur
ab." Faßt man den Diktaturbegriff nicht
verfassungsrechtlich, sondern versteht darunter jede schrankenlose Machtausübung,
rechtfertigt sich gar der Satz: Heute, Ende des 20. Jahrhunderts, stellt die
Diktatur unserer Parteifunktionäre, Parteiapparate, Parteizentralen
zweifellos eine sehr aufgeklärte, wenn auch die typischen Ohn-machtsgefühle
hervorrufende Diktatur dar."
Dies ist umso bedenklicher, weil sich die zwei großen Parteien
programmatisch einander annähern.
Nach Parallelen zwischen den Blockwahlen
in der DDR und Blockwahlen innerhalb der Bonner Parteien befragt, antwortete
der Soziologe Erwin Scheuch
anhand persönlicher Erfahrungen:
"Wie in der DDR! Wir haben noch mehrere Parallelen zur DDR." Vor diesem Hintergrund erscheinen alle
klassischen Gewalten zuzüglich moderner Mediengewalt als in den Händen
eines Parteienkartells, dessen Teilsysteme nach außen hin Schaukämpfe
austragen, inhaltlich aber nicht für Alternativen stehen. Ihr Wahlkampf
ist Schwindel, weil er programmatische Verschiedenheit vortäuscht.
"Es ist das gleiche wie die Kämpfe zwischen gewissen Wiederkäuern,
deren Hörner in einem solchen Winkel gewachsen sind, daß sie einander
nicht verletzen können. Wenn er aber auch nur ein Scheingefecht ist, so ist
der doch nicht zwecklos,
sondern
hilft, die besondere
geistige Atmosphäre aufrecht" und ihre "Gesellschaftsstruktur
intakt zu halten."
So besteht der Zweck der Großparteien heute hauptsächlich
darin, Wahlverein für den einen oder den anderen Kanzler zu sein - eben
Scheuchs Postenverteilungskartell auf Dauer. In ihrer wechselseitig
sich stabilisierenden gegenseitigen Bezogenheit gleichen sie den
drei globalen "Superstaaten" in George Orwells
1984, die "einander nicht überwinden können, sondern auch
keinen Vorteil davon hätten. Im Gegenteil, solange sie in gespanntem Verhältnis
zueinander stehen, stützen sie sich gegenseitig wie drei aneinandergelehnte
Getreidegarben." In Wahlkampfzeiten reduzieren sie und ihre
Medienstrategen die Wahlentscheidung der Bürger gern auf polarisierende
Parolen wie "Freiheit oder Sozialismus" erzeugen operativ den Eindruck eines Kopf-an-Kopf-Rennens der Kandidaten
der Großparteien, um den Wähler in eine Scheinalternative zu zwingen und
die ohnehin kleine Konkurrenz aus dem Wählerbewußtsein zu tilgen. Im Endeffekt
entwickelt Deutschland sich vom partiellen zum tendenziell totalen Parteienstaat
,
in dessen Rahmen die Parteien eine schallschluckende Styroporschicht
bilden, in der die Rufe der Wähler verhallen
,
und die sich immer dichter, drückender über ein Gemeinwesen legt, in dem
die angebliche Gewaltenteilung längst zur Lebenslüge
geworden ist.
Jeder Herrschaftsordnung liegt die Unterscheidung zwischen
Herrschenden und Beherrschten zugrunde. Eine Ordnung ohne Herrschende und
beherrschte ist Utopie. Auch das Grundgesetz Deutschlands geht von Herrschaft
aus. Mit Recht definiert das BVerfG es ausdrücklich als Herrschaftsordnung.
Die Beherrschten sind das Staatsvolk. Wenn wir es als Objekt
zu seinem regierenden Subjekt in Beziehung setzen, können wir es sinnvollerweise
auch als Gesellschaft in Beziehung
auf die Staatsgewalt bezeichnen.
Dem Dualismus von Staat und Gesellschaft entspricht strukturell der von
Exekutive und Legislative. Schon in Montesquieus
Lehre vertritt der König als Regierender den
Staat, wohingegen Bürgertum und Adel (heute gemeinsam "Volk")
das Objekt der Regierung sind und die Gesellschaft bilden. Sie steht damit der staatlichen Regierungsgewalt gegenüber. Sie
organisiert sich im Parlament und setzt sich dort autonom ihre Rechtsregeln.
Wer diese Trennung von Staat und Gesellschaft aufhebt, entfesselt einen
absoluten Staat oder eine absolute Gesellschaft. Beide garantieren das Ende der
individuellen Freiheit. Deutschland tendiert heute zur absoluten Gesellschaft.
Staat und Gesellschaft miteinander verschmelzen zu lassen
oder dem Staat die Rolle des Regierens und der Gesellschaft die der autonomen
Rechtsetzung zuzuordnen, Staat und Gesellschaft damit als funktional
gewaltenteilend zu trennen, ist die Gretchenfrage heutiger Staatswissenschaft.
Wo die Gewalten nicht geteilt sind, herrscht
Diktatur. Absoluter Staat und absolute Gesellschaft sind solche Diktaturen,
weil sie keine Gewaltenteilung besitzen, sondern sich alle Gewalten in Händen
des Staates oder in Händen der vorherrschenden gesellschaftlichen Mächte
befinden.
Zwischen der Skylla des absoluten Staates und der Charybdis
des absoluten Gesellschaft bedeutet Gewaltenteilung, den exekutiven Teil
der (theoretisch als umfassend vorgestellten) Staatsgewalt dem Staat als solchem und den legislativen
Teil der Gesellschaft zuzuweisen
und diese somit vom Staat sowohl zur Wahrung ihrer Freiheit abzugrenzen als
auch funktionell zu integrieren. So gesehen liegt der Gewaltenteilungslehre
Montesquieus faktisch die Trennung von Staat und Gesellschaft zugrunde.
Ohne diese Trennung gibt es keine Freiheit:
wenn die Gesellschaft den Staat beherrscht und zur absoluten Gesellschaft wird ebensowenig, wie wenn umgekehrt der
Staat die Gesellschaft verstaatlicht und zum absoluten Staat wird. "Die Geschichte kennt in Wahrheit nur
zwei große Gegensätze in der Staatsauffassung: Freiheit und Absolutismus.
Fälschlicherweise wird unter Absolutismus nur die offene
Gewaltherrschaft" des Staates "verstanden, während deren verdeckte
Form meist übersehen wird:"
die absolute Herrschaft der indirekten gesellschaftlichen
Gewalten.
Wenn der Staat die Gesellschaft an seine Macht kettet,
lassen beide sich voneinander nicht mehr unterscheiden. Dasselbe gilt, wo
gesellschaftliche Kräfte den Staat erobert haben. Überall dort, wo Staat und Gesellschaft ununterscheidbar ineinander verwoben sind, gibt es
keine Gewaltenteilung. Daß es im Staatsabsolutismus keine individuelle und
keine gesellschaftliche Freiheit gibt, muß ich nicht eigens begründen. Aber
auch die Vereinigung der Gewalten in der Hand eines einzelnen Bürgers,
einer ideologischen Formation, einer Partei oder eines anderen Machtkartells
läßt zwangsläufig Staat und Gesellschaft ineinander übergehen. Damit ist
aber eine Grundbedingung menschlicher Freiheit beseitigt:
nämlich der gesellschaftlich neutrale Rechtsstaat.
Nur er ist Schutzmacht der innergesellschaftlich Schwachen
gegen die Starken,
er schützt die Armen vor Ausbeutung, die Alten
vor dem Elend, die Ungeborenen vor dem Egoismus der Lebenden. Er hütet die
Freiheit gegen Übergriffe wohlorganisierter Machtgruppen und wahrt des
Rechtsfriedens gegen das Faustrecht und die latent bürgerkriegsbereiten
innergesellschaftlichen Machtgruppen. Nach Lorenz von Stein besteht das
innerste Prinzip des Gesellschaftlichen in der Unterwerfung der Einzelnen
unter die vielen anderen Einzelnen. Es führt also notwendig zu Unfreiheit.
Es steht damit im direkten Widerspruch zum Prinzip des Staates als der sittlich
verantworteten Freiheit und damit dem wahren Willen und Wohl der Allgemeinheit.
Während daher das Prinzip des Gesellschaftlichen das Interesse ist, ist
das des Staates die Freiheit. Dazu ist er da, er ist nicht Selbstzweck.
Freiheit im neuzeitlichen Sinne bedeutet, den Bürger als Staatsbürger von
gesellschaftlichen Zwängen zu befreien.
Beide Prinzipien - Staat und Gesellschaft - haben ihre
Daseinsberechtigung. Daher darf keines das andere vernichten. Menschen sind
von Natur aus Einzelpersönlichkeiten und Gemeinschaftswesen. Als auf Individualität bedachte Einzelne bilden sie in
ihrer Summe eine Gesellschaft; insoweit sie aber sozialverbunden und -bedürftig
sind, bilden sie Gemeinschaften wie Familie und Staat, die mehr bedeuten
als die Summe ihrer Teile, und sind auf diese bezogen. Die Gesellschaft ist das Innenleben der Gemeinschaft. Beide Aspekte
menschlicher Existenz sind gleichermaßen real und in jedem Menschen
vorhanden. Sozialverbundenheit und Einzelpersönlichkeit sind zwei ergänzungsbedürftige
Aspekte des Menschen und verkörpert in Staat und Gesellschaft. Keiner
dieser Aspekte darf extremistisch verabsolutiert werden. Trotz seiner Eigenständigkeit
braucht der Mensch die Gemeinschaft, ist auf sie bezogen und bleibt daher
Mensch in der Gemeinschaft. Die Bindung an die im Staat verkörperte
Gemeinschaft verhindert, daß Freiheit zur egozentrischen Willkür wird. Der
liberale Anspruch auf individuelle Autonomie läuft aber in letzter Denkkonsequenz
auf bindungslose Willkür hinaus und wird von Niklas Luhmann
mit Recht unter die politischen
Utopien eingeordnet.
Vor der modernen Einsicht in die Doppelnatur jedes Menschen
als Einzel- und Sozialwesen gingen der historische Konservativismus der mittelalterlichen societas civilis bis in die Zeit der
Gegenrevolution
sowie später der Nationalsozialismus
davon aus, daß die Menschen von Natur aus
Glieder objektiver Ordnungen sind; er ließ deshalb die individuelle
Selbstbestimmung, das heißt die Entfaltung der Persönlichkeit, nur unter
Einfügung in die gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen
mit ihren Eigengesetzlichkeiten zu. Hier kommt - im Gegensatz zum
Liberalismus - der Gemeinschaft der Vorrang vor dem Einzelnen zu; er ist
ihr teils untergeordnet, teils eingeordnet.
Somit führt die Auflösung der Dialektik
von Staat und Gesellschaft zugunsten des Staates zur Verstaatlichung der
Gesellschaft und zur Wiederkehr eines Staatsabsolutismus. Und vor der
anderen Möglichkeit der Vergesellschaftung des Staates warnt Lorenz von
Stein,
indem er am Endpunkt dieses
Prozesses den "Tod der Gemeinschaft" sieht: "Es gibt keine
vollendeten Völker, aber es gibt wohl tote Völker. Das sind diejenigen,
in denen es keinen Staat mehr gibt [...], in denen die Staatsgewalt absolut in
den Händen der Gesellschaft ist."
Das Mittelalter hatte eine Trennung von Staat und Gesellschaft
nicht gekannt: In der eigentümlichen Form des Lehnsstaats, des sog. Feudalismus,
war alles "Gesellschaft". Zwischen König und Vasall, Vasall und
Untervasall bis hin zum fronenden Bauern waren alle Rechtsverhältnisse rein
personaler Natur und endeten mit dem Tode ihrer Träger. Die Lehnspyramide war
ein Rechtsgefüge, das auf Verpflichtungen zwischen Personen beruhte. Ein
"Staat" war nicht vorgesehen. Nach der Krönung eines Königs in
Deutschland hatten die Reichsstädte nichts Eiligeres zu tun, als diesem seine
persönliche Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten abzubitten. Was
gingen ihn auch die Versprechungen seines Vorgängers an? Ein Staat als überpersönliche
Rechtsfigur im abstrakten Sinne wie heute existierte nicht. Für jeden
einzelnen hatte das die praktische Konsequenz, daß er in einen hierarchischen
Gesellschaftsaufbau streng eingebunden blieb. Im Normalfall hatte er keine
Chance, seinem Geburtsstand zu entkommen. Niemand schützte den fronenden
Bauern vor der Willkür seines Grundherrn, und wer gegen die Übermacht
eines anderen Schutz benötigte, konnte den nur in eigener Kraft finden oder
sich einer mächtigen Gruppe anschließen, die ihn schützen sollte. So schloß
man sich zu sozialen Verbänden zusammen und wurde Bürger einer Stadt,
Kaufmann in einer Gilde oder auch Räuber in einer Bande. In diesen gesellschaftlichen
Teilgruppen fand der einzelne Schutz, aber um den Preis der Unterordnung.
Freiheit im Sinne der heutigen Grundrechte, Bürgerrechte oder die Sicherheit
einer privaten Existenz in unserem Sinne gab es nicht.
Die Neuentdeckung des Staates im Sinne der antiken Res publica war die Leistung der
frühen Neuzeit. Er wurde als vom persönlichen Herrscher unabhängig und immerwährend
vorgestellt und bildete eine abstrakte, weil nicht körperlich sichtbare
Rechtsperson, den Leviathan Thomas Hobbes
, oder modern gesprochen:
eine juristische Person. Als solche verkörperte er allen Einzelnen gegenüber
das Recht der Gesamtheit. Er forderte jedem Bürger die Loyalität und den Gehorsam
ab, die ein jeder der Gemeinschaft aller schuldet. Der Zusammenhang zwischen
Schutz und Gehorsam ist unauflöslich.
Der vom Deutschen König verkündete Ewige
Landfriede von 1495 konnte die Selbsthilfe nur mit der inneren
Rechtfertigung seines Versprechens verbieten, das Recht zu garantieren. Ohne Loyalität kann das Gemeinwesen den
inneren und äußeren Frieden nicht gewährleisten und verfehlt damit seinen
Daseinszweck.
Der neuartige Schutz nach innen war vor allem gegen die feudalen
Machtgruppen notwendig: Unter dem Schutz des Staates emanzipierte sich
der Staatsbürger, ein neuzeitliches
Phänomen, von den alten Gilden, Zünften, Grundherren, Patriziern, Konfessionsgemeinschaften
und was es an Machtträgern noch alles gab. Er erlangte ein nie gekanntes Maß
an persönlicher Bürgerfreiheit. In
dem Wort von den Staatsbürgerrechten
wird dieser Zusammenhang deutlich. Es galten nicht mehr die Regeln des Fehdedschungels,
das Faustrecht des gesellschaftlich Stärkeren, sondern die Gesetze des Staates
als über den Parteiungen stehender neutraler Gewalt, die tendenziell jedem
gleiches Recht zu schaffen suchte. Daher war die Staatsmacht konzeptionell
den Machtinteressen der gesellschaftlich Etablierten entgegengesetzt. Das
war sie von Anbeginn: Im Interesse der adligen Grundherren hatte in der
frühen Neuzeit die zähe Verteidigung der feudalen mittelalterlichen Ordnung
gelegen. Daher lehnten sie konservativ die Herausbildung des Staates mit
seiner Trennung von der Sphäre des Gesellschaftlichen ab,
ebenso wie heute die Parteimächtigen als
"neuer Adel" (Scheuch) ihre Herrschaft durch Verschmelzung von Staat
und Gesellschaft stabilisieren. Die Geschichte der Neuzeit kann als fortwährendes
Ringen gesellschaftlicher Gruppen um die Vormacht und die Eroberung der
Schalthebel des Staates verstanden werden, um ihn für ihre Parteizwecke
einspannen und gegen innergesellschaftliche Konkurrenten benutzen zu
können.
Historisch war die Forderung derjenigen sozialen Schichten,
die keinen Anteil an der Macht hatten, auf eine Trennung von Staat und
Gesellschaft und war ihre weitere Erwartung, der Staat möge sie vor der Macht
der Herrschenden schützen, eine altliberale Forderung.
Sie wird immer aktuell sein, wo herrschende
Schichten oder Eliten Staat und Gesellschaft in ihrer Hand haben und miteinander
verschmelzen lassen. Wer die Hebel von Staat und Gesellschaft gleichermaßen
bewegen und steuern kann, hat an ihrer Trennung kein Interesse. Die Forderung
nach einer Trennung war historisch stets eine Kampfansage der Machtlosen
gegen die Mächtigen und ist das noch heute.
Die Trennung von Staat und Gesellschaft ist eine genuin
liberale Forderung, die aus dem typologische Merkmal des liberalen Balancedenkens
zwingend folgt. Daher wird sie bis heute von der radikal-liberalen
Politiktheorie vertreten.
Aber auch ohne die im Kern metaphysische
Begründung liberalen Balancedenkens ergibt sich empirisch aus
anthropologischer Sicht, daß zwei antagonistischen menschlichen Bedürfnissen
auch im Rahmen einer Staatskonstruktion Rechnung getragen werden muß. Weil
der Mensch Gemeinschaftswesen und Individualist ist, kann eine an allgemeinmenschlichen Grundbedürfnissen
orientierte Politiktheorie nicht ohne Trennung von Staat und Gesellschaft
auskommen: Das Staatliche hat die Aufgabe, die individuelle Freiheit und die
gesellschaftliche Existenz selbst nachhaltig zu schützen. So begründet
braucht sich die Forderung nach einer Trennung von Staat und Gesellschaft
nicht den Vorwurf machen zu lassen, sie sei selbst Liberalismus.
Die Oberhoheit des Staats gegenüber den Machtgelüsten gesellschaftlich
Mächtiger und damit die Grundbedingung menschlicher Freiheit zu wahren,
erfordert ein ständiges Ringen um die nötige Neutralität. In Sternstunden
staatlicher Tätigkeit des 19.Jahrhunderts soll dieses Ideal der Legende
nach fast verwirklicht worden sein. Es war die hohe Zeit bürgerlichen Selbstbewußtseins
unter dem Dach monarchischer Staatsauffassung. Der Staat hatte seine sinnfällige
Verkörperung im Königtum gefunden, und die Gesellschaft die ihre im Parlament.
Die Regierung des Königs war an die Gesetze gebunden, die sich die Gesellschaft
frei gegeben hatte; so die Idee. Die gewaltenteilende Verfassung hatte die
regierende Staatsbefugnis dem König zugewiesen und die gesetzgebende der im
Parlament repräsentierten Gesellschaft.
Beide, Staat und Gesellschaft bzw. König und Parlament bzw.
Exekutive und Legislative blieben einander funktional zugeordnet und daher
zur Kooperation verurteilt. Eine einseitige Dominanz der einen oder der
anderen Kraft wurde zwar nicht zielgerichtet durch einen weisen Verfassungsgesetzgeber
vermieden, konnte sich aber faktisch nicht einstellen, weil beide Gewalten
ein Machtgleichgewicht bildeten. Freilich hätte jede Gewalt gern die andere
dominiert, wie beim preußischen Verfassungskonflikt deutlich wurde. Aber
erst 1918 kam der entscheidende Wendepunkt, der Sündenfall der deutschen
Verfassungsgeschichte: Am 28.Oktober trat ein Reichsgesetz auf Druck der im
Parlament versammelten Parteienvertreter in Kraft, durch das Reichskanzler
und -regierung ihrer Verantwortung gegenüber dem Souverän enthoben und dem
Parlament unterworfen wurden. Bis heute sind Kanzler und Regierung ihm entzogen
und unterstehen der jederzeitigen Disposition der jeweiligen innergesellschaftlichen
Majorität bzw. sind mit deren Parteivorsitzendem identisch.
Parteien und Gruppen haben mit dem Staat als neutraler Macht
der Natur ihres Anliegens nach nichts im Sinn und trachten nur danach, ihn
von innen zu erobern. Einer Partei gelang das 1933, und ihr Führer konnte
seine Partei zur Herrin über den Staat erklären. Der einzelne galt nichts
mehr, noch dazu, wenn er der Staatspartei nicht angehörte, und die als
Partei formierte Gesellschaft verkörperte sich in dem von ihr gestalteten
Parteistaat. Für das SED-System gilt mutatis mutandis dasselbe: Es gab zwar
noch eine funktionale Aufteilung der Staatsgewalt auf besondere Organe der
Rechtsprechung, der Gesetzgebung und der Verwaltung. Über allen stand jedoch
der Wille der Partei bzw. ihres Führers oder Politbüros. Die Gesellschaft
hatte sich totalitär formiert, und einen ihr neutral gegenüberstehenden
Staat gab es nicht mehr.
Heute ist es nicht, wie im 3. Reich und in der DDR, eine
totalitäre Einheitspartei, die den Staat unter ihre Fuchtel gebracht hat.
Heute ist dasselbe durch ein Kartell liberaler Parteien geschehen, die
einander zum Verwechseln ähnlich sehen und konzeptionell übereinstimmen.
Die Strategie ihrer Mentoren war seit Beginn der Bundesrepublik vorgezeichnet
und fand ihren juristischen Niederschlag im Bonner Grundgesetz. Der Staat
wurde 1949 mit dem GG nicht aus allen Parteifesseln befreit, sondern es
wurden nur die einen Bande durch andere ersetzt. Der perfekte Liberalismus
des Bonner Grundgesetzes ermöglichte die vollständige Eroberung des
Staates durch die Gesellschaft in Gestalt der sich formierenden Bonner Parteien.
Die Pluralisierung durch Parteienvielfalt war nur vordergründig und
kurzlebig. Sie hat die latente Wendung zum Totalen "nicht aufgehoben,
sondern nur sozusagen parzelliert, indem jeder organisierte soziale Machtkomplex
soviel wie möglich - vom Gesangverein und Sportklub bis zum bewaffneten
Selbstschutz - die Totalität in sich selbst und für sich selbst zu
verwirklichen sucht."
Wenn aber eine Partei den Staat usurpiert, zerstört sie die
Grundlage seiner Machtlegitimation: Die über alle Staatsangehörigen ausgeübte
Staatsgewalt findet ihre innere Rechtfertigung nämlich darin, daß dieser
Staat tatsächlich allen Bürgern Schutz und Rechtsfrieden nach innen und
außen gewährleistet. Identifiziert sich aber eine Teilgruppe oder Partei
einseitig mit dem Staat und erobert seine Schaltstellen, so grenzt sie damit
die anderen Gruppen oder Minderheiten aus und definiert sie als nicht zum
Staat gehörende Feinde: als Ketzer oder Staatsfeinde, als Volksschädlinge,
Klassen- oder Verfassungsfeinde. So steht dann eine parteigelenkte Polizei
mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen dabei, wenn randalierende Politgewalttäter
den Parteitag einer der Regierung unbequemen Oppositionspartei zusammenprügeln.
Noch einfacher ist es für die Regierungspartei, auf die bloße Drohung gewalttätiger
Banden hin die Veranstaltung einer Oppositionspartei polizeilich als
"Risiko für die öffentliche Sicherheit" zu verbieten.
Die von Carl Schmitt schon in der Weimarer Zeit gesehene
Gefahr einer Wendung zum totalen Staat spitzt sich ständig zu. 1954 schrieb
Martini weitsichtig: "Diese Gefahr ist um so größer, je mehr sich unter
dem Eindruck sozialer Krisen der consensus verdünnt, so daß sich die Parteien
in zunehmendem Maße mit der Nation, mit der 'volonté générale' identifizieren,
die Gegenparteien also damit als nationalen Feind diskriminieren."
Der Staat kann seine ordnungsstiftende und
befriedende Funktion nur ausfüllen, wenn er tatsächlich neutral und
nicht von Parteigängern von innen heraus erobert ist. "Wo ein Teil
der Bürger in einem Teil der anderen aus welchen Gründen auch immer nicht
'Rechtsgenossen', sondern Feinde erblickt," erkennt der Rechtsphilosoph Braun, "an deren loyaler Gesinnung
man zweifeln muß, dient das Recht in der Sicht der beiden Kontrahenten
weniger dem Schutz der eigenen Person; es schützt und erhält vielmehr zunächst
den 'Feind' und verdient daher selbst bekämpft zu werden.
...
Es erscheint nunmehr
als Schutzschild und Waffe des jeweiligen Gegners." In Händen der
Partei, die an den Schalthebeln des Staats sitzt, wird es dann zwar bewußt
mißbraucht, aber moralisch hoch erhobenen Hauptes; und die andere Seite
wird bald einem Recht die Loyalität verweigern, das zu offenkundig nur als
Kampfinstrument zu ihrer Niederhaltung eingesetzt wird - und sie wird ihre
eigene Moral behaupten. Die formelle Akzeptanz des Rechts setzt nämlich voraus,
daß alle Normadressaten den uneingeschränkten Schutz der anderen auch
wirklich wollen.
Genau das meinte Rousseau,
wenn er schrieb: "Es ist
unmöglich, mit Leuten, die man für verdammt hält, in Frieden zu
leben." "Der eigentliche 'Feind' ist daher
nicht der Kriminelle, der einzelne Regeln bricht, das System als solches
aber akzeptiert, sondern der Ketzer und Revolutionär, der untergeordnete
Regeln durchaus unangetastet läßt, jedoch das soziale System in seinem
Zentralpunkt angreift, indem er seine Sinnhaftigkeit anzweifelt."
Die Entwicklung der vergangenen Jahre brachte den Bürgern in
Deutschland daher kein Mehr an Freiheit, als Liberale den Staat zunehmend
demontierten.
"In dem Maß, wie das Individuum sich gegen
den Staat ausspielen ließ, [...] geriet es unter die Herrschaft der Verbände,
die seinen Spielraum sehr viel enger zogen, und zerfiel vor dem Druck eines
neuen Verbandskollektivismus, dem es sich fügte, weil der einzelne Mensch in
der Gesellschaft nicht ohne Schutz existieren kann."
So näherte sich unsere Verfassungswirklichkeit
wieder ihrem mittelalterlichen Ausgangspunkt an und wurde von Scheuch treffend
als feudales Postenverteilungssystem bezeichnet. Die alten Gegner des
neutralisierenden Staates sind als "gesellschaftliche" Machtgruppen
wie Parteien und Verbände wieder auf den Plan getreten und haben sich auf dem
Wege über das Parlament aller Staatsgewalten bemächtigt.
Der nur vom Staat als überparteilicher Kraft zu garantierende
Schutz der Privatsphäre und der Freiheitsrechte wurde so dem "freien"
Kräftespiel unsichtbarer gesellschaftlicher Mächte ausgeliefert, die vom
einzelnen wohl Gehorsam fordern, ihn aber nur bedingt schützen können und
wollen. So wurde aus dem Dualismus von Staat und staatsfreier Gesellschaft
ein sozialer Pluralismus, dessen jeweils bestorganisierte und stärkste
Formationen mühelose Triumphe über die nicht Organisierten und Schwachen
feiern können.
Kapitalstarke und wohlorganisierte Interessengruppen
wurden zu Nutznießern dessen, was der Liberale unter Freiheit versteht: der Freiheit nämlich, ohne sittliche Schranken
und ohne Beachtung des Wohles Aller die Armen und Schwachen durch die Macht
rein ökonomischer Gesetze zu beherrschen. Alle vom Staate behüteten sittlichen
Schranken suchen sie niederzureißen und den Einzelnen zu
"emanzipieren", loszulösen von allen ihn schützenden Bindungen an
das Ganze, damit er umso leichter zur Beute des Partikularen werden kann.
Deutschland leidet unter dem nachhaltigen Einfluß der Normen des Managertums
der Privatindustrie auf die Parteifunktionäre. Es stellt sich bereits die
Frage, ob die Parteien von einem zahlenmäßig kleinen, aber äußerst finanzstarken
Teil der Gesellschaft kolonialisiert werden, von Kapitaleignern und Managern
nämlich und von deren Verbänden.
Aber nicht nur ökonomische und sozialpolitische Gründe erfordern
die Trennung von Staat und Gesellschaft. Diese neuzeitliche Trennung hatte
nicht zuletzt den für unkonventionelle Geister angenehmen Nebeneffekt,
daß zunehmend gesagt und gedruckt werden durfte, was immer man dachte. Jeder
konnte nach seiner Façon selig werden. Erst bei der staatsfeindlichen Handlung
wurde der säkularisierte Staat repressiv. Diese Freiheit des Denkens geriet
im 20. Jahrhundert zunehmend in Gefahr. Unser Jahrhundert bietet rückblickend
das Schauspiel des Aufstiegs und Zerfalls zweier ideologischer Großsysteme,
die in ihrem totalitären Anspruch in nichts hinter historischen Formen fanatischen
Christentums und seinen Ketzerverfolgungen zurückblieben. Die Jahrzehnte
des geistigen und blutigen Weltbürgerkriegs der Großideologien haben auch
bei ihrem politischen Gegner Spuren hinterlassen: dem Liberalismus als
siegreichem Erben des linken und des rechten sozialistischen Totalitarismus.
Mit dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts, seinem bürgerlich-kapitalistischen
sozialpolitischen Ursprung und seiner Beschränkung auf das Einfordern
staatsfreier Räume und bürgerlicher Freiheiten hat der heute herrschende
Linksliberalismus nur noch die historischen Wurzeln gemein.
Der historische Altliberalismus hatte gegen den historischen
Konservativismus größten Wert auf die Trennung von Staat und Gesellschaft
gelegt, um dem bürgerlichen Individualismus einen Freiheitsraum zu
öffnen. Wo hingegen Staat und Gesellschaft eins sind, kann sich niemand der
Einheit von Privatem und Öffentlichem und damit von Legalität und Moralität
entziehen. Unmoral wird dann strafbar. Im mittelalterlichen christlich-universalistischen
Feudalismus hatte das die Konsequenz, daß jeder Verstoß gegen die christlichen
Dogmen selbst dann auf dem Scheiterhaufen enden konnte, wenn der Ketzer im
übrigen gesetzestreu war. Ketzer, wußte 1646 Nicolas de Vernuls,
darf man im Staate auch dann
nicht dulden, wenn sie friedlich seien, denn Menschen wie Ketzer könnten gar
nicht friedlich sein. Später setzte sich die alleinige Staatsräson
mit ihrer Trennung von der privaten Moral durch und erlaubte ein
ungekanntes Maß an Geistesfreiheit.
In unserem Jahrhundert hat die Gesellschaft den Staat
zurückerobert. Gewechselt haben gegenüber dem Mittelalter nur die Ideologeme.
Jetzt gab es wieder den Gedankenverbrecher
,
das ist zur Zeit der Ausländerfeind, der ewige Nazi, der Erzfeind alles Liberalen.
Die gesellschaftliche Zensur ist strenger als die staatliche und arbeitet
mit Tabus. "Die Probe auf die Pressefreiheit ist, ob geistige Traditionen
und von nennenswerten Teilen der Bevölkerung getragene Positionen an
der Öffentlichkeit teilhaben können oder nicht. Ist das nicht der Fall,
kann man sicher sein, daß Zensur nicht nur ausgeübt wird, sondern sich bereits erfolgreich durchgesetzt
hat."
Ein Indikator dafür ist es beispielsweise,
wenn alle überregionalen Tages- und Wochenzeitungen von Focus und Spiegel bis
WELT und FAZ es ablehnten, eine Anzeige für die erste Auflage dieses Buches
abzudrucken. Die Mechanismen der gesellschaftlichen Selbstzensur sind zwar
nicht plump und direkt wie die staatlichen in der DDR waren, funktionieren
aber ebenso sicher. So seufzte Steffen Heitmann:
"Wir aus der DDR waren besonders auch
wegen der garantierten Meinungsfreiheit mit einer großen Hoffnung und -
wie sich jetzt zeigt - Illusion in die freiheitliche, demokratische Grundordnung
eingetreten. Ich mußte erleben, daß es bei drei Vierteln der Medien eine
Art von gut funktionierender Zensur gibt, die mit der in der DDR in gewisser
Weise vergleichbar ist. Nur geschieht sie heute in aller Öffentlichkeit,
durch Abstimmungen untereinander, durch indirekten Druck gegen Leute, die
aus dem Schema ausbrechen. Ich habe das selbst erlebt, als ein Sender mich
endlich einmal selbst zu Wort kommen ließ, anstatt immer nur aus dem Zusammenhang
gerissene Sätze zu zitieren. Die Empörung der anderen Sender in den folgenden
Programmkonferenzen war immens."
Die aktuelle Eroberung des Staates durch linksliberale
Repräsentanten der Gesellschaft bedeutet die höchste Alarmstufe für
den bürgerlichen Individualismus, seine Gedanken- und schließlich
seine Handlungsfreiheit: Im Deutschland des Jahres 1994 kann wieder mit
dem staatlichen Gesetz in Konflikt kommen, wer gegen die Moral des vergesellschafteten
Staates seine eigene Moral behauptet oder nur die Zumutung abwehrt, die
volkspädagogisch aufgestellten Tabu- und Genickschußzonen zu
achten. Wie ein Altlinker die Tabuwaffe gezielt zu führen weiß, schildert Schrenck-Notzing:
"Unbefangen schildert Adler,
wie er dann an der FU in
Berlin beim SDS lernte, die Waffe selbst zu verwenden: 'Ich konnte es
genießen, wenn ich sah, wie ganz normale liberale Leute in einer Diskussion
den Kürzeren zogen, wenn jemand das Wort faschistisch gebrauchte, evtl. verstärkt durch die Andeutung
der KZs mit entsprechendem Tabu-Gesichtsausdruck, drohend ernst, Stirn
in Falten, Augen ins Unendliche ... Wem dies noch zu abstrakt war, dem wurden
die Gaskammern vor Augen geführt, womit jeder sehen konnte, wohin das
führte, wenn man so dachte.' Das Wort Tabu-Gesichtsausdruck ist kein Zufall: Meinhard Adler ist in der Tat der Ansicht, daß es beim Bewältigungs-Ritus
um ein methodisches Aufrichten von Tabus
geht. Die 'angebliche Tabubefreiung in unserer Gesellschaft' ist für ihn
bloße Rhetorik: 'Es hat lediglich eine Tabugebietsverschiebung stattgefunden.
War es früher bei Ächtung verboten, die Kraft der Erektion und der Sinnlichkeit
öffentlich nachzuempfinden, so ist es heute bei gleicher Ächtung verboten,
die faszinative Kraft von Ordnung, Autorität und Kampf zu empfinden.' "
Der zunehmend zum totalitären Gesinnungsdruck übergehende
Linksliberalismus beurteilt den Menschen nicht mehr danach, was er tut,
sondern danach, was er denkt, sagt oder schreibt.
"Der Eifer unserer Gesinnungs-, Weltanschauungs-
und und Sektenbeauftragten, unserer Groß- und Kleininquisitoren und
Wächter über 'political correctness' ist zu einer ernsten Bedrohung
unserer Freiheit geworden."
Während die Gesetzesordnung so weitmaschig
und liberal gehandhabt wird, daß kein Verhalten mehr verboten werden kann, muß der Liberalismus sich als Ersatzlösung der Gesinnung seiner Bürger versichern
und fordert ihnen die Bereitschaft zur Identifikation ab. Das Verhalten
ist nur noch der formale Anknüpfungspunkt, um "verfassungsfreundliche
oder -feindliche" Gesinnung herauszufinden, auf die es ihm entscheidend
ankommt.
Die "neue Tendenz" geht zur
"staatlichen Weltanschauungskontrolle
...
. Die aufgeklärte
Weltanschauung,
...
beansprucht jetzt,
da sie mehrheitlich akzeptiert ist, den Alleinherrschaftsanspruch."
Totalitär wird der "aufgeklärte" Liberalismus zum
Beispiel, wo sich ein Lehrer nicht dem Erwartungsdruck moraleifriger Kollegen
oder Schüler entziehen kann, an der Spitze einer Lichterkette mitzumarschieren,
obwohl er das eigentlich gar nicht möchte, und wo die so demonstrierte
höhere Moral zur Bedingung beruflichen Fortkommens wird. Totalitär wird
er, wenn die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Potsdam am 3.5.1994
beschloß, einen Vermieter aufzufordern, den Mietvertrag mit einem rechten
Zeitungsverlag rechtswidrig aufzukündigen, dessen Tendenz den Parlamentariern
nicht paßte. Totalitär wird er auch, wo in staatlichen Massenmedien moralisch
erledigt wird, wer es wagt, zu bestimmten Fragen wie der Ausländerfrage
oder zu Wertungen der jüngeren Vergangenheit eine abweichende Meinung
zu äußern. Totalitär wird er erst recht, wo der Staat den mit Gefängnis
bestraft, der zu technischen Einzelfragen oder Zahlenangaben der
Zeitgeschichte etwas anderes sagt, als die staatlichen Gedenktafeln behaupten;
oder wo der Staat unter dem Einfluß gesellschaftlicher Moralvorstellungen
einem Gastwirt die Konzession entzieht, der Gäste bestimmter Nationalität
nicht einlassen will. Eine hysterische Betroffenheitstümelei fordert jedem
ein ständiges moralisches Glaubensbekenntnis ab, das leicht ebenso
zur Heuchelei wird wie jedes heruntergebetete Glaubensbekenntnis in irgendeinem
historischen Staat, der eine bestimmte Moral zur Staatsräson erhoben
hat. So werden heute jedem jene "peinigenden Exerzitien abverlangt,
...
der heute in
Deutschland von Amts wegen zu öffentlicher Rede verpflichtet ist."
"Schulmeisterhaft" wird dem Volk "von oben herab eingerieben
...
, was es zu denken
habe, welchen Gedanken es sich hingeben dürfe und welche es hintanzuhalten
habe."
Es ist kein Zufall, daß gegen die Trennung von Staat und
Gesellschaft gleichlautend alle diejenigen polemisieren, die das Individuum
ihrer Herrschaftsideologie als Staatsmoral unterwerfen wollen: Die konservativen
Feudalgrundherren des 19. Jahrhunderts, die ihre mittelalterlichen
Rechte von Gottes Gnaden über ihre Bauern gern wieder gehabt hätten; Karl
Marx, der in seiner Schrift Deutsche
Ideologie das einheitliche, von der Spaltung in eine gesellschaftliche
und eine staatliche Sphäre "freie" bürgerliche Subjekt forderte;
und unsere linksliberalen Moralvorbeter,
die ihre Anmaßung, Betroffenheit zu erzeugen, aus einer für den vergesellschafteten
Staat einheitlichen Humanitätsideologie ableiten, deren berufene
Interpreten und Inquisitoren sie selbst sind.
Nur im Lichte und im engeren Sinne der verfassungsrechtlichen
Vorgaben des Grundgesetzes betrachtet ist das derzeitige System gewaltenteilungslose
Parlamentsregierung: Der Bundestag ist das zentrale Machtzentrum: Er
macht die wesentlichen Gesetze, bestimmt zusammen mit dem Bundesrat die Verfassungsrichter,
die über die Auslegung seiner Gesetze wachen sollen, und er bildet mit der
Wahl eines von ihm jederzeit abhängigen Kanzlers eine Regierung, die wie ein
Ausschuß funktioniert und seiner völligen Kontrolle unterliegt. Im Zweifelsfall
hat der Bundestag die Kompetenz-Kompetenz, also das Recht, die Verfassung
zu ändern und die Grenzen seiner verfassungsmäßigen Macht selbst zu
bestimmen. Der Bundestag ist Zentrum und Machtträger des durch die Grundgesetzkonstruktion
gebildeten und verfassungsrechtlichen Normen gehorchenden Systems der parlamentarischen
Demokratie.
Dieses ist indessen nur das Untersystem eines übergeordneten
Ganzen, der Herrschaft der Parteiapparate: Wenn wir uns das System der
staatlichen Verfassungsorgane mit seinem Ineinandergreifen verschiedener
Gewalten als große Maschine vorstellen, sind die Parteien ihre Bediener.
Einschließlich ihrer hierarchischen Binnenstruktur sind die Parteien neben
dem Staat ein eigenständiges, autonomes Subsystem. Sie beherrschen den Staat
auf dem Wege über das Parlament.
Sie regeln ihre internen Regeln selbst, indem
sie nämlich durch ihre im Bundestag sitzenden Vertreter das Parteiengesetz und
in ihren Mitgliederversammlungen ihr Satzungsrecht schaffen. Die staatlichen
Amtsträger sind zugleich Parteifunktionäre und machen durch diese Personalunion
die Verbindung zwischen dem regierenden System der Parteien und dem gehorchenden Subsystem Staat sichtbar.
Den Parteienstaat dürfen wir daher als Gesamtsystem
begreifen, in dessen Innenleben mehrere aufeinander bezogene Subsysteme
existieren, von denen das eine dominiert und das andere funktioniert: Die
Parteien sind die handelnde Seele der Staatsmaschine; diese die Handpuppe
- jene der Puppenspieler!
Das Gesamtphänomen Parteienstaat besitzt außerdem weitere Subsysteme, die ihm teils eingeordnet sind und ihn
stützen, teils ihre Eigenständigkeit auf den Fortbestand des liberalen
Parteienstaats stützen. Zu ihnen zählen die weitgehend autonome Wirtschaft
als ökonomischer Hauptnutznießer sowie die Medien. Die Wirtschaft, die
Staatsbürokratie, die Medienwelt und die politischen Parteien sind jeweils
gesellschaftliche Untersysteme, die sich zueinander verhalten wie zwei
sich schneidende Kreise mit wechselnden Abhängigkeiten.
Entscheidender Faktor langfristiger Herrschaftssicherung
ist die Medienlandschaft, ohne deren Kontrolle eine stabile Herrschaft
nur möglich war, solange die Politik noch dem Gesetz des Kartätschenprinzen
und nachmaligen Kaisers Wilhelm I.
gehorchte: "Gegen Demokraten helfen
nur Soldaten." Jeder Herrscher regelt die Regeln so, daß er weiterhin
herrscht. Die selbstgesetzten Regeln des Parlamentarismus schließen
Kartätschen als Mittel der Herrschaft grundsätzlich aus und führen im
Zeitalter der Massenkommunikation dahin, daß Legitimation und Wiederwahl
nur in einem permanenten Rückkopplungsprozeß mit einem als
"öffentliche Meinung" verstandenen Medienwesen gewährleistet
sind. Das Subsystem des Parteiensystems ist also in ein gesellschaftliches
Obersystem eingebettet, in dem mutmaßlich die politische Macht gewinnt, wer
sich den Wählern publikumswirksam verkaufen kann. Die Abhängigkeit zwischen
Parteien und Medien ist wechselseitig, weil Parteien sich ohne Medienkontrolle
nicht darstellen können und daher medienabhängig sind. Das liberale Medienwesen
seinerseits hängt von den ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen des
Parteienstaates ab.
"Das Zeitalter des demokratischen Absolutismus ist
vollendet. Wird er nicht abgelöst, so droht dem deutschen Volke die Zukunft
der demokratischen Inquisition." Als Edgar Julius Jung
das 1930 zu Papier brachte,
meinte mit demokratischem Absolutismus,
was hier deshalb als Parlamentsabsolutismus bezeichnet wird, um der heillosen Begriffsverwirrung um das Wort Demokratie zu entgehen. Dieser ist
die politische Form des Nichtstaates, die Gestalt gewordene "absolute Gesellschaft". Diese
unterminierte in nicht vorgesehenem Umfange die Verfassungsordnung der
BRD, welche hier nur korrekt als freiheitliche
demokratische Grundordnung bezeichnet wird und staatsrechtlich eine
parlamentarischen Republik ist. Der Vergleich zwischen den Ansprüchen der
Grundgesetztheorie und der Verfassungswirklichkeit fällt für den Bonner
Parlamentarismus verheerend aus. Das als ausgewogen konzipierte
Konzept des Grundgesetzes ist von den Parteien als Großmächten der absoluten
Gesellschaft in einem Ausmaße verfremdet worden, welches die Verfassungswirklichkeit
insgesamt verfassungswidrig erscheinen läßt. Eine ganze Reihe der Idee
der Verfassung nach unverzichtbarer Verfassungsprinzipien ist
durch ihre nicht vorgesehene Übermacht wirkungslos geworden.
Die FdGO wurde vom
Bundesverfassungsgericht aus dem Grundgesetztext abgeleitet und in ihren
Einzelmerkmalen rechtsverbindlich definiert als eine "Ordnung, die
unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach
dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt.
Zu ihren Grundprinzipien sind mindestens zu rechnen die Achtung vor den Menschenrechten,
die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der
Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der
Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit der Parteien
mit dem Recht auf ungehinderte Ausübung der Opposition." Diese Grundordnung funktioniert in Kernbereichen
nicht mehr. Warum es im parlamentarischen Parteienstaat keine Gewaltenteilung
im eigentlichen Sinn gibt, wurde oben schon dargestellt. Auch mit anderen
Wesensmerkmalen dieser Ordnung sieht es heute schlecht aus:
Aus Art.20 I GG leitet das BVerfG das Demokratieprinzip her:
Der politische Willensbildungsprozeß muß sich vom Volk hin zu den
Staatsorganen vollziehen und nicht umgekehrt. Den Staatsorganen ist
grundsätzlich jede Einflußnahme auf den Prozeß des Volkswillens verwehrt. Die Großparteien mißbrauchen dagegen
ständig die staatlichen Finanzen und Ressourcen, beeinflussen dadurch den
Volkswillen von oben nach unten und verstoßen damit gegen das Demokratieprinzip.
Diesen Mißbrauch ermöglichen sie sich "legal" durch auf ihre Bedürfnisse
zurechtgeschneiderte Gesetze wie die Rundfunkgesetze und das Parteiengesetz.
Staatliche Parteienfinanzierung hatte das
Bundesverfassungsgericht bis zum Erlaß des Urteils vom 9.4.1992 für unzulässig erklärt, weil sie den Parteien
mit Staatsmitteln die Macht zur Beeinflussung des Volkswillens gibt. Nur
als Ausnahme hatte es eine reine Wahlkampfkostenerstattung aus Steuergeldern
erlaubt, denn im Wahlkampf um die Staatsorgane nähmen die Parteien eine
staatliche Aufgabe wahr. Die Erstattung von Kosten absurd
aufwendiger Wahlkämpfe
im Waschmittelreklame-Stil hat aber mit den
notwendigen Kosten eines angemessenen Wahlkampfs nichts mehr zu tun. Tatsächlich
besteht seit Jahren faktisch der durch das Urteil des BVerfG vom 9.4.1992
sanktionierte Zustand der überwiegenden staatlichen Dauerfinanzierung professioneller
Parteiapparate durch den Staat.
Diese ermöglicht den Staatsparteien im
Zeitalter der Medien- und Stimmungsdemokratie eine umfassende und beständige
Meinungskontrolle und -lenkung der Wahlbevölkerung. Die Parteien sind
Dauerkunden bei demoskopischen Instituten, professionellen Werbebüros und
Hochglanz-Druckereien.
Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht sogar die
direkte Finanzierung der Parteien auf Staatskosten für zulässig erklärt. Der Bundestag hatte daraufhin nichts Eiligeres
zu tun, als sich 1993 ein renoviertes Parteiengesetz zuzulegen. "Erst
mal einsacken" betitelte der SPIEGEL süffisant den jüngsten Coup der
Bonner Parteischatzmeister. Von selbst hatten die Bundestagsparteien noch
nie besondere Eile an den Tag gelegt, den Umfang ihrer Finanzierung aus
Steuergeldern gesetzlich zu begrenzen. Erst eine Folge von Verfassungsgerichtsurteilen
hatte erzwungen, daß die von den Abgeordneten
zugunsten ihrer Parteien in den Haushalt aufgenommenen Haushaltsmittel
überhaupt gesetzlich geregelt werden mußten. Seitdem handelten die Parteien
nach der Devise: "Wir nehmen, was wir kriegen!" So gibt auch die
amtliche Begründung der Gesetzesvorlage vom 28.9.93 treuherzig zu, die
vom BVerfG nunmehr gesetzte "absolute Obergrenze" der "vorgesehenen
staatlichen Zuschüsse" werde "ausgeschöpft". Man läßt nichts
anbrennen in Bonn.
Der gesetzgeberische Spielraum des Parlaments hatte sich
indessen auf das Suchen von Schlupflöchern beschränkt: Einen Großteil der
Neuregelungen mußte die Gesetzesvorlage wörtlich oder der Sache nach vom
Verfassungsgerichtsurteil vom 9. April 1992 abschreiben. Das Risiko,
von dem vom Gericht Vorgeschriebenen abzuweichen und wieder aufgehoben zu
werden, erschien den Parteien zu groß. Immerhin sieht das Grundgesetz überhaupt
keine Staatsfinanzierung von Parteien vor und gibt daher keine Vorgaben.
So fühlten sich die Karlsruher Richter bemüßigt, das Schweigen der Verfassung
als Regelungslücke aufzufassen und sich wieder einmal als "richterliche
Ersatzgesetzgeber" in Sachen ihrer Entsendeparteien aufzuspielen.
Für die Fraktionen und Parteistiftungen rieseln die
Dukaten jetzt nicht nur munter weiter aus dem Steuersack - der Pegel
steigt! Noch sind die Parteien durch nichts gehindert, weitere Millionenbeträge
ohne förmliches Gesetz einzustreichen und die vom BVerfG gesetzte
"absolute Obergrenze" zu umgehen. Sie verstecken nämlich Personalkosten
wie die Gehälter von Abgeordnetenmitarbeitern pauschal in Haushaltsplänen
und -gesetzen.
Da sie sich in eigener Sache meist einig
sind und der Verwendungszweck in Haushaltstiteln für Außenstehende
nicht leicht erkennbar ist, geschieht das diskret und ohne öffentliches
Aufsehen - schließlich ist ein Mitarbeiter kein Dienstwagen.
Während die direkten Fraktionszuschüsse der Bonner
Parlamentarier mit 98,917 Mio.DM für 1994 unverändert blieben und bei der Parteienfinanzierung
formell nicht mitzählen - oder sind Fraktionen etwa Parteien? - dürfen
auch die einzelnen Abgeordneten künftig legal Werbebroschüren auf Kosten
der Staatskasse herausgeben. Gleichzeitig mit der Neuregelung des
Parteiengesetzes und dem formalen Einfrieren ihrer Staatsfinanzierung
änderten die Parteien nämlich das Fraktionsgesetz. Wie beim Pegelstand
eines Systems kommunizierender Röhren legen sie hier zu, was sie sich dort
an Zuwächsen verkneifen müssen.
Wo offen von Parteien gedruckte Wahlreklame nicht mehr verfängt,
tarnen die Parteien, wenn sie gerade an der Regierung sind, ihre Werbung
gern als "staatliche Öffentlichkeitsarbeit." Wir finden die
Reklame für ihre Positionen dann unter "Der Minister für xyz informiert"
oder ähnlich neutral klingenden Namen im Briefkasten. Die in solcher quasi
amtlicher Form versteckte Parteiarbeit besitzt einen scheinbaren Bonus an
Objektivität und Glaubwürdigkeit.
Dies hatte bis zum Urteil vom 9.4.1992 auch
das Bundesverfassungsgericht als propagandistisches Mittel der jeweiligen
Regierung zur Machterhaltung durchschaut. Es wollte verhindern, daß
Parteipropaganda im Regierungsgewand die Mechanismen demokratischer Willensbildung
außer Kraft setzt und einen Machtwechsel verhindert: "Die Öffentlichkeitsarbeit
darf nicht durch Einsatz öffentlicher Mittel den Mehrheitsparteien zu Hilfe
kommen oder die Oppositionsparteien bekämpfen. Dies wäre mit den Grundsätzen
eines freien und offenen Prozesse der Meinungs- und Willensbildung des
Volkes und der Gleichberechtigung der politischen Parteien nicht
vereinbar." Tatsächlich ist die Staatsfinanzierung heute
der Hauptfaktor ihres Machterhalts. Da die 5%-Klausel ihren Dienst nur noch
ungenügend leistet, soll die kraß ungleiche Ausstattung mit Finanzmitteln
das erwünschte Ergebnis bringen.
Spätestens hier muß der Medienbereich ins Blickfeld rücken.
Er bildet als Instrument der Herrschaftstechnik einen Eckpfeiler der Parteienmacht.
Schon quantitativ stellt er alle Möglichkeiten weit in den Schatten, durch
gedruckte Wurfsendungen Parteireklame zu machen. Einen "gewaltigen Hebel
zur Eroberung, Wahrung und Kräftigung der Herrschaft über die Massen"
nannte Michels
bereits 1911 die Presse, als das noch suggestivere Fernsehen und die
Kunst ideologischer Agitation noch nicht einmal erfunden waren. "Die
Verfassung und der Gesetzgeber haben" die Medien "im Interesse
der Durchschaubarkeit staatlicher Machtausübung mit nahezu unbegrenzten
Rechten ausgestattet."
Nach Untersuchungen leiten 30% der Wahlberechtigten
ihre politische Meinung direkt aus dem Fernsehen ab. "Eine kontinuierliche
Beeinflussung der politischen Meinungsbildung über Jahre hinweg kann die
Wahlchancen der Regierungsmehrheit gegenüber den Oppositionsparteien
durchaus merklich verbessern"
Das überläßt die "politische
Klasse" nicht dem Zufall, sondern "versucht ihrerseits in schon
fast totalitärer Absicht, mit allen Techniken der Massenkommunikation in
alle Bereiche des gesellschaftlichen und privaten Lebens einzudringen, um
sich in umfassender Weise unserer Einstellungen und Gefühle zu bemächtigen."
Vor der Frage: 'Wer regiert?' liegt nämlich die Frage: 'Wer
bestimmt, wer regiert?', "und das macht, daß die allerwichtigste Frage
lauten muß: 'Wer beherrscht den, der bestimmt, wer regiert?' Mit anderen
Worten: Wer beherrscht den Volkssouverän, der ein 'Klima' erschafft oder
erleidet, das sich in Willensbildung umsetzt, die vage Vorstellungen, Gefühle,
Stimmungen zu Handlungen und Haltungen werden läßt? Wer beherrscht den
Herrscher 'Volk' - und wie wird solche Herrschaft bewerkstelligt?"
Das weiß das Bonner Establishment und
befaßt sich nicht mehr hauptsächlich mit Sachproblemen des Volkes, sondern
vor allem mit "Public Relations": Sein Ansehensverlust ist ihm
allenfalls ein Kommunikationsproblem, und darum sind ihm die Medien so
wichtig wie einem antiken Despoten seine Palastwache. Überall steht die
Mediokratie unter Kontrolle linksliberaler Seilschaften.
Bis zu 50% der ARD- und ZDF-Mitarbeiter sind parteigebunden.
Sie werden fest an die Kandare genommen: "Als der Bonner Studioleiter
des ZDF, Wolfgang Herles, vor dem Bremer Parteitag der CDU Helmut Kohl
kritisierte, wurde ihm vom
'Freundeskreis der Union' beim ZDF 'Undankbarkeit' (sic!) angekreidet.
Herles,
der sich selbst als 'strikten
Gegner jeder Hofberichterstattung' bezeichnet, mußte auf Druck Kohls am
1.11.1991 seinen Sessel als Studioleiter räumen." Ähnliche Fälle sind aus dem Bereich der
"unabhängigen" überregionalen Presse bekanntgeworden, wo z.B.
ein Anruf des Bundeskanzlers bei einem Zeitungsherausgeber genügt
haben soll, einem kritischen Redakteur
einen schon zugesagten Aufstieg zu verbauen.
Direkte Zensur durch die Parteien hat der Parteienstaat
ebensowenig nötig, wie die SED ihrem bewährten Karl-Eduard von Schnitzler
nicht ins Handwerk pfuschen mußte. Durch strenge Personalauswahl und
Parteiproporz wird überall dafür gesorgt, daß "dankbare" Parteiaktivisten
in vorderster Linie für die Belange ihrer Partei eintreten. Zensur braucht
man dann nicht mehr. So wird die "demokratische Willensbildung von unten
nach oben" tagtäglich zur Farce, wenn hochbezahlte und daher
"dankbare" Moderatoren die Nachrichtenauswahl treffen, kunstvoll
Betroffenheiten zelebrieren und Agitation und Propaganda auf so
versteckt-suggestivem Niveau treiben, daß selbst ein Goebbels fachliche Anerkennung
hätte zollen müssen. Vom Intendanten bis zum Redakteur hat der Parteienstaat
die Medien im Griff, deren Angehörige in vorauseilendem Gehorsam die Parteien
und ihr System belobhudeln: Die Stimme seines Herrn! Häufig schreckt das
Fernsehen noch nicht einmal vor plumper und direkter Meinungsmache wie in
George Orwells
"1984" durch den
Großen Bruder zurück wie 1992 bei der staatlichen Pro-Ausländer-Kampagne.
Staatliche Wurfsendungen mit volkspädagogisch Erwünschtem vervollständigen
das Bild lückenloser ideologischer Erfassung aller Haushalte. "Den
Staatsparteien des Parteienstaates ist daran gelegen, in uns das ihrem
Interesse gemäß 'richtige' Gesellschaftsbild zu verankern, und sie haben die
Mittel dazu."
Im Endeffekt
befindet sich die Mehrheit der Bürger, von denen nach demokratischer Lehre
doch die politische Willensbildung ausgehen sollte, fest in Händen staatlich
finanzierter, professioneller Parteiapparate und ist "umgeben von
Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem." Sie üben eine so umfassende Informationsauswahl
und Meinungssteuerung aus, daß sie jede abweichende inhaltliche Position
marginalisieren und jede auch nur personelle Konkurrenz ins Abseits
drängen können, das heißt in die Schmuddelecke für "Radikale". Bedeutet
schon die selektive Auswahl der Tatsachen und Meldungen nach Maßstab der
volkspädagogisch jeweils Erwünschten eine Steuerung, so nicht minder ihre
Zubereitung, Darbietung nach Form, Ausdrucksweise, Sprachregelung
im Auslassen, Anmerken und Akzentuieren. So
beruhen gleichschaltende Sprachregelungen in fast allen Medien nicht auf
Zufall, die offen nationalsozialistische Kleinstgrüppchen etwa mit
"rechtsgerichtet" apostrophieren, demokratische Rechtsparteien
aber mit "rechtsextremistisch". Peter Kroll
berichtet von einem
"altgedienten Korrespondenten, der noch während des Dritten Reiches
für damalige bürgerliche Zeitungen im Ausland tätig war", und dazu
bitter meinte: So wie es damals eine 'Sprachregelung' des Propagandaministeriums
gegeben habe, existiere heute eine seltsame Sprachregelung in den
elektronischen Medien, dem Spiegel,
dem Stern" usw. Die tägliche Desinformation wird zum Ärgernis.
Man kann heute das geistige, politische
religiöse und moralische Klima eines Landes vom grünen Tisch aus planen und
danach fabrizieren.
"Staatliche" Öffentlichkeitsarbeit regierender
Parteien beeinträchtigt langfristig die Chancengleichheit der Parteien
und damit die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Durch den Mißbrauch dieser Herrschaftstechniken
ist heute ein Zustand erreicht, der dem Demokratieprinzip im Sinne des
BVerfG direkt zuwiderläuft und die Legitimität des Systems im Kern
trifft. Einst durfte man in Deutschland nicht wagen, frei zu denken. Heute darf man es. Gesamtschulgeschädigt
und selektiv informiert kann der
moderne Deutsche es aber nicht mehr. Er vermag nur noch das zu denken, was er
nach Ansicht unserer Medienzaren und volkspädagogischen Erzieher wollen
soll, und eben das hält er nach einem Wort Oswald Spenglers
für seine Freiheit.
In diesen Zusammenhang gehört die Dialektik von Parteiendemokratie
als Soll- und Parteienstaatlichkeit als Istzustand. Die von staatlicher
Dauerfinanzierung abhängig gewordenen Parteien haben den Staat von
innen durchdrungen und usurpiert, um diese Abhängigkeit umzukehren.
Bildlich gesprochen gründen sie mit ihren Wurzeln in der Gesellschaft,
üben aber mit ihren Wipfeln schon die Funktion von Verfassungsorganen aus.
Durch hohe Ämterkombination zwischen
Partei- und Parlamentsamt und Regierungs- und Verwaltungsamt haben sie gewissermaßen neben das innere Gerüst
staatlicher Strukturen wie eine Schlingpflanze ein personell identisches
zweites Gerüst gesetzt und sich auf diese Weise direkten Zugriff auf alle
staatlichen Funktionen gesichert. So sind staatliche Amtsträger zugleich
Parteifunktionäre und haben damit zwei Seelen, zwei widerstreitende Loyalitäten
in ihrer Brust. Solange die Partei regiert, die sie auf den Posten protegiert
hat, dienen sie dazu, "möglichst viel aus ihrem Programm in der Verwaltung
durchzusetzen."
Sie fungieren als direktes Instrument der
Einflußnahme von Parteiinteressen auf den Staat, in dessen Namen sie
doch das Gemeinwohl fördern sollten, nach dem alten Spruch, recht und billig
sei zuvörderst das, was mir und meinen Vettern nützt.
Wechselt die Regierung, bleiben sie gleichwohl als unkündbare
Altlasten in der Regierungs- oder Verwaltungsbürokratie plaziert, nunmehr
als Hemmschuhe gegen den ebenso gierigen Zugriff der neuen Regierungspartei.
Was diese an Zielvorstellungen durchsetzen will, suchen die Rückstände der
abgewählten Partei nach Kräften zu durchkreuzen. Bei höheren Beamten wie Generalstaatsanwälten
pflegen nach einem Regierungswechsel daher alsbald Entlassung und Einsetzung
eines anderen, parteifrommen Behördenleiters zu folgen, womit augenfällig
wird, daß der nominelle Anwalt des Staats in Wahrheit als Anwalt der Regierungspartei
mißbraucht wird.
Ebenso hat das Parlament seine Bestimmung völlig eingebüßt,
das Volk zu repräsentieren. Es ist zu einer Stätte geworden, an der sich
Parteibeauftragte treffen und Entscheidungen registrieren, die Parteigremien
längst getroffen haben.
Die gesetzliche Fiktion des Art.38 GG, nach
dem der Abgeordnete nur seinem Gewissen verantwortlich sein soll, ist ein
nicht eingelöstes Dogma
und praktisch ins Gegenteil verkehrt. Keineswegs
wirft etwa der Parteipolitiker im Moment seiner Wahl sein Wolfsfell ab und
mutiert plötzlich zu einem friedlichen Schaf, das die Parlamentswiese abgrast,
auf der Suche nach der blauen Blume des Gemeinwohls.
Die tatsächlichen Parteien entsenden die
real existierenden Abgeordneten über Listen als ihre Vertreter in die Parlamente,
nicht als Abgeordnete des Volkes, und dementsprechend verlangen sie von
ihnen Gehorsam in Form des üblichen Fraktionszwangs. Wer ausschert, riskiert
seine Wiederaufstellung und damit seine Existenz als parteiabhängiger Berufspolitiker.
Die in Art.38 GG statuierte Fiktion von der Unabhängigkeit der Abgeordneten
hatte einmal Edmund Burke
in einer Rede verteidigt.
Es strafte aber schon damals das tatsächliche Verhalten der meisten gewählten
Volksvertreter den "hohen Idealismus Edmund Burkes Lügen. Selbst mancher
Zeitgenosse Burkes, der seine Rede hörte, muß innerlich gelacht haben, wenn
er an die völlige Unterwürfigkeit der meisten Parlamentsmitglieder
gegenüber den großen aristokratischen Grundbesitzern dachte, die nicht
einmal Weisungen auszugeben brauchten, so eifrig waren 'ihre' Abgeordneten
beflissen."
Das Verhältniswahlrecht mit seinem starren, nach Meinung
Hans Herbert von Arnims
verfassungswidrigen Listensystem ist das Hauptinstrument der Parteien,
ihre Abgeordneten in Abhängigkeit zu halten. So konnte Schmitt
schon 1932 spotten, die Abgeordneten
würden in fester Organisation und Disziplin marschieren, zum Teil sogar schon
uniformiert. Heute ist die textile Uniformierung verpönt,
die geistige Uniformität dagegen blieb.
Die Eroberung des Staats durch die Parteien als gesellschaftliche
Kampfverbände führte zur totalen Machtergreifung des Parteiensystems
und machte den Staat selbst weitgehend handlungsunfähig.
Besonders augenfällig wird sie wie eine
Machtergreifung auf einem feindlichen Hauptquartier, wenn man etwa beim
Niedersächsischen Umweltministerium anfragt, ob dieses eine
Initiative für Umweltschutz in der Landesverfassung plane: Man erhält als
Antwort den Entwurf der SPD-Landtagsfraktion übersandt. So ist die Eigenidentifikation
der Parteien mit dem Staat zur unreflektierten Selbstverständlichkeit
geworden.
Partei und Staat beginnen sich zu decken.
Wo die ihrer Natur nach parteiischen Parteien aber den Staat
erobert und seiner Neutralität beraubt und damit Gesellschaft und Staat
heillos miteinander verwoben haben, steht der Bürger statt einem gerechten,
weil äquidistanten Staat stets einer Parteiobrigkeit gegenüber. Die Parteipolitisierung
der Staatsverwaltung läßt ihm immer geringere Möglichkeiten einer privaten,
unpolitischen Existenz, die Mäßigung der Einflußnahme des Staats aufgrund seiner
Neutralität entfällt und mit ihr eine wesentliche Voraussetzung bürgerlicher
Freiheit.
Freiheit vom Staate gibt es im Parteienstaat
nur für diejenigen, die sich selbst des Staates bemächtigt und ihren Zwecken
dienstbar gemacht haben. So führen die Durchdringung und das Zurückdrängen
staatlicher und damit unparteiischer, gesellschaftlich neutraler Macht
durch Partei- und Verbändestrukturen tendenziell zur Auflösung des Staates,
ja zum totalitären Parteienstaat.
"Die Bonner Republik, immer auf der
Jagd nach totalitären Phänomenen, ist in ihrer letzten Phase selbst totalitär
geworden."
"Die andere Seite aber, die an und für sich
staatsfreudig eingestellt ist, wird wegen ihrer Abneigung gegen die heutige
Parteiendemokratie verfolgt. Die wenigen Bejaher von Staat und Republik
geraten so ins Hintertreffen und bilden eine mißachtete Minderheit. Wer
aber den heutigen Zustand von Gesellschaft und Staat nicht als der Weisheit
letzten Schluß ansieht, wird von den
...
Machthabern erbittert
bekämpft. Nach links Libertinage, nach rechts die Peitsche: das ist die 'Autorität'
der modernen deutschen Demokratie. Der zu Unrecht geschmähte Metternich
...
würde vor Neid erblassen,
beobachtete er die verfeinerten Methoden, mit denen der Liberalismus in
seine Spuren tritt."
Einen skurrilen Höhepunkt erreicht die Tendenz zum totalen
Parteienstaat, wenn seine Staatsparteien mit dem Ruf "Der Staat sind
wir!" jedes Konkurrieren mit ihrem Herrschaftsanspruch als
"staatsfeindlich" zu stigmatisieren suchen. Nur eine unausgesprochene
Selbsteinschätzung als Staatsparteien ermöglicht es, jeden Angriff einer
Konkurrenzpartei auf ihr Machtmonopol juristisch wie propagandistisch als
Angriff auf Staat und Verfassung umzudeuten. So pflegten parteiangehörige
"Verfassungsschützer" in jenen verwaltungsgerichtlichen Verfahren
einer Partei im Jahre 1993 gegen ihre nachrichtendienstliche Beobachtung
regelmäßig der Opposition als Beweis für ihre angebliche Verfassungsfeindlichkeit
anzukreiden, daß diese "die demokratischen Parteien" politisch
hart attackiere; woraus geschlossen werden müsse, daß die Partei den
demokratischen Verfassungsstaat bekämpfe.
Schon Proudhon
hatte beobachtet, daß die
Volksvertreter, sobald sie in den Besitz der Macht gelangt sind, sofort ihre
Macht stärken, ausbauen und ihre Stellung unaufhörlich mit neuen Schutzmaßregeln
zu umgeben suchen, um sich endlich von der populären Botmäßigkeit gänzlich
zu befreien. Theophrast
bemerkte, der größte Ehrgeiz
der die höchsten Stellen im Volksstaate einnehmenden Männer bestehe nicht
so sehr in der Sucht nach Gewinn und Bereicherung, als vielmehr darin, auf
Kosten der Souveränität des Volkes allmählich eine eigene zu gründen.
Jede einmal in den Besitz der Macht gelangte
Gruppe neigt dazu, diese festhalten zu wollen. Im Zeitalter der Demokratie
sprechen und kämpfen alle Faktoren des öffentlichen Lebens im Namen der
Gesamtheit. Alle Gruppen, welche die Macht festzuhalten suchen, berufen
sich zu ihrer Eigenlegitimation auf deren angebliches Wohl.
Jede Partei sucht sich des Staates zu bemächtigen
und sich für das Allgemeine auszugeben.
Vor allem, wenn sie als Abgeordnete in einer
demokratischen Legislative sitzen, bilden sie sich manchmal ein, sie selbst
seien das Volk.
Begrifflich bedeutet diese Identifizierung
von Regierung und Partei den reinen, nach dem BVerfG verfassungswidrigen Parteienstaat.
Im Gesetzgebungsstaat kanalisiert die Verfassung den Zugang
zur Macht: Sie fällt demjenigen zu, der sie gemacht hat und die Mittel besitzt,
verbindlich zu definieren, wie sie zu verstehen, und vor allem: wer ihre
Feinde sind.
So haben die Parteien mit dem Grundgesetz,
flankierenden Parteien- und Wahlgesetzen sowie der Judikatur des politischen:
des Bundesverfassungsgerichts, eine ihnen auf den Leib geschneiderte Herrschaftsordnung
errichtet. Herrschaft des Rechts, ihres Rechts, bedeutet aber nichts anderes
als die Legitimierung eines jeweiligen Status quo, an dem diejenigen
Parteien und Personen ein Interesse haben, welche die Rechtsnormen gesetzt
haben und deren Machtstellung sich in ihnen stabilisiert.
Alles Recht ist politisches Recht. "Seien Sie nicht
unpolitisch," erteilte "aus eigener Erfahrung" ein Richter am
BGH "einen freundlich-wohlwollenden Ratschlag", sondern passen
Sie sich dem Zeitgeist, das heißt dem Geist der Herren unserer Zeit, an;
...
Nehmen Sie sich ein
Beispiel an
...erg.: Roman Herzog
.
Er hat nicht nur ein feines
Empfinden, woher der politische Wind weht, sondern weiß auch, wer ihn macht.
Der Gleichheitssatz gebietet keine Gleichbehandlung aller
gesellschaftlichen Gruppen. Eine geläuterte Rechtsauffassung erkennt klare
Unterschiede, aus denen sachliche Differenzierungsgründe für eine
Ungleichbehandlung herzuleiten sind. Ist es etwa kein relevanter
Differenzierungsgrund, wenn man das Wählerpotential im Auge hat?
...
Im übrigen: Sie rücken
in die Nähe eines Verfassungsfeindes, wenn Sie Zweifel an den Differenzierungen
unserer obersten Rechtsverwalter vom Schloßplatz bei der Anwendung des
Gleichheitssatzes äußern. Alle Bürger sind gleich, aber einige sind gleicher
als die anderen. Wissen Sie nicht, daß Not kein Gebot kennt und wo gehobelt
wird, Späne fallen?"
So gibt das Bundesverfassungsgericht dem weltanschaulich
Wünschenswerten Flankendeckung, falls einmal ein Gesetz so ungenau formuliert
oder lückenhaft sein sollte, daß die Instanzgerichte zu unerwünschten
Urteilen gelangen: Die "richterlichen Ersatzgesetzgeber"
in Karlsruhe lesen notfalls auch ins Grundgesetz
hinein, was dort gar nicht steht: Die Legitimationsbasis des BVerfG dürfte
zwar allein das positive Verfassungsrecht sein. Gleichwohl mißbrauchen
sie das "Grundgesetz als 'verfassungsrechtliche Wundertüte', der sich
das 'Gute, Wahre und Schöne' - je nach Bedarf - entnehmen läßt. Jenseits
dessen, was sich als 'immer schon im GG enthalten' aufweisen läßt, betreibt
das Gericht Politik. Dafür hat es weder Mandat noch Legitimation. Zugegeben:
Bezüglich seiner Macht ist das BVerfG faktisch souverän. Aber diese Souveränität
ist gebunden an eine Normallage; fürchten muß das Gericht den Ausnahmefall:
Die zunehmende Verlagerung politischer Macht nach Karlsruhe kann sich
nämlich auf Dauer zu einer Akzeptanz- und Verfassungskrise auswachsen [...].
Und dann werden die Oligarchen von Karlsruhe in schlichten, gemeinverständlichen
Worten erklären müssen, mit welchem Recht sie der Verfassung Inhalte
entlocken, die vorher dort nicht zu finden waren. Wehe dem Gericht, es
kann die Elementarfrage nicht plausibel beantworten."
Seine Antwort könnte nur eine politische sein und enthüllen,
worum es eigentlich bei der Institution Bundesverfassungsgericht geht: Der verbale Formelkompromiß gehört zum
Wesen parlamentarischer Gesetzgebungstätigkeit. Wo politische Einmütigkeit
nicht erzeugt und für eine klare Lösung keine Mehrheit gefunden werden kann,
schiebt man gern die sachliche Entscheidung durch eine unklare Formulierung
hinaus und läßt so die politische Entscheidung offen. Hier ist es Aufgabe der
in das "Verfassungsgericht" entsandten Parteienvertreter, in
justizförmigem Gewand die eigentliche politische Entscheidung zu treffen.
"Hier Rechtsfragen von politischen Fragen zu trennen und anzunehmen,
eine staatsrechtliche Angelegenheit lasse sich entpolitisieren,
...
ist eine trübe
Fiktion."
Die umfassende Definitionsmacht der Bonner Parteien und
ihrer im Verfassungsgericht sitzenden Angehörigen über die Verfassungsnormen
birgt für Außenseiter die Gefahr, von Rechts wegen politisch entrechtet
werden zu können: Nach Art.18 GG "verwirkt" die Grundrechte, wer
sie zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung (FdGO)
"mißbraucht". Dementsprechend können Vereinigungen, die sich
gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten, nach Art.9, und Parteien,
die nach ihren tatsächlichen Zielen oder auch nur nach dem Verhalten ihrer Anhänger
(!) darauf ausgehen, die FdGO zu beeinträchtigen (!), nach Art.21 verboten
werden. Während diese Sanktionen gegenüber Einzelpersonen und Parteien
nur durch das BVerfG ausgesprochen werden können, genügt für ein Verbot
anderer Vereinigungen ein Verwaltungsakt, gegen den immerhin noch gerichtlicher
Schutz angerufen werden kann.
Hauptinstrument des Parteienkartells ist aber der Verfassungsschutz.
Als Schild und Schwert des Parteienstaates fällt ihm die Aufgabe zu, schon im
Vorfeld von Parteigründungen filternd zu wirken und vorsichtige Naturen wie
Beamte fernzuhalten ("Sie wissen doch, als Beamter kann ich mir das
nicht erlauben..."). Allein die Möglichkeit der nachrichtendienstlichen
Bespitzelung erzeugt ein Klima der Einschüchterung. Indem man den Bereich
der verdächtigen, "verfassungsfeindlichen" Äußerungen lange
bewußt unscharf ließ, wußte niemand so recht, ob er noch die erlaubte Gesinnung
hatte oder als "Radikaler" zum Beispiel nicht zum Staatsdienst
zugelassen wurde. Erst das Bundesverfassungsschutzgesetzes vom
20.12.1990 schuf ein Mindestmaß an Rechtssicherheit. Objekt der Beobachtung
waren dabei immer nur die "anderen": Obwohl die Bundestagsparteien
seit Jahren am laufenden Band Gesetze produzieren, die das Bundesverfassungsgericht
wegen ihrer Unvereinbarkeit mit Verfassungsnormen wieder aufhebt,
betrachten sie sich als allein legitime Hüter der Verfassung. Die GRÜNEN
wurden bespitzelt, solange sie "draußen" waren. Nach ihrem Einzug
in Parlamente bildete man dann Koalitionen mit ihnen.
Der Verfassungsschutz gibt den jeweiligen Regierungsparteien
ein scheinbar legales Mittel, demokratische Konkurrenzparteien mit nachrichtendienstlichen
Mitteln auszuspähen. Praktischer Erfahrung nach haben Verwaltungsrichter
in den seltensten Fällen den Mut, eine offenkundig gesetzwidrige Einschleusung
von V-Leuten des Verfassungsschutzes und ähnliche Methoden zu unterbinden.
Diese V-Leute operieren in einer Grauzone, in
der selten klar wird, ob sie nur beobachten oder ob sie die "Vorfälle"
selbst provozieren, die der beobachteten Organisation später vorgeworfen
werden. Am 31.5.94 trat der der Bundesorganisationsleiter der Republikaner
Udo Bösch
"nach rund zweijähriger
aufmerksamer Beobachtung", wie er selbst formulierte, aus seiner
Partei aus und trat sofort vor die zufrieden schnurrenden Fernsehkameras. Und
im Juni 1994 gab der SPD-Innenminister in NRW zu, daß sein Verfassungsschutz-Informant
Bernd Schmitt
in Solingen Leiter der Kampfsportschule
war, aus der die Täter des dortigen Brandanschlags auf Türken am 29.5.93 hervorgegangen
waren.
Viel wichtiger als die nachrichtendienstliche Beobachtung
selbst ist den Regierenden im Zeitalter der symbolischen Politik aber,
die Opposition quasi amtlich als Staatsfeinde stigmatisieren zu können.
Die Strategie der Stigmatisierung wird in internen Papieren des Konrad-Adenauer-Hauses
immer wieder betont und anempfohlen. Da schwingt dann rechtzeitig vor Wahlen ein
Partei-Generalsekretär wie Geißler den Taktstock gegen die Opposition,
und der Chor der parteiangehörigen Verfassungsschutzpräsidenten und
Fernsehmoderatoren stimmt betroffen und besorgt ein: Diese oder jene Partei
stehe im Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit.
Das hat in unserer Mediendemokratie etwa die Wirkung, als ließe ein
Showmaster über einen prominenten Schauspieler die Bemerkung fallen,
dieser mißbrauche kleine Mädchen. Der Ruf ist hin, doch gerichtlichen
Schutz geben die Gesetze des Parteienstaates gegen solche Rufschädigungen
nicht.
Der Verfassungsschutz wird als Verunglimpfungsinstrument
durchaus bewußt und zielgerichtet eingesetzt. Gelangt eine neue Gruppierung
zu gewisser Bedeutung, weil die Medien ihr eine gewisse Bekanntheit
ermöglicht haben, fährt der Schreck den Etablierten mächtig in die Glieder.
Der Parteienstaat zeigt dann seine Folterwerkzeuge vor, deren erstes das
Gespenst des Verfassungsschutzes ist: Da gibt es den früheren bayerischen
FDP-Vorsitzenden Brunner,
einen jahrelang gestandenen
Demokraten, eine Stütze des Systems. Leider war ihm in Brüssel bei seiner
segensreichen Tätigkeit für Deutschland aufgefallen, daß die Veranstaltung Brüssel vielleicht in Gänze gar
nicht segensreich für Deutschland werden könnte. Er klagte in Karlsruhe,
bekanntlich formell erfolglos, gegen den EG-Vertrag und trat aus der FDP aus.
Jetzt schmückt seine kleine aber feine Partei Bund Freier Bürger als jüngste Blume die bunte Wiese der Parteineugründungen.
Nein, so Brunner, eine Rechtspartei sei sie nicht. Betont marktwirtschaftlich,
ja liberal-konservativ sei man eingestellt. Für die Gründungsversammlung am 23.1.1994
wolle er als stellvertretende Vorsitzende mehrere bundesweit bekannten Professoren
und ähnlich integer-illustre Persönlichkeiten vorschlagen. Also alles klar
für das junge Parteischiff? Nein, der gute Brunner weiß nicht, wie das heutzutage
zugeht gegenüber Neuankömmlingen und Konkurrenzparteien: Da hatte der
thüringische Innenminister Schuster
(CDU) nichts eiligeres zu
tun, als in der Thüringischen Landeszeitung perfide zu behaupten, die geplante Partei sei "weitaus gefährlicher
als bereits verankerte Gruppierungen wie die Republikaner und die
NPD". Er werde die Gründungsversammlung beobachten lassen, könne die
Parteigründung aber nur verhindern, "wenn in Weimar konkrjet verfassungswidrige
Ziele formuliert werden." Armer Brunner
! Er weiß noch nicht, daß im
Parteienstaat die Macht hat, wer verbindlich bestimmt, wie die Verfassung
auszulegen ist, wo man ihre Feinde findet und wer diese medienwirksam stigmatisieren
kann. Diese Feinde sind immer die anderen,
zumal, wenn sie als Konkurrenz um die Pfründen gefährlich werden. Der Ausspruch
des CDU-Ministers ist an unterschwelliger Bösartigkeit und
verleumderischer Unterstellung kaum zu überbieten, aber er wird seinen Zweck
erfüllen. Niemand wird fragen, was Brunner wirklich will.
Wie Stefan Dietrich
an einem anderen Beispiel,
dem Niedersächsischen Landesamt für Verfassungsschutz, und seiner Instrumentalisierung
durch die rot-grüne Landesregierung ausführte, zeigt sich der zielgerichtete
Mißbrauch des Verfassungsschutzes darin, wie der linksextreme Bereich
dort bewußt bagatellisiert und der rechtsextreme mit einer gehässigen
Invektive gegen die CDU aufgebauscht wird: "Eine Probe seiner neuen
Hellsichtigkeit für rechte Umtriebe hatte das gewendete Landesamt schon im
Frühjahr mit der Wanderausstellung 'Demokratie gegen rechts' abgeliefert.
Aus dem Fundus des Verfassungsschutzes werden dort Parolen und Symbole,
Schallplatten und Magazine präsentiert, an denen man die rechten Rattenfänger
erkennt - eine sicherlich verdienstvolle Arbeit. Der CDU ist entgangen,
daß der Titel 'Demokratie gegen Rechts' auch eine Spitze gegen sie enthielt.
Wenn Ministerpräsident Schröder (SPD) oder Bundesratsminister Trittin
(Bündnis 90/Grüne) von 'den Rechten' sprechen, ist selten klar, ob sie damit
Rechtsradikale, die CDU oder beide meinen. Besonders Schröder zieht gern
Verbindungslinien zwischen den Bluttaten von Mölln und Solingen über
rechtsradikale Hintermänner zu den 'Verantwortlichen in der CDU'. Wenn
es ihm ernst damit ist, dann müßte der Ministerpräsident eigentlich den Verfassungsschutz
beauftragen, sich in Niedersachsen auch um christlich-demokratische Umtriebe
zu kümmern.
Eher unwahrscheinlich ist dagegen, daß etwa die Göttinger Autonomen,
mit denen Minister Trittin
offen sympathisiert, fortan
noch nachrichtendienstlich behelligt werden." Die Justizwachtmeister beim Amtsgericht
Göttingen plaudern heute noch gern über die 80er Jahre und über den Altkommunisten
Trittin (Kommunistischer Bund) und wissen manche dienstlich erlebte Anekdote
zu berichten. Daß in einer Koalition mit ihm seine alten Freunde der Göttinger
Autonomenszene nicht mehr beobachtet werden, gegen die jahrelang durch
den Generalbundesanwalt aufgrund § 129 a StGB wegen Bildung einer
terroristischen Vereinigung ermittelt wurde, wohingegen Trittin die verfassungstreuen
Republikaner bespitzeln möchte, versteht sich von selbst. Ob es unter
diesen Umständen reiner Zufall ist, daß Parteitage und Treffen der Republikaner
in Niedersachsen noch so quasikonspirativ vorbereitet werden können
wie sie wollen, es treten regelmäßig autonome Prügelkommandos in Aktion,
die das Tagungslokal kurz und klein schlagen und die Teilnehmer verhauen
wollen, mag seine nachdenkenswerten Gründe haben. Immerhin ist das vom
Verfassungsschutz in eine Gefängnismauer gesprengte Celler Loch noch in
allgemeiner Erinnerung.
Die Realität des totalen Parteienstaates und seines direkten
Zugriffs auf die Gewalten machte auch die Rechtspflege zum begehrten
Objekt sowohl derer, die sich in den Besitz der Rechtsprechung setzen
wollen, um mit ihrer Hilfe die gesellschaftliche Ordnung zu verändern,
als auch derer, die sie zur Stabilisierung
ihrer Herrschaft benötigen. Die Justiz ist heute Teil des Systems, was schon aus der Anwendung des vom Bonner
Establishment gemachten Gesetzesrechts folgt. Vor allem aber unterliegt
die Justiz dessen personellem Zugriff. Bei ihrer parteipolitischen
Durchdringung sündigen alle Parteien in einem Ausmaß, das selbst der sozialdemokratische
ehemalige Präsident des OLG Braunschweig, Rudolf Wassermann,
nicht mehr hinnehmbar findet.
Nicht mehr das Leistungsprinzip des Art.33 GG gilt, sondern "außerdienstliche
Aktivitäten". "Die Günstlingswirtschaft erzeugt
zwangsläufig einen Geist in der Justiz, der sich der Politik und den
Parteien verpflichtet fühlt."
Wer sich nicht genug verpflichtet fühlt,
versündigt sich als Richter nicht ungestraft gegen diesen Geist: Als das
Landgericht Mannheim im August 1994 den NPD-Vorsitzenden Deckert
zu einem Jahr Freiheitsstrafe
verurteilte und die Urteilsgründe bekannt wurden, warfen Parteivorsitzende,
unter ihnen auch der Bundeskanzler, dem Gericht vor, es habe zu viel Verständnis
für die Motive des Verurteilten durchblicken lassen. Das veranlaßte den
Kammervorsitzenden Richter Dr.Müller eilig zu einem von dpa verbreiteten öffentlichen Entschuldigungsschreiben, in dem
er durch seinen Rechtsanwalt beflissen Selbstkritik übte und flehentlich
darauf verwies, er sei doch "seit über 25 Jahren Mitglied der ältesten
deutschen demokratischen Partei" (also der SPD). Der anbiedernde Hinweis
hat dem Ärmsten indessen nicht genützt: Seine Parteigenossen-Richterkollegen
des Gerichtspräsidiums entzogen ihm vorläufig den Strafkammervorsitz.
Die oberen Richter dieser Republik werden vorsichtshalber
gleich von einer Handvoll Parteipolitikern hinter verschlossenen Türen
ausgehandelt: Die Entscheidung über die Auswahl hat sich
faktisch von dem nach § 6 BVerfGG durch den Bundestag zu wählenden Wahlausschuß
verschoben "auf eine nirgends rechtlich verfaßte, aus den Machteliten
der Parteien in Fraktionen, Regierung und Bundesrat bestehenden 'Arbeitsgruppe',
die sowohl die vom Bundestag wie die vom Bundesrat zu wählenden Richter
auswählt, so daß der Wahlmännerausschuß bzw. der Bundesrat nur noch formell
darüber beschließt."
Während das Volk auf die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts
keinerlei Einfluß hat, sollen gemäß Art.94 GG Bundestag und Bundesrat ihre
richterlichen Kontrolleure selber auswählen.
Tatsächlich aber wählt das Parlament gar
nicht, sondern hat einen zwölfköpfigen Wahlausschuß damit beauftragt. Doch
selbst diese Zwölf haben nicht wirklich das Sagen: Die verbindliche Vorentscheidung
darüber, wer nach Karlsruhe geschickt wird, treffen sogenannte Arbeitsgruppen
von zwei bis drei Personen hinter geschlossenen Türen. Dieser Zustand ist
"von Hause aus verfassungswidrig".
Auf diese Weise haben die Parteien bequem ein
"verfassungsunmittelbares Organ politischer Justiz"
geschaffen und mit ihnen genehmen Parteipolitikern
besetzt.
Zugrunde liegt dem ganzen Manöver die "Idee, daß sich
die beiden großen Parteien die Präsidentschaft" und die anderen Richterstellen
"ungefähr je zur Hälfte teilen."
So haben sie sich auf einen Modus
harmonischen Zusammenwirkens geeinigt, "allerdings auf Kosten
der Parteilosen, die bekanntlich 97% der Bevölkerung ausmachen.
...
Die Politik rekrutiert
also die höchsten Richter nicht aus dem (Juristen-)Volke, sondern aus
einer Kaste, deren Homogenität und Exklusivität durch ein Stück Papier bestimmt
wird: das Parteibuch. Das sind im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot
(Art.3 III GG) und die Bestenauslese (Art.33 II GG) zweifellos verbotene
Auswahlkriterien. Das höchste Gericht, das Verfassungsgericht,
wird also unter notorischem Verstoß gegen Verfassungsgrundsätze
besetzt; - oder gibt es irgendwo eine Stimme, die das bezweifelt?"
Für 10 der 16 Verfassungsrichter läßt das
Bundesverfassungsgerichtsgesetz genügen, daß sie irgendwann einmal
die zweite juristische Staatsprüfung bestanden haben.
Diese Praxis der Verfassungsrichterwahl
stößt in der herrschenden Verfassungslehre aus "begründete Ablehnung",
die "bis zur Verachtung" reicht."
Was für das Bundesverfassungsgericht gilt, setzt sich bei
den Landesverfassungsgerichten und den anderen Obergerichten fort. 1996
wurde eine Studie über den Einfluß der politischen Parteien auf die Ernennungen
zum Bundesgerichtshof
erstellt. Die Autoren befragten die BGH-Richter durch
einen anonymen Fragebogen. Der Anteil der parteigebundenen Richter liegt bei
rzwa 40%. "Von seiten der parteilosen Richter", führen die Autoren
der Studie aus, "wird scharfe Kritik an der Wahlpraxis der Parteien geübt,
die sich in Schlagworten wie "Däubler-Gmelin-Syndrom" und "Kohl-Effekt" niederschlägt
und die auch nicht davor zurückschreckt, Kollegen - immerhin Richter am
höchsten ordentlichen Gericht! - fachlich als "schwach" zu bezeichnen
und diese fachliche Schwäche mit der Parteizugehörigkeit in Verbindung zu
bringen."
Die Mitglieder des Hamburgischen Verfassungsgerichts können
ohne Rest den Parteien der Bürgerschaft zugerechnet werden.
Eine bayerischer Bürgeraktion mit ihrem
Vorsitzenden, der zugleich Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaften ist, Richard Sigl,
kündigte am 18.11.94 an, sie
werde gegen die Personalbesetzung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
klagen: Er sei zu 86% CSU-besetzt, von SPD und Grünen nur zu 14%. Nach Meinung
der SDP-Fraktionsvorsitzenden im Münchener Landtag, Renate Schmidt,
ist die Unabhängigkeit dieser
Richter "zum vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Landesregierung degeneriert"
Nicht jede personelle Ranküne der Parteien gelang den
Parteien: Mancher Politiker hat, zum Verfassungsrichter gewählt und somit in
den Stand der persönlichen Unabhängigkeit versetzt, zu für seine Entsendepartei
unliebsamer Rechtsamkeit und Neutralität gefunden. Dennoch brachte auch ein
jeder seine persönlichen politischen und ideologischen Grundwerte in die
Entscheidungen ein, welche auch sonst? Nun ist das Bundesverfassungsgericht
nicht berufen, die bloß formell richtige Auslegung des einfachen Gesetzesrechts
nachzuprüfen. Vielmehr soll es die Gesetzgebung gerade insoweit
kontrollieren, als sie einen politischen Akt darstellt, und zwar auf Übereinstimmung
mit der im Grundgesetz niedergelegten materiellen Wertordnung.
Durch diese Kontrolle soll verhindert werden, daß der demokratische
Rechtsstaat zur Diktatur der Parlamentsmehrheit pervertiert wird.
Indessen kann eine wertgebundene, mit anderen Worten ideologische,
Kontrolle der Parlamentsentscheidungen nur das Perpetuum mobile einer sich
immerwährend selbst reproduzierenden Herrschaft auf Grundlage einer
homogenen Herrschaftsideologie gewährleisten und erfüllt damit eine eminent
systemstabilisierende Funktion. Materiell wird durch die angewandte
Richterwahlprozedur sichergestellt, daß immer wieder Juristen aus einer
weltanschaulich verhältnismäßig einheitlichen Personengruppe Verfassungsrichter
werden und nur immer das System auf Einhaltung seiner eigenen Spielregeln
überwachen können. So gesehen, darf die "gewaltenteilende" Funktion
des Gerichts nicht dahingehend mißverstanden werden, unter seinem Schirm
könnte etwa eine grundsätzlich andere weltanschauliche oder politische
Richtung richterlichen Schutz suchen, als sie von den Bundestagsparteien
sonst vertreten wird. Eine weltanschauliche Gleichschaltung aufgrund
einer Parlamentsmehrheit, Regierung und Rechtsprechung übergreifenden homogen
liberalen Ideologie kann das Bundesverfassungsgericht also nicht nur nicht
verhindern; es ist sogar deren Garant. Als Hüter der Verfassung mit ihrem materiellen
Kerngehalt wacht es gemäß Art.79 Abs.III GG auf ewig über das geschlossene
System der liberalen "offenen Gesellschaft". Ist das eine Diktatur?
Welch akademische Frage - darf man doch in ihr, wie in einer Gummizelle,
alles tun; nur ändern kann man nichts.
Damit teilt das liberale System das Schicksal aller Systeme,
die Wert auf ihren Selbsterhalt legen. Kein System kann langfristig dulden,
daß seine geteilten Gewalten ein ideologisches Eigenleben führen, sonst zerstört
es sich infolge seiner inneren Widersprüche selbst. So bereitete die
Machtergreifung 1933 der Weimarer Republik ein schmähliches Ende. Sie
veranschaulichte uns, was aus einem System wird, dessen Rechtsprechung einen
so neutralen Gesetzesbegriff hatte, daß es seiner eigenen Auslieferung an
seine Feinde nichts entgegensetzte.
Für die wehrhafte
Demokratie des Bonner Grundgesetzes und militante Demokraten
gibt
es hingegen, Carl Schmitt
folgend, selbstverständlich nur einen auf einer einheitlichen
Wertordnung beruhenden Rechts- und Gesetzesbegriff. Das liberale
Bürgertum hat aus der Geschichte gelernt. Obwohl es ohnehin den ganzen
Staat erobert hat, hat es dessen Gewalten vorsichtshalber noch einmal aufgeteilt.
Weiter sicherheitshalber hat es sich von den Staatsfunktionen die Gesetzgebung
als Domäne reserviert. Durch die Grundsätze des Vorranges und des Vorbehaltes
der parlamentarisch beschlossenen Gesetze hat es sichergestellt, daß
die anderen Gewalten nicht außerhalb seiner Gesetze handeln dürfen. So
ist alles Recht "bürgerliches Recht," sind die Gerichte bürgerliche,
mit anderen Worten: liberale, Gerichte. Es wird so eine Rechtsprechung
gewährleistet, die auf die liberalen Grundwerte als oberste Werte ausgerichtet
ist. Der Vorrang und der Vorbehalt des parlamentarischen Gesetzes sichern
so einen liberalen Gesetzesbegriff, eine liberale Handhabung der
Exekutive und eine liberale Rechtsprechung.
Zur Verteidigung dieser Maßregeln muß betont werden, daß
kein System auf Dauer bestehen kann, das in seinen Staatsorganen etwa voneinander
abweichende ideologische Auffassungen zuließe. Die Einheitlichkeit der
staatlichen Verfassung und ihrer Wertordnung gilt nicht nur nach richtiger
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts
hier und heute, sondern in jedem stabilen
System. "Jeder Staat nimmt für sich ein Selbsterhaltungsrecht zur Verteidigung
des etablierten Macht- und Verteilungssystems in Anspruch. Auch wenn sich Unterschiede
in der Art und Weise feststellen lassen, wie dieses Selbsterhaltungsrecht
verwirklicht wird, so geht es doch stets darum, politische Systemgegner auszuschalten
oder wenigstens zu schwächen. Werden gerichtsförmige Verfahren dazu in
Dienst genommen, dann spricht man von politischer Justiz."
Deshalb kann die "Gewaltenteilung" nicht die
Gloriole eines etwaigen Refugiums für weltanschauliche Dissidenten für
sich in Anspruch nehmen, die nicht liberal sein möchten und andere Grundwerte
betonen als die freie Entfaltung der Individualität des Einzelmenschen.
Auch wenn jeder Angehörige der Rechtsprechung persönlich unabhängig ist,
ist er doch durch die Gesetze und die Verfassung, auf die er geschworen hat,
dazu verpflichtet, auf der Grundlage bestimmter vorgegebener Ideologeme
zu richten. Schreckenberger
hat diese als Trivialideologie
bezeichnet, als Basisdoktrin zur verfassungskräftigen Dogmatisierung eines
Kernbestandes gesellschaftlicher Überzeugungen, der für eine
pluralistische Gesellschaftsauffassung unentbehrlich sei. Diese werden heute üblicherweise als
"Wertordnung des Grundgesetzes" bezeichnet. So können Richter in
der parlamentarischen Demokratie mit derselben Konsequenz nur auf parlamentarisch-demokratischer
Basis richten, wie etwa Richtern im Sozialismus ein fester
"Klassenstandpunkt" abverlangt wurde. Das parlamentarische
System teilt das Schicksal aller Systeme, die Wert auf ihren Selbsterhalt legen:
Es ergreift alle Gewalten. In ihnen
muß zwangsläufig derselbe Geist walten. Eine Freiheit für nicht Liberale,
das System zu verändern, gibt es vor liberalen Gerichten nicht. Das relativiert
die Sage vom freiesten Staat auf deutschem Boden beträchtlich.
Wie empirische Versuche gezeigt haben, gibt es auch die für
die freiheitliche demokratische Grundordnung (FdGO) grundlegende Chancengleichheit
für alle Parteien nicht; jedenfalls nicht für neue Parteien, die dem
Postenverteilungskartell der Etablierten noch nicht angehören. Die
Chance des legalen Machtgewinns ist nicht nur Wesensmerkmal der FdGO, sondern
darüber hinaus der einzig plausible Grund für jede Opposition, sich friedlich
an die jeweiligen Spielregeln des jeweiligen Systems zu halten. Schließen
diese Regeln die Chance des friedlichen Machtgewinns aus, provozieren
sie ihre illegale Durchbrechung.
Eine Rechtsordnung, die allen Bürgern Rechtsfrieden
verspricht, "kann nur dann mit allgemeiner Akzeptanz rechnen, wenn und soweit die Normadressaten überhaupt bereit sind, einander als Rechtsgenossen, d.h.
als Gleiche und Gleichheitsfähige zu akzeptieren. Denn warum sonst sollte in
einer Demokratie die überstimmte Mehrheit bereit sein, sich dem Willen der
Mehrheit freiwillig zu unterwerfen,
wenn nicht deshalb, weil sie im Kern eben doch damit übereinstimmt? Wo es aber
an dieser prinzipiellen Übereinstimmung fehlt, ist die Demokratie nichts
anderes als eine Diktatur der jeweiligen Mehrheit; über diesen Zusammenhang
wird sich jedenfalls die Minderheit niemals täuschen lassen."
Die Chancengleichheit scheitert heute schon an den durch die
Altparteien geschaffenen Strukturen der staatlichen Parteienfinanzierung.
Erst am 9.4.1992 rügte das BVerfG die Parlamentsparteien hätten "im
Vergleich zu den an der Sperrklausel gescheiterten Parteien größere
Chancen, sich im Blick auf künftige Wahlen dem Wähler darzustellen und für
ihre Ziele zu werben." Weil sich dies auf Mitgliederzugang und
Spendenaufkommen auswirke, müsse der Gesetzgeber den nicht im Bundestag
vertretenen Parteien bei der Berechnung der Staatsquote einen Ausgleich
schaffen und ihren Wahlerfolg stärker gewichten als die bisherige
Parteienfinanzierung.
Zur Chancengleichheit für neue Parteien fehlt aber nicht nur
die Gleichbehandlung bei der ohnehin fragwürdigen Staatsfinanzierung der
Parteien und ihrer Wahlkämpfe. Direkt und gravierend verfassungswidrig
wird gegen die Chancengleichheit verstoßen, wo die Parteien alle verfügbaren
staatlichen und halbstaatlichen Mittel zur Niederhaltung aufkommender Konkurrenz
mißbrauchen. Das Beispiel verschiedener rechter Parteien, wie auch immer man
zu ihnen sonst stehen mag, hat gezeigt, wie neue Parteien gegen geltendes
Recht in Hunderten von Fällen flächendeckend von CDU- und SPD-parteifrommen
Stadtverwaltungen bewußt rechtswidrig
an der Nutzung öffentlicher Hallen und Versammlungsstätten
gehindert und wie sie von Parteibuchbürokraten, teilweise wider besseres
Wissen, als verfassungsfeindlich oder extremistisch verunglimpft und auf
das übelste beschimpft werden. Einen Höhepunkt erreichten diese Angriffe am
23.9.93 im Landtag von Baden-Württemberg, als der Abgeordnete Weimer
(SPD) über den Abgeordneten
Wilhelm
(Republikaner) in einem Zwischenruf
rief: "Wieso Kollege? Das ist doch kein Mensch!"
Die widerrechtliche Verweigerung städtischer Hallen und
Lokale, die allen anderen Parteien sofort zur Verfügung stehen, bricht sich
zwar ständig an der festen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, die das
Gebot der Chancengleichheit noch hüten. Daß aber immer erst ein einstweiliges
Anordnungsverfahren angestrengt werden muß, wenn eine Partei sich ihrer
Pflicht aus dem Parteiengesetz entsprechend versammeln und einen
Parteitag abhalten will, ist kein Zufall. Es beweist die systematische Diskriminierung
durch die Etablierten und ihre Statthalter in den Kommunen. Sie ist den
höchsten Vertretern der Rechtsprechung bestens bekannt: Der ehemalige
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda,
gab den ständigen offenen
Rechtsbruch mit den kritischen Worten zu, entweder müßten solche Parteien
verfassungsrichterlich überprüft (und gegebenenfalls verboten) werden,
"oder sie sind wie jede andere Partei zu behandeln. Alle Versuche, sich
um diese klare Alternative zu drücken, sind zu Recht gescheitert, wie vor allem
die wiederholten Bemühungen, solche Gruppierungen vom Zugang zu
öffentlichen Einrichtungen für die Abhaltung von Parteitagen oder Wahlversammlungen
auszuschließen. Es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, Parteien, die man
aus nur zu verständlichen Gründen nicht mag, anders als jede andere politische
Gruppierung zu behandeln." "Im Kampf gegen rechts" aber
"gelten grundsätzliche Erwägungen der Rechtskultur offenbar
nichts."
Immer häufiger bekommt unser
Rechtsstaat Aussetzer, wo es gegen "Rechte" geht. In seiner Ansprache
zum Pressegespräch des Bundesverwaltungsgerichts am 17.2.94 meinte dessen
Präsident Everhardt Franßen,
die Flut verwaltungsrichterlicher
Entscheidungen zugunsten rechter Parteien rechtfertigen zu müssen: Solange
eine Partei nicht vom BVerfG verboten sei, dürfe sie nicht benachteiligt
werden. "Daß dies die zuständigen Verwaltungen oder Entscheidungsgremien
in der Regel wissen, darf", so Franßen, "ebenso als bekannt vorausgesetzt
werden, wie der Umstand, daß sie sich manchmal scheuen, diesem Wissen entsprechend
zu handeln."
Nicht mit richterlicher Hilfe korrigierbar ist die Diskriminierung
im Staatsfernsehen ARD und ZDF. In den parteihörigen Medien setzen sich
Beschimpfung und Verleumdung der Parteien fort, deren Vertreter nicht in
den Aufsichtsräten der Medien sitzen. Die tatsächlichen politischen
Forderungen dieser Parteien werden verschwiegen und ihnen andere, gar nicht
vertretene Positionen untergeschoben, ohne daß sie zu Wort kommt und damit
eine Chance hätte, die Falschbehauptungen richtigzustellen. Darin liegt ein
Element der Diskriminierung und macht die Berichterstattung zur Agitation.
Obwohl alle einschlägigen Rundfunkgesetze ausgewogene Berichterstattung
verlangen, kamen z.B. Republikaner bis zum Frühjahr 1992 nicht selbst zu
Wort und auch danach nur höchst selten und kurz. Während neo-nationalsozialistische
Halbstarke - volkspädagogisch abschreckend wegen des baren Unsinns
ihrer Rede - in politischen Magazinsendungen genüßlich vorgeführt werden
und ihre Sprüche klopfen dürfen, sind zum Beispiel Republikaner offenbar zu
gefährlich, als daß man sie auszustrahlen riskieren könnte. Nach informellen
Absprachen zwischen den Intendanten darf kein Republikaner seine Meinung
im Fernsehen vertreten und Programmpunkte vortragen, weil man dann nicht
mehr behaupten könnte, die Partei hätte außer dummen Sprüchen kein Programm.
Die Noelle-Neumannsche
Schweigespirale wird
operativ eingesetzt und gegen die als gefährlich eingeschätzte Konkurrenzpartei
gewandt: Die Politiker, die allabendlich in ihren Staatskarossen zu Sitzungen
auffahren, hält der Fernsehzuschauer für real. Wer nicht auffährt und eintrifft,
ist irreal - es gibt ihn einfach nicht. Die Ikone Bildschirm ersetzt für den
sich "in der ersten Reihe" wähnenden Zuschauer die Realität;
und in dieser Realität dürfen Störenfriede
nicht vorkommen.
Die Verfügungsmacht über die Medien ist eine der tragenden
Spielregeln des Systems, durch die es für seinen dauernden Selbsterhalt
sorgt. Wenn Parteipolitiker und ihre Journaille sich gegenseitig Vorlagen
geben, steht jede Konkurrenz sofort im Abseits, die nicht über die Mikrophone
verfügt. Ihre grundgesetzlich garantierte Freiheit, bei diesem Spiel
mitzumischen, ist so hilfreich wie die Freiheit der Menüwahl bei Tische, wo
der Fuchs und die Gans miteinander tafeln. Mit dem Zugriff auf das Fernsehen
und mit seinem parteipolitischen Mißbrauch haben die Kartellparteien das
ausschlaggebende Machtinstrument der modernen Mediengesellschaft in
der Hand. Sein Einsatz beseitigt die Chancengleichheit vollständig und
trifft damit den Nerv der FdGO. Diese Grundordnung, so juristisch verschroben
sich ihre Definition durch das BVerfG auch anhören mag, bildet in sich ein
ausgewogenes und durchdachtes Ganzes. Man kann nicht einzelne ihrer Elemente
beliebig beseitigen, ohne das Funktionieren des Ganzen zu stören. Die
fehlende Chancengleichheit für Andersdenkende, die dem Postenverteilungskartell
mit Wertüberzeugungen entgegentreten und sich im Fernsehen ständig als
Extremisten oder Schlimmeres abqualifiziert finden, führt bei einer
wachsenden Zahl nachdenklicher Bürger zu einem fortschreitenden Legitimitätsverlust
des Parteiensystems und fördert die Radikalisierung.
Die Schlußfolgerungen jeder Wissenschaft werden von nicht
mehr hinterfragbaren Axiomen geprägt. Bei den Staats- und Gesellschaftswissenschaften
sind das Annahmen über die Natur des Menschen. Die Hauptrichtungen des
politischen Denkens unterscheiden sich schon im Ansatz durch ihr optimistisches,
skeptisches oder pessimistisches Menschenbild. Wer an die natürliche Güte
des Menschen glaubt, meint, keinen Staat als Tugendwächter nötig zu haben.
Der staatsfeindliche Radikalismus wächst in dem gleichen Grade wie der Glaube
an das radikal Gute im Menschen.
Je mehr Schlechtigkeit man seinen Mitmenschen
hingegen zutraut, desto eher rechtfertigt man Gesetze und einen starken
Staat über ihnen; denn "Tugend", sagte schon Wilhelm Busch
so nett, "will ermuntert
sein; Bosheit kann man schon allein!"
Nach der Doktrin des Liberalismus soll angeblich die Summe aller
privaten Egoismen zum Gemeinwohl führen, wenn man ihnen freien Lauf läßt.
Im Parlament würden die Sonderinteressen
durch Meinungsaustausch und Diskussion koordiniert und zu einem Ausgleich
gebracht, bis sie sich mit dem Interesse des Gemeinwesens als Ganzem
identisch wären. Diese pluralistische Harmonielehre, welche die Resultante
des Interessendrucks mit dem Gemeinwohl gleichsetzt, wird von Liberalen wie
ein Dogma aufrechterhalten.
Es vermag im Gemeinwohl nichts anderes zu
sehen als ein "Kräfteparallelogramm der Sonderinteressen."
Ihre Grundüberzeugung vom Menschen fußt
auf einem schönfärberischen Menschenbild, dessen sich in polemischer
Absicht vornehmlich diejenigen bedienen, die von staatlichen Schutzgesetzen
für ökonomisch und sozial Schwache nur persönliche Nachteile befürchten:
die Eigentümer von Kapital. "Der Staat ist den Eigentümern ein
notwendiges Übel, und man muß jedes Übel so klein machen als möglich."
Also duldet der Liberale den Staat allenfalls
als in Diensten der Gesellschaft stehendes, mißtrauisch kontrolliertes
Übel. Tatsächlich hingegen ist das Gemeinwohl nicht die Summe der addierten
Einzelwohle und bleibt ein aliud und
ein Eigenwert im Verhältnis zum Einzelinteresse.
Nun gehören die bewußten Bösewichte unter uns ebenso zu
den Seltenheiten wie die selbstlosen Tugendbolde. Weder eine Diktatur
zur Niederhaltung des prinzipiell Bösen im Menschen, noch ein offen staatsfeindlicher
Anarchismus zur besseren Entfaltung des Guten ließe sich durch empirische
anthropologische Beobachtung stützen. Die Erfahrung macht vielmehr
skeptisch und lehrt vielmehr, daß wir "zu allem fähig" und insoweit
mit freiem Willen zum einen und zum anderen ausgestattet sind. Unsere
stammesgeschichtlich ererbten Anlagen lassen uns allerdings in bestimmten
Situationen zu bestimmten Handlungen neigen, die sich teilweise in der
modernen Welt als problematisch erweisen können.
Insoweit hat Arnold Gehlen
den Mensch zu Recht als Mängelwesen bezeichnet.
Zu den "Mängeln" gehören neben der
Aggression das Dominanzstreben und eine Neigung, das eigene Wohlergehen
und die kurzfristige Vergrößerung des persönlichen Erfolgs für wichtiger
zu nehmen als das Gemeinwohl und damit die Grundlage der eigenen
Existenz. "Der Mensch ist nicht böse von Jugend auf, er ist gut genug für die Elf-Mann-Sozietät, aber nicht 'gut
genug', um sich für ein anonymes, persönlich nicht bekanntes Mitglied der
Massensozietät so einzusetzen, wie für das persönlich bekannte und eng
befreundete Individuum"
Sein Verstand predigt erst einmal Selbstsucht,
und darum sind die meisten Menschen dann am scharfsinnigsten, wenn es darum
geht, sich von ethischen Verpflichtungen freizusprechen.
Das auf ein abstraktes Gemeinwohl gerichtete altruistische Handeln kommt also nicht als angeborene
Verhaltensweise von allein, sondern bedarf der "sozialen Abstützung"
durch Institutionen
die das Wohl des Ganzen wahren und Einzelegoismen,
wo nötig, in ihre Schranken weisen. Die Summe dieser Institutionen nennen
wir Staat. Dessen Funktionieren hängt davon ab, daß seine Amtsträger tatsächlich
gemeinwohlorientiert handeln, denn von der Förderung dieses Wohls und
dem In-Schach-Halten der Egoismen hängt seine Existenzberechtigung ab. Wenn
Vertreter von Einzel- und Teilinteressen den Staat und seine Amtsträger dazu
veranlassen, nicht mehr das Gemeinwohl als Maßstab zu nehmen, sondern Parteiinteressen,
muß man das im weitesten Sinne als Korruption bezeichnen. Der Liberalismus
ist immer in Gefahr, dieser eigennützigen Tendenz zu erliegen. In Deutschland
ist sie zum System erhoben worden. Die maßgeblichen Vertreter des Gemeinwohls
sind nämlich in einer Person regelmäßig auch Funktionäre organisierter
Gruppeninteressen und sollen zwei Herren gleichzeitig dienen, was sie natürlich
nicht können.
Das Gemeinwohl nimmt aber Schaden, wenn der Staat mit seinen
Institutionen nur mißtrauisch kontrollierter Untergebener gesellschaftlicher
Parteiungen ist. Seine Diener tragen Parteibuch und Parteigesinnung.
Der Liberalismus erhebt den Staat nicht zum fürchterlichen Leviathan,
sondern erniedrigt ihn im Gegenteil zum gefesselten Gulliver. Sechs
konservative Jahrhunderte mögen es gerade zwei Generationen erlauben,
liberal zu sein.
Ist der für den Zusammenhalt des Ganzen notwendige
Grundbestand an Gemeinwohlorientierung durch Generationenwechsel
aufgezehrt, kommen Führungseliten zur Macht, die den Staat nur noch als
Selbstbedienungsladen ansehen. Diese Toskana-Fraktion drängt seit einigen Jahren massiv an die Schaltstellen der Macht und verdrängt
die Restbestände älterer Politiker, die in ihrer Jugendzeit noch gelernt
hatten, daß Gemeinnutz vor Eigennutz geht.
Heute wird die fehlende Gemeinwohlorientierung allgemein beklagt. Der Bürger kann Entscheidungen von
Amtsträgern nur akzeptieren, wenn er darauf vertrauen darf, daß diese auf
dem Gemeinwohl und nicht auf privaten Interessen beruhen. Das Vertrauen
des Volkes in seine Repräsentanten ist die entscheidende Legitimationsgrundlage
und -voraussetzung einer repräsentativen Demokratie.
Ohne dieses Vertrauen denaturiert sie zu
einem inhaltslosen, technokratischen System. Diese Inhaltsleere und die ausdrückliche Weigerung
des "pluralistischen" Liberalismus zu überindividueller Sinnstiftung
haben den Weg in die Korruption unentrinnbar vorgezeichnet: Blind gemacht
für die Belange des ganzen Volkes, wurde der Bürger in einer Jeder-gegen-jeden-Gesellschaft
auf sich selbst zurückgeworfen. "In einem als 'liberal' mißverstandenen
Individualismus kapseln sich Individuen und Kleingruppen voneinander ab, um
ohne Rücksicht auf die Interessen der größeren Gemeinschaft ihre Eigeninteressen
durchzusetzen."
Massenhaft produzierte das System den Menschentyp,
den es zu seinem Funktionieren braucht: den Steuerzahler, den Kunden,
den Wähler, den Verbraucher - den Untertan. In einer anonymen
Massengesellschaft anonymer Mächte, deren Walten er immer weniger begreift,
fehlt ihm das Ethos, sich konstruktiv als bewußter Teil eines größeren
Ganzen zu verstehen - und umso leichter wird er manipulierbar.
Die Parteien haben ihre Beute so gesichert, daß werden muß
wie sie, wer an ihr Anteil haben will.
"Was ist das für ein System," fragt
der Radikaldemokrat Stubbe-da Luz verzweifelt, "in dem sich mit Erfolg
nur solche Menschen zeitweise zu widersetzen vermögen, die aus demselben
Holz geschnitzt sind wie die Funktionäre?"
Das Sozialschmarotzertum,
die Vorteilnahme auf Kosten anderer, wurde
zur Existenzfrage für Millionen. Der Fehler liegt im System: Die heutige
liberale Zerrform der "Demokratie" steht am Kulminationspunkt
einer Schwingung,
der sich auf die Formel "Du bis alles,
dein Volk ist nichts" bringen läßt und dem das frühere "Du bis
nichts, dein Volk ist alles" dialektisch gegenübersteht. Diese liberale
Eigensüchtigkeit kann erst überwunden werden, wenn der im Egoismus als
alleinigem Prinzip liegende Extremismus als solcher allgemein durchschaut
wird. Das wird die Stunde der systemüberwindenden Reformen im Sinne
Scheuchs
sein, in der das Feudalsystem
"auf Bundesebene beseitigt" und durch eine freiheitliche, dem Gemeinwohl
und den Einzelinteressen gleichermaßen verpflichtete Volksherrschaft ersetzt
wird, die zwischen den Extremen des Untertanenstaates und der totalen
Feudalgesellschaft ein ausgewogenes Mittelmaß findet.
Der extreme Liberalismus möchte den Staat gegen Null tendieren
sehen, weil er auf die sich ausbalancierende Kraft des Wettbewerbs organisierter
Gruppeninteressen baut. Sie sollen sich nach seiner "pluralistische
Harmonielehre" gegenseitig in Schach halten und auspendeln.
Dieses Interessenvertretungsmodell
behauptet scheinheilig, was den Sonderinteressen der jeweiligen Majorität
förderlich sei, könne dem Gemeinwohl nicht schaden: "Was für General Motors
gut ist, ist auch gut für Amerika."
Der Staat tritt hier nur noch als Agentur
beim Ausgleich der widerstreitenden Interessen in Erscheinung und muß
sich von Fall zu Fall besonders rechtfertigen, wenn er übergeordnete Gesichtspunkte
zur Geltung bringen will.
Ja, man geht sogar so weit, so etwas wie ein
Gemeinwohl überhaupt zu leugnen und mit dem sophistischen Gedankenkurzschluß
zu bestreiten, was das Gemeinwohl sei, hinge ja doch nur davon ab, wer die
Macht habe, es zu definieren. Letztlich sei das Gemeinwohl eine reine Fiktion.
Die Aufgabe einer staatlichen Verfassung reduziert sich nach dieser Sicht
auf ein bloßes Konfliktregulierungssystem zum wechselseitigen Interessenausgleich.
Demgegenüber läßt sich sehr wohl und sehr leicht feststellen, welche politische
Maßnahme, z.B. auf ökonomischen Gebiet, wem nützt. Unter demokratischen
Prämissen kann Gemeinwohl nur bedeuten, als Bezugsgröße möglichst alle Angehörigen
des Volkes zu wählen, nicht hingegen nur eine Teilgruppe oder gar Fremde.
Durch Ausschaltung dieses Gemeinwohlbegriffs ist die BRD
heute die institutionalisierte Arena aller derer, die sich machtvoll organisieren
und die Unorganisierbaren als ihre Schäfchen in den trockenen Pfründenpferch
treiben können. Es herrscht das Gesetz des ökonomisch Stärkeren und Listigeren.
Wie sagte schon Carl Schmitt:
Heute - 1923 also - erscheine
das Parlament selbst als riesige Antichambre vor den Büros oder Ausschüssen
unsichtbarer Machthaber. Die Selbstrechtfertigung dieses Systems läßt sich
vereinfacht auf die vulgärliberale Behauptung reduzieren, die Resultante
des Interessendrucks sei identisch mit dem Gemeinwohl. Der inneren Logik des
Liberalismus folgend soll das zuallererst auf ökonomischem Gebiet gelten.
Einer Nachprüfung hält diese These allerdings nicht stand
und erweist sich als ideologisches Vorurteil:
Es führt bereits das Mit- und Gegeneinander der Parteien und Verbände keineswegs
zu einer höheren Harmonie und Ausgewogenheit. "Mit Theodor Eschenburg
gilt: 'Was nicht organisiert
ist, ist ungeschützt.' Der Druck der organisierten Kräfte ist deshalb
auch in der Summe alles andere als ausgewogen. Dieses Ungleichgewicht infiziert
die gesamte politische Willensbildung. Die organisationsstarken Verbände
haben nicht nur im Wege der Tarifautonomie direkte Rechtsetzungsmacht,
sondern mittels Geld, Sachverstand und Wählerstimmen auch Einfluß auf die
Politik.
"
Wir haben gesehen, daß es in der Natur jedes einzelnen Menschen
einen offenbar arterhaltenden und deshalb angeborenen Antrieb gibt, zunächst
sein eigenes Wohl zu fördern und das der Allgemeinheit als für die Existenz
des Individuum sekundär wichtig hintanzustellen. Wir haben uns auch mit
letztlich darauf zurückführbaren inneren Gesetzmäßigkeiten jeder
politischen Organisationsbildung befaßt; sie neigt zu oligarchischen
Herrschaftsstrukturen und unterliegt der Tendenz zur Verselbständigung
und Verfestigung. Das Zusammenwirken beider Faktoren, des natürlichen
menschlichen Egoismus und des u.a. aus dem Dominanztrieb folgenden ehernen
Gesetzes der Oligarchisierung, führt zwangsläufig nach einiger Zeit zu
feudalen Herrschaftsstrukturen. Anstatt das Wohl der Allgemeinheit
durchzusetzen, bilden die Herrschenden kleine Machtgruppen zur Förderung
des Wohles ihrer Mitglieder. Von ursprünglich politischem Wollen denaturieren
sie mit der Zeit zu ökonomisch motivierten Kartellen zur Verteilung von Posten
und Pfründen und werden zu eigenwirtschaftlichen Interessengruppen;
ein dem schon in der Antike bekannten Verfall der Aristokratie zur Oligarchie
vergleichbarer Vorgang. Auf den ökonomischen Sektor herabgesunken,
treffen sich die oligarchischen Grüppchen mit den dort ohnehin schon vorhandenen
Sonderinteressengruppen, mit denen sie personell von Anfang an teilidentisch
sein können. So erzeugen die Alleingeltung des Ökonomischen
und das blinde Walten seiner Gesetze in einer vom Liberalismus beherrschten
Gesellschaft einen "modernen Feudalismus"
,
der die Armen schlimmer unterdrücken kann als sein wenigstens noch von
christlichen Sittlichkeitsideen begleiteter mittelalterlicher Vorgänger.
Der im politischen Raum festzustellenden Gegensatz zwischen
dem Allgemeinwohl und den Einzelinteressen findet seine verblüffende systematische
Entsprechung in volkswirtschaftlichen Untersuchungen, die sich die
Frage nach der Gemeinverträglichkeit eigennütziger Intererssenorganisation
gestellt haben. Die Mechanismen der Förderung des eigenen Wohls und
die Organisationenbildung zur Durchsetzung von Gruppeninteressen gegen
das Allgemeinwohl wirken sich volkswirtschaftlich in derselben Weise aus
wie im politischen Bereich. Während diese Wirkungszusammenhänge im Politischen
den Handlungsspielraum einengen und zu mangelnder Vertretung des Gemeinwohls
zugunsten von Sonderinteressen führen,
haben sie im Ökonomischen eine entscheidende
Minderung von Wachstum und Effizienz der Volkswirtschaft zugunsten
kleinerer Vorteile von Einzelinteressen zur Folge.
Amerikanische Ökonomen, namentlich Mancur Olson,
kamen diesen Gesetzmäßigkeiten
durch die Erforschung der Gründe für sogenannte Wirtschaftswunder auf die
Spur. Wie es häufig ist, fanden sie hinter einem scheinbaren Wunder ein
allgemein wirkendes Gesetz. Das Wunder hatte darin bestanden, daß die
Volkswirtschaften verschiedener Staaten seit Beginn der Industrialisierung
auffällig unterschiedliche Wachstumsraten aufwiesen. Während England im
19. Jahrhundert noch einen extrem hohen Zuwachs erwirtschaftete, ließ dieser
bis in unsere Tage immer weiter nach. Deutschland dagegen war in der ersten
Hälfte des 19.Jahrhunderts arm, holte aber nach der Gründung des Zollvereins
und 1871 des Deutschen Reiches so schnell auf, daß es um 1914 England überholte. Nach dem 2.Weltkrieg lag die jährliche
Wachtstumsrate bis 1960 bei 6,6% (dagegen England 2,3%, Japan 6,8%), bis 1970
nur noch bei 3,5% (E. 2,3%, J. 9,4%) und sank bis 1978 auf 2,4% (E. 2,0%, J.
3,8%). Mancur Olsons eingehende und hier nicht im Detail darstellbare Untersuchungen
haben einen direkten Zusammenhang zwischen der Bildung und Verfestigung
ökonomischer Sonderinteressengruppen und sinkendem Wirtschaftswachstum
ergeben. Dieser Ursachenzusammenhang war mutatis mutandis in allen entwickelten
Ländern nachzuweisen:
Stabile Gesellschaften mit unveränderten Grenzen neigen dazu,
im Laufe der Zeit eine steigende Zahl vom "Kollusionen", d.h. Organisationen
für kollektives Handeln, zu akkumulieren, also wirtschaftliche Sonderinteressengruppen
und Verteilungskoalitionen. Diese sind auf innergesellschaftliche Kämpfe
um die Verteilung von Einkommen und Vermögen ausgerichtet. Für Deutschland
wären dies namentlich Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften oder berufsständische
Kammern. Sie werden bei unveränderten äußeren Bedingungen mit der Zeit
gesetzmäßig mächtiger. Schwach waren sie hingegen noch in der Anfangsphase
der Industrialisierung, die im 19.Jahrhundert für England früher liegt als
für Deutschland. Während die Interessengruppen in England, ungestört von
gesellschaftlichen Umbrüchen, an Macht gewannen, wurden sie in Deutschland
1933 zerschlagen oder gleichgeschaltet, und was an ihre Stelle trat, wurde
1945 erneut aufgelöst und bildete sich erst nach und nach neu.
Der Zweck von Interessenverbänden besteht darin, das Wohl
ihrer Gruppenmitglieder zu fördern. Dafür bieten sich theoretisch zwei
denkbare Wege an: nämlich eine Vergrößerung der gesamten volkswirtschaftlichen
Verteilungsmasse oder die Erlangung eines größeren Anteiles an ihr. So
könnten zum Beispiel 1 Mio. Angehörige einer Gruppe in das Gesamtwohl des
z.B. 1oo Millionen zählenden Volkes investieren. Jeder Handschlag, der das
Vermögen der 1oo Mio. vermehrt, zahlt sich für jeden Gruppenangehörigen
zu 1/1oo aus; ihm kommt also nur diese Quote persönlich zugute.
Der zweite Weg ist der Kampf um eine höhere Quote an der
volkswirtschaftlichen Gesamtverfügungsmasse, ohne diese selbst zu erhöhen,
oder gar unter Inkaufnahme ihrer direkten Verringerung. Solche Anstrengungen
zahlen sich für die Gruppenmitglieder direkt und voll aus. So vermehrt ein
erfolgreicher Lohnstreik das Vermögen eines ÖTV-Müllwerkers selbst dann,
wenn er als Haushaltsvorstand später selbst höhere Müllgebühren zahlen
muß. Den Vorteil durch reines Verteilungsinteresse gelenkten Handelns haben
die Gruppenmitglieder voll, wohingegen sie etwaigen Nachteil für das Ganze
nur anteilig als Angehörige der weit größeren Allgemeinheit tragen müssen.
"Kurz gesagt, die typische Organisation für kollektives Handeln in
einer Gesellschaft hat wenig oder gar keinen Anreiz, irgendein bedeutendes
Opfer im Interesse der Allgemeinheit zu bringen [...] Sie kann den Mitgliederinteressen
am besten dienen, wenn sie nach einem größeren Anteil am Sozialprodukt
für sie strebt [...] In praktischer Hinsicht bestehen keine Schranken
für die Höhe der sozialen Kosten, die eine solche Organisation im Zuge des
Strebens nach einem größeren Anteil am Sozialprodukt der Gesellschaft aufzuerlegen
für zweckmäßig erachtet."
Ob der dabei gewonnene soziale Nutzen für die Gemeinschaft
als ganze die sozialen Kosten rechtfertigt, darauf nimmt die Interessengruppe
also keine Rücksicht.
Um ihren Mitgliedern den schnellsten Vorteil
zu verschaffen, wird sie ihre Anstrengungen und Geldmittel nicht daran setzen,
die Volkswirtschaft als Ganzes effizienter und den Verteilungskuchen
damit größer zu machen, obwohl ihre Mitglieder letztlich auch davon
profitieren würden. Der anteilige Nutzen am Vermögenszuwachs des Ganzen
läge aber für jedes Gruppenmitglied weit unter dem anteiligen Aufwand, den
es investieren müßte.
Da die Konzentration auf Umverteilungsfragen die Bedeutung
von gemeinsamen Interessen im Bewußtsein der Menschen verringert, machen
sie das Leben zwieträchtiger; es kann niemand gewinnen, ohne daß ein
anderer mindestens ebensoviel verliert. Der bloße Zeitablauf führt bei stabilen
Gesellschaften nach Olsons Erkenntnissen zu einer institutionellen Sklerose,
also gewissermaßen einer Verkalkung der Gesamtgesellschaft, die immer
unbeweglicher und ineffizienter wird. Die Anpassung an sich verändernde
Umstände und neue Technologien verzögert sich. Die unkritische Überzeugung,
Koalitionsfreiheit, Selbstorganisation gesellschaftlicher Gruppen
und die Institutionalisierung von Interessengruppen seien auch nach langer
Lebensdauer per se nur nützlich für das Ganze, ist demnach falsch.
Es ist daher wenigstens so viel Staat erforderlich, daß die
institutionelle Sklerose in gemeinverträglichen Grenzen gehalten und
ein Gleichgewicht zwischen berechtigten Sonderinteressen und dem Allgemeinwohl
erzielt werden kann. Die ihrer Natur nach dem Gemeinwohl abträglichen
ökonomischen Sonderinteressen dürfen sich nicht vollständig durchsetzen.
Es ist die Grundüberzeugung der liberalen "Laissez-faire"-Ideologie,
daß jene Regierung am besten ist, die am wenigsten regiert; die Märkte
würden das Problem lösen, wenn die Regierung sie nur in Ruhe ließe. In den
volkstümlichsten Darstellungen dieser Ideologie gibt es einen Monodiabolismus,
und der Teufel ist immer der Staat. Wenn dieser Teufel in Ketten gehalten
würde, gäbe es einen fast utopischen Mangel an Sorgen um andere Probleme.
In Wahrheit findet aber oft auch dann kein freier Wettbewerb statt, wenn die
Regierung nicht interveniert. Der Staat ist keineswegs die einzige Ursache
von Zwang oder sozialem Druck in der Gesellschaft.
Aus der Welt zu schaffen sind Gruppenegoismen allerdings
prinzipiell nicht, weil interessenorientiertes Handeln der Natur des Menschen
entspricht. Konservative Konzepte müssen das als gegeben hinnehmen,
halten sie sich doch selbst ihren anthropologischen Realismus zugute. Es
gilt daher Wege aufzuzeigen, die Verbändeegoismen zu zähmen und gemeinwohlkonform
in das Verfassungssystem zu integrieren. Da die erkannten Mängel ganz
überwiegend struktur- und systembedingt sind, gilt es, deshalb, die
Strukturen zu ändern.
Dagegen wäre der Versuch einer Unterdrückung
bürgerlicher und wirtschaftlicher Interessenvertretung mit dem natürlichen
Bedürfnis des Menschen nach Gruppenbildung und seiner zu achtenden Freiheit,
sich mit Menschen gleichen Interesses zu verbinden, unvereinbar.
Der Liberalismus wird weltanschaulich totalitär. Die
besondere Gefährlichkeit des Parteienstaates beruht auf der ideologischen Homogenität
seiner Staatsparteien und dem von ihnen ausgeübten Gesinnungsdruck. Nach
Kelsen
möchte die liberale Demokratie
gern "der Ausdruck eines politischen Relativismus und einer wunder-
und dogmenbefreiten, auf den menschlichen Verstand und den Zweifel der
Kritik gegründeten Wissenschaftlichkeit"
sein. In einem säkularisierten, weltanschaulich
neutralen Staat dürfte es liberaler Ansicht nach keine freiheitliche demokratische Staatsreligion geben.
Es gibt sie dennoch. "Aus dem
'Verfassungspatriotismus' wird eine geradezu religiös verklärte 'Verfassungsmystik'."
Das Dilemma des Liberalismus besteht darin, daß er wohl
seiner Selbsteinschätzung nach pluralistisch sein möchte, so daß moralische
oder religiöse Dogmen quer zu seiner kritisch-rationalistischen Eigenrechtfertigung
zu liegen scheinen, daß die Einlösung seines Pluralismusversprechens
aber zu seiner faktische Selbstaufgabe führen würde. Die liberale Demokratie
sieht sich mit ihrer Eigenrechtfertigung im entschiedenen Gegensatz
zur "totalitären Diktatur",
welche "die Rechtfertigung der richtigen Politik durch Rückgriff auf erste, wahre Prinzipien" will.
Sie möchte die "Dogmatisierung
des politischen Irrtums" verhindern und lehnt offiziell "eine positive, inhaltliche
Normierung und Festschreibung des sozialen Lebens nach vorgefaßten
...
Postulaten" ab.
Der Liberalismus stünde gegenüber konkurrierenden Ideologien
wehrlos da, wenn er ihnen, getreu seiner Selbstrechtfertigung, nur "liberal"
und pluralistisch gegenübertreten und sich selbst kritisch-rationalistisch
betrachten würde. Tatsächlich sieht er alle anderen Phänomene mit
kritisch-rationalistischen, aufgeklärten Augen, nur sich selbst nicht. Wie jedes
Herrschaftssystem würde er untergehen, wenn er die geistigen Grundlagen
seiner Macht nicht mit Gesinnungsdruck verteidigen, würde, wo sie angegriffen wird. Die weltliche Macht über die
Menschen behält er nur durch die spirituelle Kontrolle über ihren Glauben.
Trotz liberal-aufklärerischer Attitüde muß auch der Liberalismus an sich
selbst glauben, weil sich die liberale
Ratio nicht mit sich selbst begründen kann. Darum muß er mit seinen eigenen
Prämissen in Konflikt kommen und diese mit quasi-religiöser Inbrunst verteidigen,
sobald sie grundsätzlich in Frage gestellt werden.
Keine Herrschaft hält sich dauernd, die ihren Untertanen
nicht die Frage beantworten kann, welchen Sinn ihr Gehorsam eigentlich hat.
Diese Sinnstiftung ist Aufgabe von Herrschaftsideologien. Derartige
Ideengebäude gründen auf konkreten erwünschten Einzeltugenden, zum Beispiel
der Treue zum Königshaus in der Monarchie, der virtù in der Republik oder der Gottesfurcht im klerikalen Staat.
Soziologisch betrachtet fungieren derartige metaphysischer Gebote als
Mittel der Herrschaftstechnik. Sie verordnen den Beherrschten eine Ethik,
unter deren Geltung nicht nur die Herrschenden weiter herrschen und die Beherrschten
weiter beherrscht bleiben, sondern sich darüber hinaus des Beherrschtwerdens
erfreuen und es als ethisch anstößig empfinden, überhaupt die Frage nach der
Legitimation der Herrschaft aufzuwerfen oder gar gegen sie anzukämpfen. Dem
juristischen Verbot des weiteren Kampfes um die Macht folgt das moralische:
Der Unterlegene soll eine Wiederaufnahme des Kampfes noch nicht einmal
mehr denken dürfen. Der endgültigen Durchsetzung der etablierten Macht folgt
die Moralisierung des Politischen. Dem Unterlegenen wird eingeredet, daß es
moralisch böse und ethisch anstößig
sei, um Macht zu kämpfen, ja daß es überhaupt keine existentielle Feindschaft
gibt, die das Kämpfen lohnen würde. Das Friedlichkeitsgebot ist die Waffe
des Siegers, und die Wiederaufnahme des Kampfes zum Gedankenverbrechen;
schließlich zum Tabu. Dieses kann unter den Bedingungen des Medienstaates errichtet,
durchgesetzt und instrumentalisiert werden.
Während die Obrigkeit der mittelalterlichen Feudalgesellschaft
ihre Untertanen glauben machte, ihre Herrschaft beruhe auf Gottes Willen,
steht die intellektuelle Raffinesse moderner liberaler Herrschaftsrechtfertigung
den altvorderen Vorbildern in nichts nach. Es geht heute um die Wahrung der gesellschaftlichen
Macht der ökonomisch jeweils Stärksten. Diese bedarf zu ihrer Legitimierung
des Glaubens der vielen Schwächeren,
das möglichst unkontrollierte Walten rein ökonomischer Faktoren führe
über eine Art Kräftebalance zur Harmonie und auch ihrem, der Schwächeren,
Gedeihen. Durch kritisch-rationalistisches Infragestellen aller nicht
ökonomisch begründeten menschlichen Gemeinschaften sollen diese entlegitimiert
und schließlich zerstört werden. So gerät der von den Bindungen an Volk und
Familie "befreite" Deutsche umso sicherer unter die Herrschaft
des internationalen Geldes und findet sich als Verbraucher wieder.
Wie sich der real existierende Liberalismus aus dem ihm
eigentlich verhaßten Arsenal seiner ideolgischen Gegner bewaffnet, zeigt sich
bereits in seinen äußeren Alltagsformen. Politische Reden werden "wie
ein moralisch-rhetorisches Hochamt begangen", in dem "die Liturgie
vom guten Menschen zelebriert wird"
Nicht zufällig entfernt sich der deutsche
Alltag seit einigen Jahren wieder von jener nüchternen Nachkriegszeit, in
der die vom NS-System noch wirklich Betroffenen von Pathos und Aufmärschen, Fahnen, Schwüren, Hymnen und Fackelzügen
die Nase voll hatten. Die nachgeborenen Betroffenen ahmen in steigendem Maße wieder die äußeren Formen religiöser Kulthandlungen
nach, wie sich auch bereits die Aufmärsche und Feierstunden der Nationalsozialisten
und der Kommunisten bewußt der äußeren Formen religiöser Kulthandlungen
bedient hatten. So ist es kein Zufall, wenn wir evangelische Pastoren an
der Spitze von Lichterketten marschieren sehen. Diese gehören zur Familie
der Fackelzüge und Bußprozessionen und gehen letztlich auf vorchristlich-archaische
Kulthandlungen zurück. Es ist auch kein Zufall, wenn CDU-Strategen die Stigmatisierung politischer Gegner
anstreben. In diesen Zusammenhang gehören die gebetsmühlenartig wiederholten
Betroffenheitslitaneien ebenso wie der gesellschaftliche Bann für Ungläubige.
Jede Herrschaftsrechtfertigung ist eben in ihrem Kern Religion. "Alle
prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische
Begriffe."
Daher ist jedes System nur im Kern seiner
metaphysischen Letztrechtfertigung erfolgreich angreifbar. Diese wird es
diese mit quasireligiöser Inbrunst verteidigen und dabei mit den Waffen
der Ketzerverfolgung zurückschlagen müssen, oder es wird untergehen.
Es genügt nicht, die Handlungen des
Abweichlers zu verbieten. Auf Dauer läßt sich ein System nur verteidigen,
wenn es alle Taten und die Gesinnung desjenigen verflucht, der es abschaffen will.
Im diesem Lichte betrachtet entpuppt sich der angeblich aufgeklärte,
säkularisierte Deutsche des ausgehenden 20. Jahrhunderts als ebenso
anfällig für das Pathos der heute dominanten humanitaristischen Zivilreligion
wie sein mittelalterlicher Vorfahre für die christliche Religion. Jedes
Zeitalter hat seine eigenen Mythen. Heute erfüllt der Glaube, daß alle Gewalt vom Volk komme, eine ähnliche Funktion
wie früher der Glaube, daß alle obrigkeitliche Gewalt von Gott komme.
Robert Michels
sprach 1911 treffend vom Gott der Demokratie. Zu den Dogmen der humanitaristischen
Zivilreligion gehören neben der Souveränität des Volkes ein egalitaristisches
Verständnis der Menschenrechte, und ähnliche Gedankenkonstrukte. Sie werden
von ihren Gläubigen mit derselben Wut verteidigt, über die Voltaire
im März 1737 an Friedrich
schrieb: "Alle Theologen aller Länder (sind) Leute, die von heiligen
Schimären trunken sind, (und) ähneln jenen Kardinälen, die Galilei verdammten..."
So zeigt sich heute der theologische Kern der humanitaristischen Menschenrechts-
und Demokratietheorie, der alle Säkularisierungen überstanden hat.
Über die christlichen engen Verwandten
unserer Demokratiegläubigen schrieb Friedrich der Große
an Voltaire am 4.11.1736: "Was die Theologen
angeht, so scheint es, als ähnelten sie sich alle im allgemeinen, gleich
welcher Religion oder Nation sie angehören; stets ist es ihr Bestreben,
sich über die Gewissen eine despotische Autorität anzumaßen."
Die Gläubigen unserer Zeit verteidigen ihre Moral mit demselben
quasireligiösen Fanatismus wie die Gläubigen aller Zeiten ihre jeweiligen
Götter. Friedrich
hatte sie in einem Brief an
Voltaire am 6.7.1737 so charakterisiert: "In Deutschland fehlt es nicht
an abergläubischen Leuten, auch nicht an von Vorurteilen beherrschten
und bösartigen Fanatikern, die umso unverbesserlicher sind, als ihnen
ihre tumbe Unwissenheit den Gebrauch der Vernunft verbietet. Es steht
fest, daß man im Dunstkreis solcher Untertanen vorsichtig sein muß. Selbst der
ehrenhafteste Mensch ist verschrien, wenn er als Mann ohne Religion gilt.
Religion ist der Fetisch der Völker. Wer auch immer mit profaner Hand an sie
rührt, er zieht Haß und Abscheu auf sich." Ebenso verfahren die modernen Demokratiegläubigen,
die Betroffenen, bei wirklichen oder eingebildeten Angriffen auf
ihren Gott. Wer mit profaner Hand an die vergötterte Demokratie rührt oder sie gar anzweifelt, stößt sich selbst aus
der Gemeinschaft der Guten so
sicher aus wie jeder Ketzer in irgend einem Zeitalter. Wer das nicht glaubt,
kann ja einmal öffentlich bekennen, kein Demokrat oder nicht betroffen zu sein, und warten, was dann
passiert: Er zieht unweigerlich die soziale Reaktion des Mobbing
auf sich: die Gruppenhatz. Er wird erfahren,
was das Wort Sündenbock eigentlich
bedeutet und was es heute heißt, einer zu sein: Wie in allen Zeiten der Sündenbock
rituell geschlachtet wurde, um symbolisch die Sünden der Gemeinschaft der
Rechtgläubigen auf sich zu ziehen und jene zu erlösen, fühlt sich der moderne Betroffene gleich besser, wenn in einer
Talkschau, der Mitternachtsmette der liberalen Diskursgesellschaft, mit
gehörig betroffener Miene der Neonazi beschworen, verdammt und ausgetrieben wurde. Oh Herr, ich danke dir, daß ich
nicht so scheußlich bin wie jener! In Sodom und Gomorrha soll es leider keinen
Gerechten mehr gegeben haben. Im Liberalismus gibt es nur Gerechte:
Pharisäer - Selbstgerechte - sagte man früher.
Wie die Hohepriester aller Religionen Sündenböcke brauchen,
benötigt der liberale Staat den seinen: Es ist der sogenannte Neonazi. Ob jemand Neonazi ist, bestimmt
er freilich ebensowenig selbst wie irgendein anderer historischer Sündenbock.
Heute bestimmen die Massenmedien nach ihren Bedürfnissen, wer Neonazi ist. Vor den Richterstühlen
der modernen Dreifaltigkeit aus Fernsehmoderatoren, Staatsparteien und
Verfassungsschutz gilt wieder das Wort Friedrichs des Großen: "Wir haben
hier eine Sekte Seeliger, die den Presbyterianern in England ausgesprochen
ähnelt und sogar noch unerträglicher ist, weil sie in strenger Rechtgläubigkeit
ohne Einspruchsrecht alle jene der Verdammung überantwortet, die nicht
ihre Ansichten teilen." Damit hatte er auf Voltairs Satz geantwortet:
"Es wird eines Ihrer größten Geschenke an die Menschheit sein, wenn Sie
Aberglauben und Fanatismus unter Ihren Sohlen zertreten, nicht zulassen,
daß ein Mensch in Robe andere Menschen verfolgt, die nicht so denken wie
er."
Der Liberalismus mußte zwangsläufig totalitär werden, sobald
eine wachsende und nicht mehr ohne weiteres beherrschbare Zahl seiner
Untertanen mit ihren Interessen in Konflikt zu den Interessen derjenigen
kam, welche durch den liberalen Status quo bevorzugt werden. Die liberale
Auffassung vom Staat als großem Betrieb führt zur Öffnung der Grenzen und zur
Privatisierung wichtiger Lebensbereiche wie demjenigen der öffentlichen
Sicherheit, widerspricht aber den Bedürfnissen vieler Bürger. Die Beispiele
ließen sich beliebig vermehren. Dem Pochen von immer mehr Bürgern auf gegen
den Liberalismus gerichteten persönlichen und nationalen Interessen kann
dieser nur noch damit begegnen, daß er es als ketzerisch brandmarkt, seine Abweichler
stigmatisiert oder als Neonazis dämonisiert. Der Kultus der Staatsreligion
Liberalismus mit seinen von Pastoren angeführten Lichterketten und
Betroffenheitsriten, seinen Tabuzonen und Exorzismen wird sich allerdings
nur halten können, wenn es dem Liberalismus gelingt, die Anzahl seiner Gegner
rechtzeitig durch Masseneinwanderung in die Minorität zu drängen und weiterhin
sozial und politisch auszuschalten.
Gegen die unbestreitbaren und seit Jahrzehnten bekannten
Mängel des parlamentarischen Systems wenden die Anhänger des Parlamentarismus
ein, größere Freiheit habe der Bürger nirgends. Diese Meinung beruht auf
einer Verwechslung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diese ist eine
altliberale Schöpfung. Pure Demokratie, lehrt geschichtliche Erfahrung,
könnte dagegen zur jakobinischen Willkür der Mehrheit führen. David Hume
hatte behauptet, daß es im
Frankreich des ancien régime mehr
Freiheit der Rede und des Handelns gegeben habe, als im republikanischen
Holland: Eine Monarchie habe es nämlich nicht nötig, zu so willkürlichen
Maßnahmen zu greifen, wie die holländischen Behörden es notgedrungen
täten.
Heute verbreiten Liberale das Vorurteil, es möge zwar gegen
das Funktionieren der Leitideen des Parlamentarismus begründete Einwände
geben - ja, man gibt mit entwaffnendem Lächeln zu, daß er "die schlechteste
Staatsform überhaupt" sei - indessen gebe es eine bessere auch nicht.
Vor allem hätten alle Alternativen noch schlimmere Nachteile. So habe es
Massentötungen und -vertreibungen in voll ausgebildeten parlamentarischen
Systemen nie gegeben.
Aber fand das demokratisch-parlamentarische
Amerika etwas dabei, die Indianer fast auszurotten und bis zum Sezessionskrieg
Sklaven zu halten? Hatten nicht die urparlamentarisch regierten Briten
im Burenkrieg 1902 die ersten Konzentrationslager der Geschichte gebaut
und seit 1932 den totalen Bombenkrieg auf die Zivilbevölkerung eines potentiellen
Kriegsgegners geplant? Wurde nicht Ludwig XVI. von Parlamentariern der
französischen Nationalversammlung zur Guillotine geschickt? Die
Achtung vor den Menschenrechten hängt nicht von der Regierungsform ab.
Darum sind auch Demokratie oder Parlamentarismus keine Vorbedingung für die
Geltung von Menschenrechten.
Leicht ließe sich ein Register kleiner und großer
Sünden parlamentarisch regierter Staaten aufstellen. Ein anschauliches
Bild davon, was auch in der angeblichen
westlichen Wertegemeinschaft unter einer parlamentarischen Regierung 1945-1949 in Belgien möglich war,
vermittelt Reißmüller:
"Zur Repression der
Nachkriegsjahre gehörte unter vielem anderen folgendes: Frauen und
Kinder von Beschuldigten wurden im Vollzug von Sippenhaftung eingesperrt.
In den Gefängnissen und Lagern - sogar ein von den Deutschen errichtetes
und betriebenes Konzentrationslager führte man mit neuen Häftlingen
weiter - wurde gefoltert, getötet. Unzählige Strafverfahren sprachen
jeder Rechtsstaatlichkeit Hohn; sie wurden im Blitztempo geführt, der Angeklagte
wurde nicht gehört, die Verteidigung behindert, Entlastungszeugen wurden
bedroht
...
. Zehntausende Personen
kamen ohne strafrechtlichen Vorwurf in Haft.
...
. Ein anderes Kapitel
damaligen Staatsunrechts war das Geschehenlassen von Terror, den nach
der Befreiung wirkliche oder falsche Widerständler übten. In jenen
Monaten haben entfesselte einzelne und Gruppen gemordet, gefoltert,
verschleppt, vergewaltigt, geraubt; Polizei und Strafjustiz schauten
weg oder zu."
Die kühne Behauptung der Liberalen, ihr Parlamentarismus
sei die einzige Staatsform, die Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten
garantieren könne, ist also durch vielfache historische Erfahrung widerlegt.
Da diese Menschenrechte als "Naturrechte" zur Summe aller vorpositiven Rechtsnormen
gehören, werden sie ausdrücklich für gegen das staatliche Recht verbindlich
erklärt und können weder begriffliche Merkmale der Demokratie noch
des Parlamentarismus oder irgendeiner anderen bestimmten
Staatsform sein. Keine bestimmte Regierungsform allein garantiert also
Humanität oder Menschenrechte. Daher "bekennt sich" das
Grundgesetz zu den vorstaatlichen Grundrechten und begründet sie nicht erst.
Für den Parlamentarismus sind Freiheitsrechte der Bürger gegen den
Staat zwar auch grundlegend; jedoch nicht als Ausdruck der allgemeinen
oder unveränderlichen Natur des Menschen,
sondern rein funktional auf das parlamentarische
System bezogen. Der primäre Sinn des ganzen Systems von Presse-,
Meinungs- und Versammlungsfreiheit hatte darin bestanden, den für das
Funktionieren des Parlamentarismus nach der liberalen Idee konstitutiven
Prozeß der öffentlichen Meinungsbildung zu gewährleisten,
in dem durch den freien Kampf der Meinungen
die "Wahrheit" entstehen soll als die sich aus dem Wettbewerb von
selbst ergebende Harmonie. Diese ursprüngliche Funktion haben sie
allerdings im real existierenden Parlamentarismus vollständig
eingebüßt. Nur der bürgerliche Rechtsstaat mit seinen Freiheiten verhindert,
daß Demokratie jakobinisch wird. Seine konsequente Durchführung durch den
Vorrang der Individualrechte verhindert die konsequente Durchführung
des demokratischen politischen Formprinzips
und verleiht so dem an sich totalitären Demokratiekonzept
ein "menschliches Antlitz."
Im heutigen Parlamentarismus gewinnen
die Grundrechte zunehmend Bedeutung als Abwehrrechte gegen als
staatliche Macht kostümierte Parteiwillkür. Nur ein neutraler Rechtsstaat
mit garantierten Bürgerrechten kann uns heute noch vor dem Jakobinismus
der richtigen Bewußtseins und den
Herrschaftstechniken der an die Macht gekommenen früheren Apologeten des
herrschaftsfreien Diskurses schützen.
Wenn also die Menschenrechte weder Begriffsmerkmal der Demokratie
noch des Parlamentarismus, sondern diesen nur aufgepfropft sind: Warum
sollen sie nicht auch andere Staatsformen und darüber hinaus jede organisierte
Macht erst veredeln und erträglich machen können? So bereitet weder begrifflich
noch tatsächlich die Vorstellung einer konstitutionellen Monarchie, einer Aristokratie
oder einer nicht absolut parlamentsbeherrschten Republik mit Bürger- und Freiheitsrechten
gedankliche Schwierigkeiten. Die Notwendigkeit dieser Rechte folgt
nämlich aus vorstaatlichen Wertentscheidungen, deren Richtigkeit in
vielen System gültig bleibt: Sie sind daher auch objektive Ordnungsprinzipien
für die von ihnen geschützten liberalen Wertgegenstände wie Ehe, Familien,
Presse und Eigentum
und als solche ein notwendiges Element und
Mittel zur Integration des Staates. In diesem Sinne ist Freiheit nicht als
schrankenlose Libertinage zu verstehen, sondern als "Freiheit zur
Realisierung der durch die Grundrechte ausgedrückten Wertvorstellungen."
Diese Wertentscheidungen sind auch anderen
Wertordnungen eigen und unabhängig von der Staats- und Regierungsform.
"Mit Hilfe der bürgerlichen Freiheit kann also jeder Staat, ohne
Rücksicht auf seine Staats- oder Regierungsform, in der Ausübung der
staatlichen Macht beschränkt werden.
Eine Durchführung dieser Prinzipien verwandelt jede Monarchie in eine verfassungsgesetzlich
beschränkte, sog. konstitutionelle Monarchie
...
Ebenso wird das
politische Prinzip der Demokratie verändert und aus einem rein demokratischen
Staat eine konstitutionelle Demokratie.
Die Prinzipien der bürgerlichen Freiheit können sich deshalb auch mit jeder
Staatsform verbinden, sofern nur die rechtsstaatlichen Schranken der
staatlichen Macht anerkannt sind und der Staat nicht 'absolut' ist."
In einem absolut monarchischen Duodezfürstentum des 18. Jahrhunderts
konnte man als Bürger ebenso frei von staatlicher Repression leben, wie in
einer zeitgenössischen Stadtrepublik wie Köln oder Hamburg; und unter
preußisch-monarchischer Herrschaft hatte ein Ehepaar vor hundert Jahren in
Frankfurt am Main eine objektiv größere Chance, eine Schar fröhlicher Kinder
großzuziehen, als heute im "demokratischen" Frankfurt, in dem
Jugendbanden schon in Schulen mit Waffen hantieren und die Gefahren durch
Rauschgift weitaus größer sind, als eine mögliche Bedrängung durch staatliche
Gewalt im Kaiserreich. "Freiheit läßt sich wirksam nur als einheitliche
gewährleisten, und aus einer unfreien Gesellschaft kann kein freiheitlicher
Staat hervorgehen. Sofern Freiheit nicht nur die Freiheit der Mächtigen,
gleich welcher Richtung, sein soll, bedarf sie vielmehr des Schutzes sowohl
gegen staatliche als auch gegen gesellschaftliche Beeinträchtigungen;
ihre Wahrung erfordert also eine Sicherung im Rahmen der Gesamtgesellschaft [...].
Insofern gewinnt gesellschaftliche Freiheit [...] Wirklichkeit erst
durch staatliches Tätigwerden."
Zugegeben: Wer damals "staatsfeindliches"
sozialdemokratisches Propagandamaterial herausgegeben hätte, der
hätte früh um sechs von der Polizei aus dem Bett geholt werden können. Aber
kann das 1994 nicht ebenso passieren? Es ist schon zu oft passiert. Nur sind
jetzt die Polizisten sozialdemokratisch und tragen keine Pickelhauben mehr;
als "staatsfeindlich" gelten jetzt andere Bestrebungen, aber das
gut eingeübte Beschlagnahmen von Propagandamaterial, Fahnen oder Kennzeichen
oppositioneller Gruppen hat in Deutschland bisher unter keiner Regierung
aufgehört. Und wer in St.Petersburg 1905 "auf die Straße ging",
wurde leicht von einem zaristischen Kavalleriesäbel getroffen; doch wer
heute in Hamburg zu später Stunde in der falschen Straße spazierengeht,
dem kann mit statistisch noch größerer Wahrscheinlichkeit dasselbe durch
die Klinge eines Kriminellen passieren.
Freiheit bedeutet eben nicht nur Freiheit von staatlichem Übergriff,
sondern auch von Gefahren unserer banalen, alltäglich gewordenen Kriminalität.
Die Summe aller "privaten" kriminellen Übergriffe auf Leib, Leben und
Eigentum der Bürger war und ist aber notwendig in liberalen Parlamentarismen
höher als in anderen Staaten, weil der Staat bewußt ohnmächtig gehalten wird.
Mit liberalistisch halbierter Vernunft wird dann entsetzt vermerkt, daß
die Polizei bei einer Ringfahndung "unsere Daten" benutzt, als ob
davon eine Gefahr ausginge; lieber läßt man die Verbrecher laufen. Der Staat
soll nach Meinung des Liberalen alles können, aber nichts dürfen. Die sich
dabei unvermeidlich einstellenden mafiosen Strukturen nimmt der Liberale
in seiner einäugigen Fixierung auf die von der Staatsgewalt potentiell ausgehenden
Gefahren hin und gelangt dabei vom Regen in die Traufe. So kann der erzliberale
Nachtwächterstaat den inneren Frieden und die Freiheit der Bürger nicht wahren,
wenn er ihnen nur hoch und heilig verspricht, ihnen auch gewiß nichts zu
tun, und das Versprechen dadurch einlöst, daß er gar nichts mehr tut und zum
impotenten Papiertiger wird. "Die individualistischen Apostel haben
noch nicht erkannt, daß auch die Republik ein Staat ist, der bejaht werden muß."
Das eigentliche Problem besteht also darin,
daß der notwendige Schutz vor staatlicher Willkür in einem ausgewogenen
Verhältnis stehen muß zu einem ausreichenden Maß an staatlicher Macht,
um die Bürger voreinander zu schützen
.
Dieses Verhältnis ist heute tiefgreifend gestört.
Wo nicht ein neutraler Rechtsstaat herrscht, herrschen
bestenfalls Verbände, Cliquen und Interessengruppen; schlimmstenfalls
herrscht die Mafia. Die liberale Gesellschaft ist der ideale Nährboden
für Mafias aller Art,
und zuweilen drängt sich die Frage auf, ob Staat überhaupt noch existiere oder ob
er zum Eigentum mafioser Politikgruppen geworden sei."
Ein System muß aber notwendig scheitern,
das den Eigennutz zum alleinigen Prinzip erhebt und daher keine Sicherungen
gegen Korruption hat. Mit aller Kunstfertigkeit und mit allem Fleiß sucht
der Liberale ein Gleichgewicht zu erreichen. "Nur für eine Macht hat
die liberale Schule das dieser entsprechende Gegengewicht nicht gesucht: für
die Macht der Korruption."
Fehlt äußerer Zwang, hat jedes Volk die Staatsform, die es
verdient. Gegen den entschiedenen und anhaltenden Widerstand einer großen
Mehrheit hat sich noch kein System auf Dauer halten können. Die Situationsbezogenheit
und Veränderungsbedürftigkeit der Staatsform wird namentlich an Beispielen
aus der Antike deutlich, z.B. an den beiden sich in ihrer Macht ausbalancierenden
Konsuln
der römischen Republik,
die in Notzeiten einem ernannten Diktator
auf Zeit wichen, oder am Heerkönigtum der Germanen: Nur solange
kriegerische Verwicklungen es erforderten, wählte die Landsgemeinde
einen Herzog als militärischen Leiter, dessen Amt im Frieden wieder endete. Die
germanische Urverfassung ließ für eine Herrschergewalt einzelner keinen
Spielraum. Das Staatsoberhaupt war die Landsgemeinde. Schilderhebung und
vorhergetragene Heerfahne symbolisierten den kriegerischen Charakter des
Amts.
Das Herzogtum bedeutete, verfassungspolitisch
gesehen, den Ausnahmezustand. Es läßt sich allgemein der Satz aufstellen,
daß ein Gemeinwesen umso straffer organisiert sein muß, je existenzieller
eine innere oder äußere Bedrohung ist. Die Einbuße an individueller
Freiheit wird nur hingenommen, solange die Gemeinschaft stark sein muß, um
Leben und Freiheit aller einzelnen zu schützen. So ist Staatlichkeit stets
zweckbezogen, und Zweck kann nur die persönliche Wohlfahrt der einzelnen
Menschen sein. Nie darf hingegen ein System zum Selbstzweck werden, weil
es sich sonst um die Grundlage seiner Legitimität bringt.
Der Gegensatz von zentraler Gewalt des Staats und partikularen
Gewalten durchzieht die deutsche Geschichte wie ein roter Faden. Als das
Heilige Römische Reich unter den Staufern zu einer von außen kaum
angreifbaren Macht gekommen war, schwand im Innern das Bewußtsein,
zusammenhalten zu müssen. Der Fürstenpartikularismus war die Antwort
auf diese neue Lage in einer Zeit, die den christlich-universalistischen
Herrschaftsanspruch schwinden und den "Nominalismus" derer
wachsen sah, die trotzig auf dem Eigenen, Besonderen beharrten. Allerorten
in Deutschland nahm man sich zunehmend die Freiheit, soviel man eben bekommen
konnte, bis die apokalyptischen Szenarien den 30jährigen Krieges wieder zum
absoluten Zusammenfassen aller Kräfte zwangen und der Fürstenabsolutismus
sich durchsetzte.
Die Geschichte bietet das ständig sich wiederholende Bild
der unter dem Ansturm des Freiheitsdurstes bröckelnden Staatsmacht und dem
Gesetz, daß man unter äußerem Druck wieder enger zusammenrücken muß.
Lorenz von Stein
hat das auf die Formel vom
ständigen Stoß und Gegenstoß von Staat und Gesellschaft gebracht und als Inbegriff
des politisch-geschichtlichen Lebens erkannt. Wo sich eine Gesellschaft unter äußerem
Druck nicht rechtzeitig in staatliche Façon zu bringen vermochte, erlag das
Gemeinwesen äußerem Ansturm, und das jeweilige Volk sank vom geschichtlichen
Subjekt zum Objekt des Willens und Handelns anderer herab. So hatte das alte Reich den französischen
Revolutionsarmeen mit ihrer totalitär-demokratischen, alle Kraft ihres
Staates zusammenfassenden Wucht nichts entgegenzusetzen und löste sich
auf. Nach dem Befreiungskrieg sieht das 19.Jahrhundert eine fortwährende
Folge von inneren Liberalisierungen, zunehmende Bürgerfreiheit und abnehmende
Staatsmacht. Diese Tendenz wurde erst unterbrochen, als mit der Weimarer
Republik ein nie dagewesener Tiefpunkt staatlicher Macht erreicht wurde
und breitere Schichten unter bürgerkriegsähnlichen Zuständen und der
offenen Schwäche des Staates nach innen und außen persönlich litten.
Letztlich war es die Angst vor dem geographisch benachbarten
Sowjetmodell und seinen Massenmorden an Klassenfeinden und seinem systematischen
Terror als Mittel der Politik, die eine relative Mehrheit in die Arme
dessen trieb, der alle staatlichen Kräfte anzuspannen versprach, Terror mit
Gegenterror zu brechen.
In der heutigen russischen Presse werden
die Opfer des Bolschewismus in der UdSSR von der Oktoberrevolution bis 1989
auf zwischen 40 Mio. und 100 Mio. Menschen beziffert,
eine historisch singuläre Anzahl. Viele
fanden es 1933 in Deutschland aus Kommunistenfurcht als weniger bedrohlich,
den Staat mit diktatorischen Machtmitteln auszustatten, um die als
potentielle Täter betrachteten Kommunisten in Lager zu sperren;
und selbst ihre offene Ermordung duldete eine schweigende Mehrheit noch.
Nicht aus Lust auf Diktatur formierte Deutschland sich zu Kolonnen,
sondern aus Angst.
Man gab an persönlicher Freiheit dem Staat,
um an Sicherheit vor empfundener Bedrohung zu gewinnen. Wie sehr die
Angst vor dem Sowjetterror ein Motiv eines führenden Nationalsozialisten war,
wird am Beispiel des 'Chefideologen' des 3. Reiches deutlich, dem Baltendeutschen
Rosenberg: "Berichte aus Emigrantenkreisen schilderten die schlimmsten
Greuel der Bolschewisten. Einschließlich der Hungertoten habe die Revolution
35 Millionen Tote gefordert. Schlimmste und brutalste Folterungsmethoden
wurden an die Öffentlichkeit gebracht."
Das Kaisertum bis 1918, die Weimarer Republik, das Dritte
Reich, auch die Bundesrepublik und sogar die DDR waren jeweils in ihrer
Weise mögliche und ihren Zeitgenossen völlig plausible Antworten auf
Existenzfragen ihrer Zeit. Im Regelfall bejahte eine Mehrheit ihr jeweiliges
System. Der Grundfehler unhistorischer Sicht von Vergangenem ist es, die
Lösungen von heute als Maßstab für Probleme von gestern legen zu wollen. Wer
der Rodungsperiode des Landausbaus vom 12. und 13.Jahrhundert nachträglich
aus ökologischen Gründen grollt, hat von den Menschen, der Geschichte und
menschlichen Problemlösungsstrategien ebensowenig verstanden wie
der demokratische Fundamentalist, der nicht begreifen kann, warum es
für eine Mehrheit der Bürger 1914 "nur noch Deutsche" und keine
Parteien mehr gab und warum der Reichstag 1933 das Ermächtigungsgesetz verabschiedete.
Wenn der Magen unserer eiszeitlichen Ahnen knurrte, wurde eben Mammut gejagt
und ausgerottet, und hätten die Eiszeitjäger darauf verzichtet, gäbe es
uns womöglich nicht. Es gibt keine ewig gültigen Problemlösungsstrategien,
also auch keine ewig gültigen Regierungssysteme. Mit Heraklit stellen wir
nüchtern fest: ÐÜíôá ñåé! Alles
ist im Fluß und wird auch immer im Flusse bleiben.
Die Geschichte lehrt die immerwährend erforderliche Anpassung
an klimatische, demographische, kriegerische, geistige, ökologische,
ökonomische und andere Probleme und Überlebensfragen. Indem unsere
gleichgeschaltete Mediengesellschaft auf dem Vulkan tanzt und "Beste
aller Welten" spielt und sich der Geschichtsunterricht für viele Schüler
auf zwölf Historienjahrgänge beschränkt, sind diese Grundtatsachen historischer
Abläufe aus dem allgemeinen Bewußtsein herausgefiltert worden. Darob
stöhnte ein Geschichtsprofessor: "In vielen jungen Köpfen haftet,
sehr zäh-klebrig, ein grauer, amorpher, eben bildloser Platitüdenmatsch,
der gar nichts mit 'Abstraktionsneigung' oder 'Theoriebedürfnis' des modernen
Menschen zu tun hat (ja, das Gegenteil davon ist!), sondern in dem die
Fertigteile der veröffentlichten Meinung mit eigenen, Mißgunst hervorbringenden
Unlust- und Versagenskomplexen verbacken sind. Oft und oft habe ich schon
mit Kummer festgestellt, daß es tatsächlich unmöglich ist, mit Leuten über
den Dreißigjährigen Krieg oder über die Bauernbefreiung in Preußen zu reden,
von 'diskutieren' ganz zu schweigen, die nicht wissen, ob Wallenstein einen
Brustpanzer oder eine karierte Weste trug."
Der Bonner liberale Staat mit seiner parlamentarischen Regierung
ist eine von vielen möglichen Regierungsformen. Solche unterschiedlichen
Formen und Systeme sind in Paragraphen gegossene Problemlösungsstrategien.
Sie regeln das Zusammenleben verbindlich und wollen mit ihrem Regelwerk
zum Nutzen aller die zwischenmenschlichen Beziehungen optimieren und allgemeine
Probleme lösen. Welche Narrheit, zu behaupten, irgendein solches Regelwerk
könne für alle Ewigkeit gelten. Genau das befiehlt aber das Bonner Grundgesetz,
wenn es seinen Kernbereich durch die "Ewigkeitsklauseln" in
Art.79 und 20 als für alle Zeiten unabänderbar erklärt. Welche Hybris! Nach
einer am 29.4.1992 veröffentlichten UNO-Studie wird die Weltbevölkerung
sich bis 2050 auf 10 Milliarden verdoppeln. Die globale Ökokatastrophe,
die ungehemmte Vermehrung der Menschheit und der absehbare Totalzusammenbruch
der Population der Erde, der rasant steigende Einwanderungsdruck nach
Deutschland und die in allen modernen Wirtschaftsgesellschaften zu beobachtende
Unterschreitung der für den Bevölkerungserhalt nötigen Geburtenrate,
und zwar in Deutschland um ein Drittel, das alles stellt uns vor Schwierigkeiten
existentieller Art. Dem Geburtenrückgang "widmeten der Chef des Bonner
'Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft' (IWG), Meinhard Miegel, und seine
Co-Autorin Stefanie Wahl eine 1990 von Bundesforschungsminister
Riesenhuber (CDU) in Auftrag gegebene Studie. Was die beiden Wissenschaftler
...
dabei herausfanden,
ist laut einem Bericht der 'Stuttgarter Nachrichten' derart alarmierend, daß
das Bundesinnenministerium die Veröffentlichung zunächst unterband. Auf
den Punkt gebracht kommen die beiden zu dem Ergebnis, daß unser [...] Volk
mit der Nachkommenschaft derart ins Hintertreffen geraten wird, daß unsere
Kultur zunächst von der fremdländischer Zuwanderer überlagert werden
dürfte, um schließlich ganz zu erlöschen."
Unter dem Druck dieser Probleme wird in absehbaren
Jahren kein Mensch mehr nach dem Kleingedruckten fragen. Wie der Eiszeitjäger
keine Gewissensbisse hatte, als er das letzte Mammut erlegte und - nicht verhungerte,
wird im 21.Jahrhundert so manches ohne Gewissensbisse geschehen, was nicht
in die "unabänderliche" Grundgesetztheorie paßt.
Die verelendeten Milliarden und Abermilliarden
in den verseuchten Slums der Zukunft in Übersee werden nicht zimperlicher
miteinander und mit uns umgehen, als es ihre eiszeitlichen Vorfahren
einmal mit den Mammuten taten. Während Bonn noch immer die Probleme von 1933
bis 1945 "bewältigt", werden uns unsere Enkel einmal verfluchen,
wenn wir ihnen nicht auf diesem kleinen Globus ein Fleckchen hinterlassen,
auf dem sie als Deutsche menschenwürdig werden leben können. Flexibilität
ist also angezeigt.
Zur Zeit ist die genetische, kulturelle und politische
Vielfalt noch die Stärke der Menschheit. Alles Leben ist ein informationsgewinnender
Prozeß und damit eine Anpassungsleistung an wechselnde Umweltverhältnisse.
Einen Verzicht auf diese Anpassung dürfen wir
uns um den Preis unserer Existenz nicht leisten. Wir lieben unsere Art zu leben;
doch ob sie in kommenden Jahrhunderten rückblickend einmal die optimale in
einer ausgeplünderten und übervölkerten Welt sein wird, wissen wir nicht.
Nach dem absehbaren Bevölkerungs- und möglicherweise auch teilweisen Zivilisationszusammenbruch
könnten es auch die Australneger sein, die alles überleben und Ahnherren einer
Menschheit der fernen Zukunft werden. Heute können wir nur die starke Verschiedenheit
der Menschen als Chance begreifen. Es gäbe nicht Gefährlicheres für die
Menschheit, als zu einer Einheitsrasse mit Einheitszivilisation zu verschmelzen,
weil im Falle globaler Katastrophen alle
gemeinsam den Weg der Saurier und Mammute gehen könnten. Wir dürfen uns
nicht alle in ein Boot setzen, denn das Risiko des gemeinsamen Unterganges
wäre zu groß.
Während die genetische Verschiedenheit der Menschenrassen
noch vergleichsweise gering ist, unterscheiden wir uns religiös, zivilisatorisch,
mental und kulturell gewaltig. Die verschiedenen Kulturen gleichen auf
einer anderen Ebene den verschiedenen Rassen der Menschheit und verschiedenen
Arten des Tierreichs. Man spricht hier von Pseudo-Artbildung
.
Wie die Tierarten und die Menschenrassen bestimmte klimatische, geographische
und temporäre Nischen besetzen und sich anpassen, ist auch die Ausbildung
menschlicher Kulturen eine Anpassungsleistung, ein informationsgewinnender
Vorgang. Die Information über die Außenwelt wirkt auf die Kultur zurück und
verändert sie. Dieser Prozeß ist die eigentliche Überlebensleistung und
führte bisher zu stetiger Höherentwicklung des Lebens und der Kulturen. Er
darf nicht enden - um den Preis des Überlebens selbst darf er das niemals.
Unveränderliche äußere Konstanten gibt es in der menschlichen Entwicklungsgeschichte
nicht. Jeder Verzicht auf Anpassung kann nur im Untergang enden, sei
dieser das Aussterben eines Volkes, die Auslöschung einer Kultur oder gar
der ganzen Menschheit. Eine bestimmte Problemlösungsstrategie dürfen wir
unseren Kindern nie als unveränderlich in die Wiege legen; unwandelbar
sind nur die Inschriften von Grabsteinen. "Staaten mit Jahrhunderte oder
gar Jahrtausende alten Regierungstraditionen gehören in die Grabkammern der
Pyramiden."
Der Versuch, über das Grab hinaus zu regieren
und auch die Kinder den eigenen Gesetzen zu unterwerfen, ist die
unverschämteste und lächerlichste Art der Tyrannei.
Das Bonner System will seiner Selbstrechtfertigung nach
systemtheoretisch ein offenes System sein, und auf diese Offenheit ist es besonders stolz. Welch entsetzlicher
Irrtum!
Wirklich offen ist es weder verfassungsrechtlich
noch soziologisch. Nach dem Urteil des Soziologen Erwin Scheuch hat sich
der Bonner Staat zu einem selbstreferentiellen Feudalsystem verfestigt,
dessen "politische Klasse" ein Eigenleben führt, nur noch ihren
eigenen Gesetzen gehorcht und nur demjenigen Zutritt zur Macht gewährt,
der so wird wie sie. Besonders hartnäckig verteidigt sie ihr faktisches
Monopol der Verfassungsgesetzgebung und -auslegung; in ihr stabilisiert
sich der Kernbereich ihrer Macht, den sie wie ein Perpetuum mobile in alle
Zukunft unveränderbar wissen wollen, unveränderbar selbst durch das
angeblich souveräne Volk.
Die liberale Demokratie á la Bonn hat sich in ihrer eigenen
logischen Falle gefangen: Mit Recht erkennt sie das Erfordernis der immerwährenden
Änderbarkeit politischer Lösungsstrategien. Die Möglichkeit der
Veränderung müsse garantiert sein; das System müsse rechtlich und institutionell
immer für bessere Lösungen offen sein.
Das sei in der "pluralistischen Demokratie",
und nur in ihr, der Fall. Daher dürfe alles verändert werden, nur das parlamentarische
System nicht. Die logische Fehlleistung besteht darin, die Veränderbarkeit
dadurch erreichen zu wollen, nur ein System für anpassungsfähig zu erklären,
aber die Veränderung zu jedem anderen System auszuschließen. Flexibilität
und Änderbarkeit werden dadurch aber nicht erreicht, sondern gerade
verhindert. Möglich sind hier nur kleine Korrekturen. Der denkbare Fall
einer tiefgreifenden Änderung, ein wirklicher Systemwandel, soll
verhindert werden. In der Wirklichkeit ändert sich aber sowieso immer
alles irgendwann, ob ein Gesetz es für unabänderlich erklärt oder nicht. Auf
Dauer hält die Realität sich nicht an papierene Verfassungen. Gerade diesen
normalen Prozeß sucht das Grundgesetz mit seinen Ewigkeitsklauseln zu
stoppen. Da der Fortgang der Geschichte sich aber durch Ewigkeitsklauseln
noch nie hat aufhalten lassen, wird die Zeit auch weiterhin über alle angemaßten
menschlichen Eitelkeiten und Ewigkeitsansprüche hinwegschreiten.
Das Rad der Geschichte dreht sich unaufhaltsam weiter. Völker
kommen und gehen - Systeme kommen und gehen. Nur eine Zeitlang kann sich
menschlicher Wille dieser Gesetzmäßigkeit entgegenstemmen: Jede einmal in
den Besitz der staatlichen Machtmittel gelangte Gruppe wird diese festzuhalten
trachten.
Schon Theophrast
bemerkte, der größte
Ehrgeiz der die höchsten Stellen im Volksstaat einnehmenden Männer bestehe
darin, auf Kosten der Souveränität des Volkes allmählich eine eigene zu
gründen.
So sticht auch bei unseren heutigen
Politikern vor allem der Wille hervor, innerhalb ihrer Partei an der Macht
zu bleiben;
und diese Parteien werden nur noch durch den
Willen zur Macht zusammengehalten.
Die Bonner "politische Klasse" versteht
sich als neue Obrigkeit und benimmt sich entsprechend. Jede
Organisation, jede Bürokratie, neigt nach Murphys Gesetz zu ihrer eigenen
ständigen Erweiterung. Die Organisation ist die Mutter der Herrschaft
der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber, der
Delegierten über die Delegierenden.
Eine dauernde Vertretung wird unter allen
Umständen zu einer dauernden Herrschaft der Vertreter führen.
Diese Dauer wird erreicht durch die bleibende
Parteiorganisation mit ihrer Macht über die einzelnen Abgeordneten.
Ein Postenverteilungskartell auf Dauer hat jenen ständig notwendigen
Innovationsprozeß zum Stillstand gebracht, weil die Parteien als gesellschaftliche
Subsysteme nicht sterben, wie ein grauhaariger alter Monarch, sondern wie
ein Krebsgeschwür immer weiter wuchern und Metastasen bilden. Sie durchdringen
in ihrem Machthunger immer weitere Bereiche von Staat und Gesellschaft
und gehorchen nur noch ihren eigenen Gesetzen. Ihre Repräsentanten
gehören zum selben Menschentypus, der als Parteibonze der NSDAP oder der
SED oder als kaiserliche Hofschranze (usw. usf.) in trauriger Erinnerung
ist. Weil es sie immer geben wird, und weil sie immer ihre und nicht unsere Probleme lösen werden, muß entweder ein System erfunden werden, in dem
das Wohl der Regierenden mit dem der Regierten denknotwendig identisch ist
- oder, da es ein solches System mutmaßlich nicht gibt - braucht das Land gelegentlich
einen tiefgreifenden Tapetenwechsel. Dieser muß die alte, abgelebte Machtelite
zurückdrängen und unverbrauchten Kräften den Aufstieg ermöglichen.
In der Monarchie hatte für die notwendige Entrümpelung ausgedienten
Personals alle paar Jahrzehnte die natürliche Lebenspanne des Monarchen gesorgt.
Nach dem Tode Friedrich Wilhelm I., des Soldatenkönigs, Friedrichs d.Gr.
oder im Dreikaiserjahr 1888 wurde erst einmal "alles anders": Der
Thronfolger setzte den ungeliebten Ratgebern und Ministern eines ungeliebten
Vaters den Stuhl vor die Tür. So konnten und mußten verknöcherte, überlebte
Strukturen verändert und durch zeitgemäße ersetzt werden. Eine monarchische
Herrschaftsordnung konnte, wie im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation,
Jahrhunderte überdauern und doch in ihrem Innern laufend mutieren.
Der Liberalismus meint von sich selbst, ein offenes System
zu sein und sich ständig verändern und Zeitproblemen anpassen zu können. In
diesem Kern seines Anspruchs ist er durch die Wirklichkeit widerlegt.
Anpassungsfähig ist er nur in den Methoden zur Erhaltung und Stabilisierung
seiner eigenen Macht. Ein Gemeinwesen kann sich aber immer nur eine bestimmte
Zeitlang ein System leisten, dessen Führungsoligarchie eine geschlossene
Gesellschaft bildet, nur noch ihren Gesetzen gehorcht und als Minderheit
auf Kosten des Ganzen schmarotzt. Soll das Ganze nicht schweren Schaden
nehmen, erzwingen die Verhältnisse einen Systemwandel zur Ablösung der alten
Machtelite und Durchsetzung eines Politikwechsels. Der Elitenwechsel
pflegt nicht eine völlige Auswechslung der gesamten Führungselite zu sein,
sondern ein Prozeß der Verschmelzung stets neuer Anwärter mit vorhandenen
Eliten. Die Revolutionäre von heute werden dann die Reaktionäre von morgen.
Die Bundesrepublik hat sich schon zu lange
vor grundsätzlich neuem Denken und nonkonformistischen Geistern abgeschottet.
Irgendwann muß unweigerlich der Zeitpunkt kommen, an dem die Verhältnisse
neue Lösungen erzwingen und andere Menschen sie durchsetzen werden, oder
das Gemeinwesen zusammenbrechen wird.
Systeme sind nicht für Ewigkeiten da. Sie müssen die ständig
erforderliche Innovation an Gedanken und Problemlösungsstrategien gewährleisten,
die permanente Evolution. Verfassungen als juristisch fixierte Problemlösungskonzepte
müssen sich zwangsläufig wandeln können und mit den Problemen kommen und
gehen. Da offenbar jedes System zum Gegenteil neigt, nämlich zum
Beharren auf sich selbst und auf vergangenen Perspektiven, muß notfalls im Abständen
ein ganzes System über Bord geworfen und ersetzt werden, um den unabdingbaren
Wandel zu erzwingen. Das gilt gegebenenfalls für jedes System. Wo es
verhindert wird, befindet das Gemeinwesen sich in höchster Gefahr.
Manchmal kommt sogar "der Untergang von Staaten daher, daß sich ihre
Verfassungen nicht mit den Zeitnotwendigkeiten ändern."
Der Wechsel der Staatsformen ist aufgrund
der sich ändernden Zweckmäßigkeiten "nötig, da es bisher noch nicht
gelungen ist, dem Gemeinwesen eine Ordnungsform zu geben - zumal nicht
von Beginn an -, die allen Herausforderungen im Politischen begegnen
kann; und der Wechsel der Staatsformen aufgrund der unveränderlichen
menschlichen Grundkonstanten ist leider unvermeidbar, da sich weder der
Mensch ändern noch ein Gemeinwesen errichten läßt, das alle zufriedenstellt."
Die Überzeugung Strukturkonservativer,
soziale Institutionen, die lange Zeit überlebt haben, müßten notwendigerweise
nützlich für die Gesellschaft sein, ist falsch.
"Der Baum der Freiheit", sagte
schon Thomas Jefferson,
"muß von Zeit zu Zeit
mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen aufgefrischt werden."
Wie weiße Mäuse im Labor den Ausweg aus einem künstlichen Labyrinth
suchen und immer wieder in Sackgassen scheitern, suchen die Menschen mit
all ihrem Scharfsinn den Weg aus dem Labyrinth der politischen Möglichkeiten.
Die Hauptstraßen heißen Monarchie, Aristokratie und Demokratie, und von
ihnen zweigen unzählige Nebenwege und kleine Pfade nach "rechts"
und "links" ab, aber auch nach oben oder unten. Jeder Abzweig des
Labyrinths steht für ein Denkmodell, eine rational ausgeklügelte Strategie,
die Probleme des menschlichen Zusammenlebens in den Griff zu bekommen. Die
meisten Varianten sind nach dem Prinzip von "Versuch und Irrtum"
schon ausprobiert und in irgendeiner historischen Situation einmal verworfen
worden. So erstarb nach 1918 das Interesse am monarchischen Gedanken, 1945
empfand man den Nationalsozialismus als widerlegt, und in den 1980er
Jahren erlosch die Faszination des marxistischen Denkgebäudes.
Weil der liberale Parlamentarismus das Glück hatte, weder
1945 militärisch besiegt noch 1989 wirtschaftlich bankrott gegangen zu sein,
feiern seine Verfechter ihn als geschichtlichen Kulminationspunkt und
als vermutliches Ende der Geschichte überhaupt. Der derzeit bekannteste
Vertreter dieser These, Francis Fukuyama,
sieht die menschliche Entwicklung
als lineare Entwicklung mit einem Anfangs- und Endzustand an, und diese Linie
soll natürlich aufwärts führen. Ähnlich Hegel
und Marx
sieht Fukuyama Geschichte
als zwangsläufigen Geschehensablauf von den steinzeitlichen Bauernkulturen
über die Monarchien bis zu einem glücklichen "Endzustand" vor seinem
geistigen Auge abrollen, und damit sei der Ausgang aus dem Labyrinth
endlich erreicht.
Das hört sich logisch an, vor allem, wenn man zufällig in
einem liberalen Staat, einer liberalen Weltgegend und einer Zeit lebt, die
gerade den Zusammenbruch des konkurrierenden Sowjetsystems erlebt hat.
Solche "goldenen Zeitalter" hat es schon öfter gegeben: Die Antike
erinnerte sich des ihren; Wilhelm II. hat uns "herrlichen Zeiten" entgegengeführt;
1933 brach ein "tausendjähriges Reich" an; 1949 nahm in der SBZ die
Arbeiterklasse "für alle Zeiten" das Heft in die Hand und rottete
den Kapitalismus "unwiderruflich" aus. Fukuyamas "Ende der Geschichte"
beginnt es vor unseren Augen ähnlich zu ergehen. Kaum war die bipolare Erstarrung
der Welt in feindliche Blöcke überwunden, setzte die "beendete"
Geschichte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit wieder in Gang. Ihre
Stationen hießen "Freiheit des Baltikums", Irakkrieg und Zerfall
Jugoslawiens, und auch das ist nur der Anfang. Vor unseren Augen beschleunigt
der Lauf der Geschichte sich in einem Maße, wie es die nach dem 2. Weltkrieg
geborenen Generationen noch nicht erlebt haben.
Der Lauf wird sich weiter beschleunigen. Zwischen den Völkern
war schon immer Krach vorprogrammiert, wenn in armen, übervölkerten Ländern
die Ressourcen knapp und durch Klimaänderungen der Bodenertrag geringer
wurde, während in erreichbarer Entfernung andere Völker im Überfluß lebten.
Das blutige Aufeinanderprallen der Verzweifelten nennen wir heute verharmlosend
"Geschichte". Damals hatte es für die Menschen unbeschreibliches
Elend bedeutet. So hatten sich 2000 v.Chr. aus der Gegend nördlich des
Schwarzen Meeres nach einer langen Dürreperiode
die Indoeuropäer erobernd in alle Himmelsrichtungen
in Bewegung gesetzt und einen der nachhaltigsten Schübe von
"Geschichte" ausgelöst. Ähnliches hatte sich ab 300 n.Chr. mit der
Völkerwanderung ereignet, der das Imperium Romanum erlag; und es wiederholte
sich um 13. Jahrhundert, als die Mongolen weite Teile der eurasischen Landmasse
eroberten und unzählige Völker und Kulturen unter den Hufen ihrer Pferde zerstampften.
Alle Voraussetzungen für ein so stürmisches Zeitalter liegen
heute wieder vor: Die Menschheit verdoppelt sich in immer kürzeren Abständen.
Die heute schon hungernden überseeischen Völker vermehren sich auf Kosten
der Natur in solchem Ausmaße, daß das Ende dieser Natur in wenigen Jahrzehnten
vorauszusagen ist. Unmittelbar nach dem Kahlschlag und der Vernichtung der
natürlichen Lebensgrundlagen wird es zu einem Bevölkerungszusammenbruch
dramatischen Ausmaßes kommen. Elend, Desorganisation, Bevölkerungswachstum
und menschliche Unfähigkeit, die Probleme aus eigener Kraft zu lösen, bilden
heute schon einen Teufelskreis, und es deutet selbst für Optimisten wenig
darauf hin, jemand könnte plötzlich einen Stein der Weisen finden und diese
Tendenzen umkehren. Die Bevölkerungsvermehrung in Ländern, deren Bewohner
sich heute schon nicht selbst ernähren können, wird die Wirkung eines altägyptischen
Heuschreckenschwarmes entfalten und die Lebensgrundlagen dort restlos
vernichten. Dann werden die Hungernden und Frierenden zu uns in die nördlichen
Länder kommen wollen, und zwar alle, weil sie keine andere Wahl haben. Ende
der Geschichte? Nein, es geht erst richtig los! Die Lunte brennt, und aller geschichtlichen
Erfahrung nach wird sich die Ladung kriegerisch entladen.
Fukuyamas Thesen leiden unter einem entscheidenden Fehler:
Sie setzen voraus, daß die natürlichen Ressourcen auf unabsehbare Zeit Wirtschaftswachstum
und Aufrechterhaltung der westlich-industriellen Wirtschaftsform ermöglichen.
Er gibt selbst zu, der liberale Parlamentsstaat, den er Demokratie nennt,
sei (nur) für die marktwirtschaftlich entwickelten Industrieländer angemessener
als jede andere Regierungsform.
Tatsächlich sind Marktwirtschaft und Parlamentarismus
nur verschiedene, aus dem Liberalismus folgende Aspekte seines umfassenden
metaphysischen Systems. Gerade darum ist abzusehen, daß die Krise des auf
Wachstum beruhenden marktwirtschaftlichen Kapitalismus nicht ohne Auswirkung
auf die politische Organisationsform bleiben kann.
Die Grenzen des Wachstums sind absehbar, weil die natürlichen
Ressourcen begrenzt sind. Welche Form des Wirtschaftens in einer künftigen
Welt angemessen und effizient sein wird, in der die primären Rohstoffe erschöpft
sind und in der ein globaler Bevölkerungszusammenbruch einen Neubeginn
erzwungen hat, können wir nur ahnen. Eines aber ist sicher: Es kann keine Rede
davon sein, daß es zwangsläufig beim liberalen, auf Wachstum und freiem
Kapital- und Warenverkehr beruhenden Wirtschaftssystem bleiben muß. Eher ist
zu vermuten, daß der in einigen Jahrzehnten kommende Kollaps dieses
Systems eine Höherbewertung unverbrauchbarer Güter wie Grund und Boden und
damit eine grundlegend andere Wirtschaftsordnung erzwingen wird. Für diese
muß der liberale Parlamentsstaat dann aber nicht mehr die "angemessenste"
(Fukuyama) politische Form sein.
Die existentiellen Bedrohungen der Menschheit sind dem Liberalen
bewußt. Für die Situation des europäischen Kulturraumes gegenüber der
sogenannten zweiten und dritten Welt hat er weniger Gespür. Vollends blind
ist der deutsche Liberale gegenüber dem Willen von Deutschen, auch künftig
in deutscher Weise - was auch immer sich der einzelne darunter vorstellen
mag - zu leben. Dasselbe gilt für französische, belgische oder italienische
Liberale entsprechend. Der Liberale will zuallererst Kosmopolit sein,
und wenn er deutsch ist, leidet er besonders darunter, vielleicht nicht genug
Weltbürger zu sein, und macht das durch überbetonten Internationalismus
wett.
Jedes politische und gesellschaftliche System gibt Antworten
nur auf ganz bestimmte, als drückend empfundene Fragen. Wo das eine Konzept
seine Stärken hat, weist das andere Lücken auf. Eine Herrschaftsordnung, die
alle denkbaren Probleme in gleich befriedigenderer Weise zu lösen
vermöchte, hat es noch nicht gegeben. So gibt auch der Liberalismus nur Antworten
für Menschen mit ganz spezifischen Interessen und nur auf ganz bestimmte
Fragen; andere Probleme nimmt er als solche überhaupt nicht wahr.
Funktionell ist der typisch liberale ökonomische Reduktionismus nichts weiter
als die Herrschaftsideologie der ökonomisch Starken gegenüber den ökonomisch
Schwachen. Sie redet ihnen ein, das freie Walten rein ökonomischer Gesetze
führe auch zu ihrem Vorteil, und diesen Vorteil sieht er ausschließlich im
Geldverdienen: So bezeichnet Fukuyama ihn ganz richtig als dasjenige
"Regelsystem, in dem das materielle Eigeninteresse und die Anhäufung
von Reichtum als legitim gelten."
Überdies verharrt er als historisch bedingte Antwort des
Bürgertums des 19. Jahrhunderts in einer naiven Animosität gegen alles
Staatliche, was als situationsbezogene Reaktion auf die vergangene
Zeit des Fürstenabsolutismus auch einmal sinnvoll gewesen war. Alles
liberale Pathos richtet sich rein destruktiv gegen das, was der Liberale
als Einengung seines persönlichen Freiraumes empfindet,
aber nie konstruktiv auf eine Sache. Der Liberale
ist ein Wesen der Negation: Er will die Abwesenheit von staatlicher
Zensur, die Aufhebung strafrechtlicher Verbote wie dem der Majestätsbeleidigung,
der Kuppelei, der Homosexualität, der Unzucht mit Kindern, der Abtreibung,
des Ehebruchs.
Dagegen ist es noch keinem Liberalen gelungen, einmal positiv
zu bestimmen, wofür er eigentlich eintritt außer für seinen Anspruch, ungehemmt
seinen Eigeninteressen nachzugehen. Der Liberalismus und seine Inkarnationen,
die Marktwirtschaft und der Parlamentarismus, sind Antworten auf Fragen
von vorgestern, nämlich als übermächtig empfundene staatliche Machtentfaltung.
Sein Rezept erschöpft sich in der Stereotype, den Staat möglichst machtlos
und gering zu halten. Weil aber ohne Schutz eines neutralen Staates der
Starke immer stärker, der Reiche immer reicher und der Mächtige immer
mächtiger werden wird, führt der reine Liberalismus zwangsläufig in eine
wölfische Gesellschaft. Völlige gesellschaftliche Freiheit und Gleichberechtigung
führen immer dazu, daß sich der Stärkere durchsetzt. Damit wird die Freiheit
aller anderen zur grauen Theorie.
Die liberale Theorie befaßt sich eingehend mit dem Problem
der Herrschaft: "Wer soll regieren?" Sie will innergesellschaftliche
Konflikte regulieren und die Gesellschaft trotz aller Gegensätze zusammenhalten,
weil sie das ganz einfach für "vernünftig" hält.
Das war's dann auch schon. Der Liberalismus
stellt eine Theorie zur Minimierung staatlicher Funktionen dar, und in
manchen historischen Situationen schadet das auch nicht so bald. Dagegen ist
das Wertegerüst des Liberalen denkbar mager: "Laß doch jeden machen,
was er will!", lautet sein Credo. Eine Gesellschaft der Wölfe schreckt
ihn nicht; und "Jeder gegen jeden" ist sein Lebenselixier. Für
überindividuelle Sinnfragen ist er vollständig blind, und zwar ganz bewußt.
Jeder soll nach seiner Façon selig werden. Gegen
eine multikulturelle Gesellschaft aus Muselmanen, Christen, Atheisten und
Satansanbetern hätte der Liberale keine prinzipiellen Einwände, solange
ihm niemand aus religiös-rituellen Gründen das Geldverdienen verbieten
würde. Wichtig ist ihm nur das autonome Individuum.
Wenn Deutschland durch den Geburtenrückgang Einbrüche in
seine Infrastruktur erleidet, füllt er die demographischen Lücken eben mit
"Beutedeutschen" auf, mit Einwanderern aus aller Herren Länder.
So benötigt er Einwandererkinder aus Übersee, weil er keine bessere Idee
hat, eine Kindergärtnerin vor Arbeitslosigkeit zu bewahren. Als Deutsche
kommen wir im liberalen Vokabular gar nicht vor: Wir sind für ihn auf unsere
Rolle als Verbraucher reduziert, als Rentenbeitragszahler oder Pendler, Erwerbstätige
oder Pflegebedürftige, als Wähler oder Anlieger. Deutsche? Nicht nötig:
Alles das kann ein Ausländer ja ebensogut. Deutschland? Nur noch mit dem
vorgesetzten Hauptwort "Wirtschaftsstandort"! Als höhere Idee
oder als Land unserer Väter, dem unsere Liebe und unsere Sehnsucht gelten,
kann er Deutschland selbst in seinen schlimmsten Alpträumen noch nicht einmal
denken. Der Liberale ist der politische Spießbürger, wie ihn Max Weber genannt
und beschrieben hat: ein Menschenschlag, dem die großen Machtinstinkte
fehlen, der charakterisiert ist durch die Beschränkung des politischen
Strebens auf materielle Ziele oder doch auf das Interesse der eigenen
Generation und durch das fehlende Bewußtsein für die Verantwortung
gegenüber unserer Nachkommenschaft.
Der Liberale hat kein Lösungskonzept für Fragen der Identität,
des Wunsches der meisten Deutschen, für sich und ihre Nachkommen ein Leben
im Einklang mit ihren überlieferten Vorstellungen und Traditionen führen
zu wollen; ein Leben, in dem nicht die Heimat zur Fremde wird. Das alles
interessiert den Liberalen überhaupt nicht. Ebenso schwerhörig ist er, wenn
es um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen unserer Umwelt geht.
Staatliche Einschränkungen unternehmerischer Freiheit? So wenig wie möglich!
Die eigennützige Vermehrung seines Geldes gilt ihm mehr. Daß mit jedem Zuwanderer
nach Deutschland weiterer Straßenbedarf entsteht, Wohnraum und Infrastruktur
geschaffen werden müssen, ist ihm willkommen und erfreulich, weil es das
Bruttosozialprodukt fördert. So dürfen wir von ihm Antworten immer nur im
Rahmen seines gedanklichen Koordinatensystems erwarten. Dessen Eckpunkte
sind die Abwehr alles dessen, was er als staatliche Bevormundung fürchtet,
und die einzige für ihn interessante Zukunftsfrage lautet, wer dereinst
einmal seine Rente zahlen wird.
Alle diese Feststellungen sind nicht nur aus der Theorie des
Liberalismus abgeleitet, sie entsprechen auch genau den Beobachtungen,
die wir als Bürger dieses Staates in den vergangenen Jahrzehnten machen
durften; denn so lange schon sitzen liberale Fundamentalisten in Gestalt der
FDP in jeder Bundesregierung, flankiert von mehr oder weniger liberalen
Politikern der beiden Großparteien mit ein wenig sozialer oder christlicher
Tünche. Das innere Wesen der Bundesrepublik ist ebenso wie ihr äußeres
Erscheinungsbild tief durch den Liberalismus geprägt. So erklärt sich ein
jahrelanger, scheinbar unerklärlicher Drang zur "Mitte". Diese ist
das typisch liberale Wertevakuum: Während die Gedanken der Linken hauptsächlich
um das Problem der Gleichheit kreisen, die mit universalistischen Gedankenentwürfen
angestrebt wird, und während sich die Sorgen der Rechten um die Bewahrung der
Unterschiedlichkeit und um Konzepte zu ihrer Erhaltung bewegen, kreist und bewegt
sich beim Liberalen gar nichts. Lösungsstrategien für Fragen, die er gar
nicht versteht, kann er auch nicht entwickeln. Sein Schlachtruf lautet nur:
Weiter so, Deutschland!
Im Parlamentarismus sieht er die politische Form, die universalistische
Gleichheit und die partikulare Besonderheit miteinander in einem
austarierten Gleichgewicht zu halten. Keines dieser Prinzipien soll das
andere völlig vernichten,
alles weitere läßt ihn kalt. Als Hüter alles
Besonderen, Eigentümlichen, Wertvollen oder Einzigartigen ist der Liberale
völlig ungeeignet, weil er zu dessen Verteidigung keinerlei ethisches
Rüstzeug besitzt und den Werten anderer verständnislos-gleichgültig
gegenübersteht. Im Gegenteil tendiert das freie Spiel der Kräfte, jener
Wettbewerbsgedanke als Kern des liberalen Weltbildes, zu universaler
Verflachung und Einebnung der Unterschiede durch die Dominanz des jeweils
Stärkeren und die Verdrängung des Kleinen und Schwachen. Der Liberalismus
ist nicht der Hüter des Gleichgewichts zwischen Allgemeinem und Besonderen,
sondern Motor der weltweiten Gefährdung der Einzelvölker und -kulturen
durch eine umfassende Weltzivilisation nach Vorbild der erzliberalen Gesellschaft an sich, den USA.
Es mangelt nicht an Vorschlägen, die bekannten und von Liberalen
durchaus zugegebenen Mängel des Parlamentarismus durch systemkonforme
Verbesserungen zu beheben. Mangels gedanklicher Durchdringung der strukturellen
und systematischen Gründe der Misere sind diese Vorschläge realitätsfern.
Schon ein Vergleich des deutschen mit ausländischen Parlamentarismen zeigt
aber, daß dieselben Strukturprobleme in den meisten Ländern zur selben Krise
geführt haben.
Am meisten haben Korruption und mangelnde Gemeinwohlorientierung
wohl Italien heruntergewirtschaftet. Schwarzrote Vetterlnwirtschaft und
vollständiges Aufsaugen aller öffentlichen Ämter durch die großen Parteien
haben in Österreich zu massiven Stimmengewinnen der FPÖ und damit der
Partei geführt, die ausdrücklich gegen den schwarzroten Filz und die
Vereinnahmung des Staates durch die Parteien antritt. In Belgien hat sich
der Liberalismus als unfähig erwiesen, einen für alle Volksgruppen annehmbaren
Modus vivendi zu finden, Flamen und Wallonen dauerhaft zu integrieren und
zu einer höheren, "belgischen" Einheit zu verschmelzen. Kein Wunder:
ist er doch zu überindividueller Sinnstiftung seinem Wesen nach unfähig
und nimmt nur Gesellschaften und Bevölkerungen wahr, aber keine Völker.
Die Kritik am Zustand des Parteiensystems in Deutschland und
Vorschläge zu seiner Veränderung werden aus Kreisen seiner grundsätzlichen
Befürworter, der "Parlamentaristen",
auf zwei Ebenen vorgetragen: Den machtpolitisch nicht unmittelbar interessierten
Verfassungsrechtlern, Soziologen und Politologen stehen die am System
nutznießenden Praktiker aus den Reihen der Parteien gegenüber. Die liberale
politische Theorie erkennt die zunehmende Inkompetenz der praktischen
Parlamentspolitik zur Problemlösung und sucht nach Reformstrategien. Je
geeigneter dieser zur Problemlösung sind, desto weiter führen sie aber von
liberalen Glaubenssätzen weg. Diese verkörpern sich im verfassungsrechtlichen Parlamentarismus im engeren Sinne.
Eine Anwendung geeigneter Reformen würde aber die bewährten Notbremsen
gegen den befürchteten Machtverlust lockern, und so werden sie von den
Parlamentaristen in den tonangebenden Parteien wohlweislich nicht angerührt,
für deren Aufstieg ein sicherer Machtinstinkt notwendiges Auslesekriterium
war.
Alle systemkonformen Verbesserungsvorschläge drehen sich um
die Themenkreise Parteienfinanzierung, "Entflechtung von Staat und
Parteien" und "strukturelle Erneuerung der politischen Führung".
Der unmittelbare Zugriff auf Haushaltsmittel und vor allem auf die Ämtervergabe
des Staates bildet die doppelte Basis der Parteienmacht. Hier setzen liberale
Reformvorschläge an:
Ein ganzer Chor von Kritikern appelliert an die Parteiführer, sich in einer
Art freiwilliger Selbstbescheidung auf ihre von der Verfassung zugewiesene
Rolle zurückzuziehen. Dies würde nach Art.21 GG bedeuten, an der
Willensbildung des Volkes nur mitzuwirken und diese nicht zu monopolisieren.
Sogar Biedenkopf und Engholm fordern eine Selbstbeschränkung der Parteien
zur Stärkung ihrer Akzeptanz.
Vierhaus
stellt sich tatsächlich vor,
die Parteien könnten freiwillig eine drastische Reduzierung ihrer
Staatsfinanzierung zulassen und eine effektive Kontrolle darüber installieren.
Die Staatsfinanzierung soll auf ein verfassungskonformes Maß reduziert
werden, indem außer den direkten Zuwendungen (Wahlkampfkostenerstattung,
Sockelbeträge, Chancenausgleich usw.) auch die indirekten Zahlungen in
die Berechnung der Staatsquote einbezogen werden. Diese ist der staatliche
Anteil an der Parteienfinanzierung und darf nach ständiger Rechtsprechung nicht über dem Eigenfinanzierungsanteil
liegen.
Bereits heute wird aber das verfassungsrechtliche Verbot für
die Parteien, sich überwiegend aus Staatsmitteln zu finanzieren, nur
durch organisatorische Tricks eingehalten: Die Parteien haben nämlich
einen großen Teil ihrer Organisation, beispielsweise ihre "Denkfabriken",
in Form rechtlich selbständiger Parteistiftungen ausgegliedert, die
staatlich finanziert werden, bei der Berechnung der Staatsquote aber
formell nicht mitzählen. Das gilt auch für die Milliardensummen, die
jährlich in Form von Diäten unzähliger Abgeordneten auf Bundes-, Landes-
und Kommunalebene an Parteivertreter nebst Fraktionszuschüssen, Dienstwagen,
wissenschaftlichen Mitarbeitern und anderen Extras gezahlt werden und
deren rechnerische Einbeziehung in die Staatsquote Vierhaus zu Recht
fordert.
Mit jedem dieser Ausgabenposten ist aber ein menschliches
Schicksal verbunden, nämlich die persönliche Versorgung eines Parlamentariers
oder von ihm abhängigen Angestellten. Schon die angesichts der Haushaltslage
von Bundeskanzler Kohl im April 1992 angekündigte Kürzung der Ministergehälter
war nicht durchsetzbar, und eine freiwillige Selbstbeschränkung der Parteienmacht
wird immer wieder an deren gegengerichtetem Eigeninteresse scheitern. So
realistisch sieht das auch das BVerfG, wenn es ausführt, "ähnlich wie
bei der Festlegung der Bezüge von Abgeordneten und sonstigen Inhabern
politischer Ämter ermangelt das Gesetzgebungsverfahren" im Bereich
der Parteienfinanzierung "regelmäßig des korrigierenden Elements gegenläufiger
politischer Interessen."
Kurz: Bei der Diätenerhöhung ist man sich
ebenso einig wie beim Zugriff der Parteivertreter auf Haushaltsmittel.
Vor allem aber darf der liberale Parteienstaat seinen Zugriff
auf Ämter und Versorgungsposten um den Preis seines Machterhalts nicht
aufgeben: Jede Partei ist bestrebt, ihrer Organisation eine möglichst
breite Machtbasis zu geben. Die Parteiherrschaft ist eine Herrschaft
weniger; wenn diese Wenigen aber zu wenige werden, gerät sie in Gefahr, von
der Mehrheit nicht Privilegierter aus den Angeln gehoben zu werden. Sie muß
daher bestrebt sein, möglichst viele Elemente auch finanziell an sich zu
fesseln
und die Speerspitze des Widerstandes gegen
ihre Macht personell und durch Geldzuwendungen ins Parteiensystem
einzubinden und damit ruhigzustellen.
Dazu sind die Parteien auf den ungeschmälerten
Zugriff auf den Staatshaushalt auf Gedeih und Verderb angewiesen. So
wurden die GRÜNEN seit ihrem Einzug in Länderparlamente und Bundestag Jahr
für Jahr ruhiger, und als sie 1989 anläßlich der Parteienfinanzierung zum
Bundesverfassungsgericht klagten, wollten sie diese nicht etwa beseitigen.
Sie forderten nur einen "gerechteren", also einen größeren, Happen
für sich selbst.
Der Zugriff auf den Staatshaushalt ist eine der Säulen der
Parteienmacht, und das wissen ihre Vertreter so genau, daß sie einschneidende
Änderungen auf keinen Fall zulassen werden. Würden sie anders handeln,
wäre ihre Macht bald gebrochen, und ein Abschneiden der Parteien von den
staatlichen Geldhähnen würde in einen Zusammenbruch des Parteienstaates
in seiner jetzigen Form einmünden. Da die Parteien das wissen, werden sie es
nie zulassen. So resigniert Vierhaus letztlich: "Da es sich bei der Krise
des Parteienstaates um ein staatsrechtliches und politisches Problem handelt,
reichen rechtliche Ansätze keinesfalls aus, zumal jedenfalls die Gesetzesänderungen de facto von der Zustimmung der
Parteien abhängig sind."
Von Arnim
empfiehlt als außerrechtlichen
Ausweg den Druck der öffentlichen Meinung. Doch noch immer haben die
Parteien schnell durch neue, versteckte Haushaltstitel wieder hereingeholt,
was ihnen der eine oder andere aufgedeckte Skandal an Geldzuflüssen verschüttete.
Auch ihre nach Parteiproporz handverlesenen Vertreter im
Karlsruher BVerfG wissen, was sie den Parteien schuldig sind, die sie zu Verfassungsrichtern
gemacht haben: Weil die Parteien in Art.21 GG als Mitwirker an der politischen
Willensbildung des Volkes nebenbei erwähnt sind, hält das BVerfG ihre "herausgehobene Stellung im Wahlrecht"
für nötig und ihre Funktion als "Wahlvorbereitungsorganisationen"
für die demokratische Ordnung für unverzichtbar. Sie seien berufen, die
Bürger freiwillig zu politischen Handlungseinheiten mit dem Ziele der Beteiligung
an der Willensbildung zu den Staatsorganen organisatorisch zusammenzuschließen
und ihnen so einen wirksamen Einfluß auf das staatliche Geschehen zu ermöglichen.
Abweichend von seiner bisherigen Rechtsprechung erklärte das Gericht 1992
erstmals eine Basisfinanzierung der Parteien bis zu einer Staatsquote von
50% für verfassungsgemäß. Neuerdings dürfen die Parteien also ganz offen
ihre allgemeine Parteiorganisation staatlich bezahlen lassen und werden
damit von staatlich ausgehaltenen Kanzlerwahlvereinen faktisch zu einem
Teil der Obrigkeit - und führen sich gegenüber dem Bürger und konkurrierenden
Parteien entsprechend auf.
Die Theorie, das liberale Repräsentativsystem könne sich
durch finanzielle Selbstbeschränkung der Parteien selbst stabilisieren,
verkennt die grundlegende Bedeutung des Zugriffs der Parteien und ihrer
Vertreter auf die Staatsfinanzen. Die naiv-optimistische Idee, die Nutznießer
eines Systems könnten freiwillig den Ast absägen, auf dem sie bequem sitzen,
widerspricht aller Erfahrung. Schon Proudhon
hatte beobachtet, daß die
Volksvertreter, sobald sie in Besitz der Macht gelangt sind, sofort ihre
Macht zu stärken und auszubauen beginnen, ihre Stellung unaufhörlich mit
neuen Schutzmaßregeln umgeben und sich von der Botmäßigkeit gegenüber den
Vertretenen endgültig zu befreien suchen. Diese Befreiung ist ihnen im selbstreferentiellen
Bonner System vollständig gelungen, weil dieses nur noch seinen eigenen Gesetzen
- ihren Gesetzen! - gehorcht. Eine Chance, dieses System zu reformieren,
besteht daher nur an den Parteien und Parlamenten vorbei,
die seine Nutznießer sind.
Es mangelt auch nicht an wohlmeinenden Ratschlägen, daß die
Parteien die Symptome der Ämter- und Mandatshäufung reduzieren und den
Elitenaustausch vorantreiben sollten. An klaren und konkreten Konzepten,
wie die Parteien dieses Traumziel denn aus sich selbst heraus erreichen
könnten, fehlt es indessen. "Auffallend ist außerdem, daß die
Parteiforschung die schon länger geführte Reformdebatte kaum analytisch
begleitet."
Hilflos werden an die Politiker gerichtete
Forderungskataloge mit den schönsten Wünschbarkeiten vorgelegt: Die Parteien
dürften nicht mehr alle Lebensbereiche kolonisieren, müßten sich der Gesellschaft
öffnen, und die Orientierung der Politik an "Gemeinwohlinteressen"
müsse wieder zur Richtschnur des Handelns werden.
Nirgends war zu lesen, wie wir es denn
anstellen sollen, die Damen und Herren Parteioligarchen zu gemeinwohlorientiertem
Handeln zu veranlassen. Über lamentierendes Wehklagen und eine Zustandsbeschreibung
des real existierenden Parlamentarismus ist die Politikforschung der
Nachkriegszeit selten hinausgekommen. Dagegen kann nur die analytische
Einsicht in das vorhandene Krisengeflecht die Möglichkeit zu einem
sinnvollen, intensiv reflektierten Neuanfang bieten.
Bei der Aufstellung der Kandidaten auf Wahllisten haben die
Parteien ein Nominierungsmonopol. Die Auswahl des gesamten politischen
Personals ist in ihre Hände übergegangen.
Während sich das BVerfG in rührender Weise um
die Parteien sorgt, diese dürften nicht "in verfassungsrechtlich nicht
hinnehmbarer Weise vom Staat abhängig" werden, verliert es kein Wort über den tatsächlichen
Zustand der Erbeutung des Staats durch die Parteien. Die übliche Verknüpfung
und Häufung von Staats- und Parteiämtern hat zu einer massiven Unterwanderung
aller staatlichen Ebenen durch Parteifunktionäre geführt, die im Zweifelsfall
ihrer Partei zum Dank für den innegehaltenen Posten verpflichtet sind und
diesen Dank durch Parteiloyalität und vorauseilenden Gehorsam in Sachfragen
wieder abstatten. Damit bilden sie einen Staat im Staate, und bei der ihnen
zugemuteten zwiefachen Loyalität bleibt die Treue zum Gemeinwohl zwangsläufig
zurück, wenn die Wiederwahl oder der Verbleib in einem Amt von der
Parteigunst abhängen und nicht von staatlichen Leistungsmaßstäben.
Über die Amtsfunktionen üben die Parteien nach außen Macht
aus, und nach innen dient ihr Vergabemonopol dazu, die Amtsträger an die Partei
zu binden. Diese Übelstände zu beklagen, ist bereits Allgemeingut
geworden. Bei häufig fehlender Fachkompetenz verdanken viele Amtsträger
ihre Macht nur ihrer Partei. Damit ist ihr Wohl und Wehe untrennbar mit
dem Status quo des Parteienstaats verbunden. Hier setzen Reformvorschläge
an und fordern die Besetzung von Ämtern nach Qualifikation und die Ergänzung
der Führungsschicht durch Fachleute,
als ob das nicht durch Art.33 GG ohnehin geltendes Recht wäre. Nach Leistung
aber werden die maßgeblichen Machtpositionen in Deutschland schon lange
nicht mehr besetzt, und das beginnt schon beim Studiendirektor.
Als unabdingbar zur Befreiung des Staats aus der Parteienknebelung
wird auch die Trennung von Staats- und Parteiämtern erkannt. So fordert
Scheuch die Trennung von Partei- und Fraktionsamt; Beamte und Journalisten
sollen keine Partei- und Wahlämter mehr bekleiden und Mandatsträger und Politfunktionäre
nicht mehr in Aufsichtsgremien von Betrieben der öffentlichen Hand gewählt
werden dürfen. In derselben Tendenz verlangt Vierhaus die
Aufbrechung des Blocks von Regierung und Fraktion durch Inkompatibilität
von Regierungsamt (einschließlich Ministerialbürokratie) und Abgeordnetenmandat.
Vollends an die Herrschaftsinstrumentarien
der Parteiführungen geht Scheuch,
wenn er innerparteiliche
Blockwahlen verbieten will, was in der Tendenz des Hamburgischen
Verfassungsgerichtsurteils 1992 gegen die CDU liegt; wenn Scheuch Kandidaten
nach öffentlicher Vorstellung ihres beruflichen Werdeganges durch alle Parteimitglieder
ihres Wahlkreises und wenn er Oberbürgermeister unmittelbar von der Bevölkerung
wählen lassen sowie die Zahl der Abgeordneten drastisch senken will.
Doch wo der Hydra des Parteienstaates unter öffentlichem
Rechtfertigungsdruck ein Haupt abgeschlagen wird, pflegen sieben neue
nachzuwachsen. Ein beliebtes Mittel der Verniedlichung ist es, den Eindruck
rein menschlichen Fehlverhaltens einzelner weniger Parteifunktionäre
zu erwecken, diese abzuhalftern und den "Skandal" damit als erledigt
abzutun. Auch die parlamentarische Opposition sitzt in solchen Fällen gewöhnlich
mit im selben Boot und hat daher kein großes Interesse, Systemänderungen
anzumahnen, die sie selbst mit benachteiligen würden.
Nach Möglichkeit versuchen die Parteien ohnehin, Reformvorschläge
zu blockieren und totzuschweigen. So berichtete Scheuch über die Reaktionen
der Spitzenpolitiker auf die Erstveröffentlichung seiner Studie: Diese
reichten von Umarmen ("...wertvolle Anregungen ... ganz nett ... Wir beschäftigen
uns seit langem mit Reformen...") über Wegtauchen bis zu Beschimpfungen
und offenen Drohungen. Trotz enormen Medienechos auf die Studie und
kopfnickender Zustimmung bei politischen Altenteilern ist weder bei den
Bonner Parteien noch bei der derzeitigen Bundestagskommission zur Reform des
Grundgesetzes etwas von Absichten ruchbar geworden, am bestehenden massiven
Zugriff der Parteien auf alle Bereiche der Staatlichkeit etwas zu ändern.
Es gibt keinen systemimmanenten Ausweg aus dem Teufelskreis
der Machtausübung und Selbstbegünstigung der Parteien, die dieses System
geschaffen haben und durch ihre Vertreter im Bundestag immer wieder allein
über seinen Fortbestand entscheiden. Mit anderen Abgeordneten, die nicht
ihrer Partei botmäßig, sondern tatsächlich dem ganzen Volk innerlich
verpflichtet und nur ihrem Gewissen verantwortlich wären, ließe sich die
Übermacht der Parteien brechen und ließen sich systemkonforme Vorschläge
eines Scheuch oder eines Vierhaus leicht zum Gesetz machen.
Nur ihrem Gewissen verantwortliche Abgeordnete gibt es nur
in der Verfassungstheorie. Soziologisch und menschlich erklärbare Zwänge
hindern auch gutmeinende Politiker praktisch daran, nur nach ihrem
Gewissen zu handeln. Weil diese Zwänge ganz überwiegend struktur- und
systembedingt sind, kann ein Politiker innerhalb dieser Strukturen oft
gar nicht anders handeln, wenn er nicht zum tragischen Helden werden will.
Aber "nicht nur, daß es an Helden fehlt,
die Tabus brechen und ungewohnte Freiheit schaffen könnten. Man sieht nicht so
recht, was eine Person überhaupt ändern kann und wie ein Durchgriff durch das
dichte Gespinst der Institutionen, Rechte und Gewohnheiten erfolgen
könnte."
Faktisch muß der von seiner Partei über das
Instrument der Listenwahl entsandte Abgeordnete immer in erster Linie
seiner Parteiräson unterworfen bleiben, weil diese seine Wiederaufstellung
in der Hand hat. So ist das wirtschaftliche Schicksal der Politiker mit dem
ihrer Partei verknüpft.
Der Teufelskreis ist perfekt und entspricht der These
Scheuchs, nach der das System nur noch seinen eigenen Gesetzen gehorcht. Das
Hauptgesetz ist das der Machtausdehnung auf immer weitere Bereiche des
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, und nicht etwa das wünschenswerte
Gegenteil weiser Selbstbeschränkung. Vielmehr lebt das System geradezu davon,
daß immer weitere Kreise korrumpiert werden. Es gewährt nur noch denjenigen Zugang zur
Machtelite, die dieser Elite opportun erscheinen. Sie kooptiert immer wieder
nur systemangepaßte Mitläufer und stabilisiert
sich so fortwährend selbst. Die Bonner "politische Klasse" kann
nicht einfach zurück, wie Richard von Weizsäcker vorschlug. Sie muß immer
weitere Lebensbereiche politisieren
und ihren ökonomischen Einfluß auf die Ämtervergabe
und andere Pfründenweiden systematisch vergrößern, um ihre Gefolgsleute
an sich zu binden.
Wie sich ein Mensch nicht an den eigenen Haaren aus einem
Sumpf ziehen kann, so kann sich das auf Vorteilnahme gegen Parteitreue beruhende
Feudalsystem des Parteienstaats nicht aus sich selbst heraus regenerieren.
Der Trend fettfleckartiger Ausbreitung geht ungebremst in die falsche Richtung.
Die Parteipolitiker als maßgebliche Gesetzgeber werden keine Verfassungsänderungen
vornehmen, die ins Fleisch der Parteienmacht wirkungsvoll einschneiden würden.
Alle Forderungen z.B. Scheuchs nach weiser Selbstbeschränkung der Parteien
stehen folglich in Widerspruch zu seiner eigenen These, daß das System
selbstreferentiell ist und nur noch seinen eigenen Gesetzen gehorcht. Es
folgt daraus und aus diesen Gesetzen zwingend, daß es aus sich selbst heraus
reformunfähig ist. Das System ist das System der Parteien, und "nichts
deutet darauf hin, daß die Staatsparteien des Parteienstaates sich selbst
demokratisieren können."
Seinen Mängeln durch bloße Appelle an die
Politiker abzuhelfen, erscheint ziemlich hoffnungslos, denn die Mängel
sind systembedingt.
Es muß der liberalen Theorie als Mangel vorgehalten
werden, daß sie diesem offenen Dilemma nicht zu entrinnen vermag. Während
Scheuch auf der einen Seite Reformvorschläge macht, die als Gesetzesänderungen
nur von Parteipolitikern verwirklicht werden können, und fordert, daß
System auf Bundesebene zu beseitigen, gibt er an anderer Stelle zu, er
sehe keine Chance zur Beseitigung "dieser Mafia-Strukturen" aus
den Parteien selbst heraus. Wer denn aber als Deus ex machina den Teufelskreis durchbrechen soll, bleibt offen.
Wenn das System tatsächlich selbstreferentiell ist, kann es
nur von Kräften aufgebrochen werden, die seinen Gesetzlichkeiten nicht unterliegen.
Solange seine Spielregeln alle derartigen Kräfte erfolgreich von jedem Wirksamwerden
fernhalten können, kann es sich möglicherweise noch Jahrzehnte so weitermogeln,
trotz des schon vor über 30 Jahren ausgerufenen "Endes des Parteienstaates"
.
Er muß aber das Schicksal aller Systeme teilen, die aus einer
"Institution evidenter Wahrheit" zu einem bloß technisch-praktischen
Mittel geworden sind:
einer Staatsform, die man nicht liebt, sondern
nur benutzt, weil keine bessere zur Hand ist. Das Bonner System,
weltanschaulicher Substanz weitgehend entkleidet, hatte sich selbst durch
seine Funktionstüchtigkeit legitimiert; und diese ist angeschlagen.
Bietet sich eine Alternative mit Lösungskompetenz
für die drängenden existenziellen Probleme, die das abgenutzte System
nicht löst - zeigt also jemand, daß es auch anders geht - ist das alte System
erledigt.
Während der Liberalismus in der Theorie noch ganz bescheiden
von sich selbst denkt, war das rationalistische Selbstverständnis unserer
linken Freunde jahrzehntelang von keinerlei Zweifel angekränkelt. Seit 1989
ist man auch links bescheidener geworden. In einem Wettbewerb aber liegt man
Kopf an Kopf: Dem Ehrgeiz, das politische Modell der Modelle abzugeben und
mit ihm die Tür zur "One World" aufzustoßen. Die nächste Tür soll
dann gleich zum Paradies führen. Was dem überzeugten Liberalen Fukuyamas Ende
der Geschichte im weltweiten Sieg des Liberalismus ist, erhoffte man links
von Karl Marxens klassenloser Gesellschaft und dem weltweiten Sieg des Sozialismus
- auch eine Art "Ende der Geschichte".
Der marxistisch-leninistische Sozialismus hat soeben hinter
sich gebracht, was dem Liberalismus noch bevorsteht: das Scheitern an der
Realität. Nach dem totalen Zusammenbruch des Ostblocks ist dem dogmatischen
Sozialismus noch nicht einmal mehr die Hoffnung geblieben. Sein Gedankengebäude
ist in sich zusammengesackt wie die östlichen Volkswirtschaften, die ihm
zu lange ausgesetzt waren. Es bietet das demütigende Schauspiel eines
allumfassenden gedanklichen Entwurfs, einer in sich geschlossenen
Ideologie, die ihren eigenen Anhängern wie Sand unter den Händen zerrann,
als sie praktisch angewendet werden sollte. Die fortschreitende Verelendung
der Proletariermassen, die Revolution zuerst im entwickeltsten Industrieland,
der Übergang von der Revolution über den Sozialismus in den klassenlosen
und staatlosen Kommunismus, die Überlegenheit über den Kapitalismus, die
Aufhebung der "Entfremdung" - auf all das hat man hundert Jahre
lang vergeblich gewartet. Niemand kann tiefer fallen, als der umjubelte
Prophet, dessen Prophezeiung nicht eintrifft.
Wie immer, wenn ein großes Gebäude zusammenbricht, geht das
nicht ohne viel aufgewirbelten Staub ab. Die ideologischen Versatzstücke
der extremen Linken verwehen heute wie eine große Dreckwolke. Sie haben in
sich keinen Halt mehr, aber ideologisch heimatlos gewordene linke
Nostalgiker klammern sich an sie. Da wäre z.B. die Mär von den
"humanistischen Idealen" jener Diktatur des Proletariats, die in
den 70 Jahren ihrer Existenz zwischen 40 und 100 Mio. Gegner umgebracht
hat. Auch das seit der französischen Revolution umgehende Gespenst der
"egalité" ist noch nicht gebannt, obwohl in jedem real existierenden
Sozialismus immer einige wenige noch "gleicher als die anderen" waren
und die Gleichheit aller übrigen sich gewöhnlich als Gleichheit in Unterdrückung,
Not, Verzweifelung und im Schlangestehen entpuppt hat. Solange noch
irgendwo auf der Welt ein Buschmann oder Indio nicht "gleich" ist,
solange noch irgendwer "privilegiert" ist, wird ein eingefleischter
Linker von jener merkwürdigen Unruhe umgetrieben werden, die im Neid
ihren tiefsten Grund hat.
So gibt es nach der Implosion der marxistisch-leninistischen
Dogmatik kein in sich geschlossenes linkes Konzept mehr, sondern nur noch
umherwabernde, tiefsitzende Ressentiments, die mal hier über linken Stammtischen
ausbrechen, mal da bei einer autonomen Demo handfesten Ausdruck finden,
immer aber in den geschlossenen Gesellschaften und in sich abgekapselten
Zirkeln zu finden sind, die sich um marxistische Lehrstuhlinhaber an den
Universitäten gebildet haben, in den verhaschten Szenekneipen des grünen
Milieus, an den Hebeln und Mikrofonen der Macht des Medienstaates und hinter
den Kathedern unserer Schulen. Kurz: überall da, wo man von den Sorgen
und Ängsten der arbeitenden Normalbürger nichts weiß.
Alles das sei den Linken verziehen, ja selbst ihr rabiater
Antifaschismus, den sie als integratives Moment ihrer zerfallenden Strukturen
ebenso brauchen, wie die Rechte ihre Feindbilder pflegt. Unverzeihlich ist
aber jene geistige Einöde, die der gefallene linke Dogmatismus hinterlassen
hat. Die Kinder der Alt-68er sind so humorlos wie ihre schmalbrüstige Ideologie
witzlos. Wo jene 1968 auf Gymnasium oder Uni mit dem geistigen Florett auf
Muff von tausend Jahren losgingen, schwingen ihre gesamtschulgeschädigten
Erben nur noch die Faschismus-Keule.
Die Restbestände linker Publizistik sind
langweilig geworden. Keine Spur blieb von jenem Einfallsreichtum und
Esprit der 68er Revoluzzer. Blättert man heute in linken Postillen, stößt
man vornehmlich auf eine Mischung von Dritteweltschmerz, Antifaromantik
und gefühliger Minderheitenduselei. Der Mensch in Rousseaus "gutem"
Naturzustand schläft in jedem gesellschaftlich ausgegrenzten Schwulen,
steckt in "der" unterdrückten Frau wie dem rechtlosen Asylanten
und erwacht schließlich im politischen Linken. Wer die Welt so sieht, darf
von linker Systemveränderung die alles gleichmachende Lösung der Inferioritätsprobleme
irgendwelcher Minderheiten erhoffen, mehr nicht.
Wie die rotgrüne heile Welt aussehen soll, hat die Landtagsfraktion
der SPD und der GRÜNEN in einem gemeinsamen Entwurf einer neuen Verfassung
für Niedersachsen einmal exemplarisch Punkt für Punkt aufgeschrieben: An die
Spitze der Präambel, ja - gleich da, wo im Grundgesetz noch der liebe Gott angerufen
wird - tritt das "Bewußtsein der sich aus der deutschen Geschichte ergebenden
besonderen Verantwortung", besonders wegen der "in der Zeit des
Nationalsozialismus begangenen beispiellosen Gewalttaten."
Nach dieser Demonstration moralischer Erhabenheit und
innerer Katharsis geht es dann gleich auf in die schöne neue Welt: "Das
Land, die Gemeinden und die übrigen Träger der öffentlichen Verwaltung sind
verpflichtet, die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter in allen gesellschaftlichen
Bereichen herzustellen und zu sichern. Der Gleichberechtigungsgrundsatz
läßt zur Förderung von Frauen und zum Ausgleich tatsächlich bestehender
Ungleichheit vorübergehende rechtliche Bevorzugung von Frauen zu"
(Art.2/3).
In allen gesellschaftlichen Bereichen? Wir
lesen richtig: in allen! Und der Staat ist zur Herstellung der
"gleichberechtigten" Teilhabe verpflichtet. Freuen wir uns also auf
die von der zuständigen Kreisverwaltung ausschwärmenden rotgrünen BlockwartInnen,
die "in allen gesellschaftlichen Bereichen" für Ordnung sorgen.
Mit der Männerwirtschaft in Junggesellenvereinen, Burschenschaften und Männerchören
wird dann einmal richtig aufgeräumt. Endlich werde ich Mitglied im Landfrauenverband
werden dürfen. Zum Gerichtspräsidenten, Generalstaatsanwalt oder
Schuldirektor wird es aber in absehbarer Zeit nicht mehr langen: Bevor da
wieder irgendein Mann zum Zuge kommt, sind erst einmal viele, viele Frauen
dran.
Wer keiner "Minderheit" angehört, wird im
rotgrünen Nirwana nichts zu lachen haben; lesen wir doch weiter in Art.2/3
des Verfassungsentwurfs: "Kein Mensch darf wegen seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Zugehörigkeit zu einer sprachlichen oder ethnischen
Minderheit oder Nationalität, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugungen,
seiner sexuellen Identität, seines körperlichen oder seelischen Zustandes
oder seines Alters benachteiligt werden. Rechtliche Bevorzugungen zum
Ausgleich tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig." Der
logische Kurzschluß ist umfassend. Überall da, wo einer bevorzugt wird, wird
nämlich ein anderer benachteiligt, denn zum Bevorzugen gehören immer zwei:
der Vorgezogene und der Zurückgesetzte. So wird das rotgrüne Bevorzugungsmodell
zum Zurücksetzungsmodell für alle die, die nicht das Privileg einer der
so schön aufgezählten "tatsächlich bestehenden Ungleichheiten"
besitzen. Es sind eben doch immer manche "noch gleicher" als die anderen.
Geradezu paradiesischen Zeiten gehen kulturelle und
ethnische Minderheiten in Niedersachsen entgegen: Art.2/5 will sie
unter den besonderen Schutz und die Förderung des Landes stellen. Da es
eingeborene ethnische Minderheiten in Niedersachsen nicht gibt, kommt dieses
Versprechen vornehmlich den 102396 Türken zugute, der nach der Volkszählung
1989 mit weitem Abstand stärksten "ethnischen oder kulturellen Minderheit
im Lande." Das deutsche Volk kommt in der Wunschverfassung
der Regierungskoalition dagegen nicht mehr vor; auch wird bei Wahlen und
Abstimmungen die Beschränkung auf deutsche Staatsbürger wegfallen.
Dagegen soll ein neuer Abschnitt der Verfassung ein umfassendes Recht der
"Einwohnerinnen und Einwohner" auf Volksbegehren und Volksentscheid
begründen. Damit diese aber nicht auf die Idee kommen, das Bevorzugungsmodell
und die Minderheitenförderung wieder abzuschaffen, regelt Art.32/2 vorsichtshalber:
"Verfassungsänderungen, die den in Art.2 dieser Verfassung niedergelegten
Grundsätzen widersprechen, sind unzulässig."
Die nötige Zurückdrängung des Gesellschaftlich-Parteilichen
aus dem Staatswesen kann ein Verfassungskonzept nicht leisten, das ein ideologisches
Modell der Gesellschaftslenkung zur Pflicht des Staates und "aller
Träger der öffentlichen Verwaltung" macht. Der Staat kann als Instrument
weltanschaulicher Gesellschaftsveränderung nur benutzt werden, wenn
er von der lenkenden Partei umfassend kontrolliert wird und mit ihr eine
symbiotische Verbindung eingeht. Schon für Karl Marx war der Staat stets
und ausschließlich das Werkzeug der herrschenden Klasse. Diese Verbindung
kann auf der personalen Ebene nur eine solche Personalunion von Parteifunktionären
und Staatsdienern sein, wie sie auch im liberalen Postenverteilungskartell
der CDUSPDFDP gegenwärtig ist. Das hat die Linke schon seit über 20 Jahren
erkannt. Sie hat konsequenterweise die Strategie entwickelt, das System
der wechselseitigen Durchdringung von Parteien und Staat nicht abzuschaffen,
sondern in einem langen Marsch durch die Institutionen von innen zu erobern.
Die einzige von linker Seite aktuelle "Lösung" unserer Probleme
soll also darin bestehen, daß das Bonner Politestablishment, beschäftigt
vor allem mit seinem eigenen Machterhalt, zurückgedrängt oder abgelöst
werden soll durch hochideologisierte rotgrüne Kader. Daß deren
"Vertretung des Gemeinwohls" besonders in der Bevorzugung von
Minderheiten bestehen, also gerade nicht dem Wohle aller dienen würde,
macht der niedersächsische Verfassungsentwurf rechtzeitig deutlich. Ihnen
sind Minderheiten vor allem dann willkommen, wenn sie in deren Namen eine
Moral zur Geltung bringen können, deren Vollstrecker allein sie sind.
Der radikal egalitäre Ansatz zum Umbau der Gesellschaft soll
auch in Staatszielbestimmungen zum Ausdruck kommen, deren Einfügung in
die Verfassungen von linker Seite seit Jahren gefordert wird. Daß der Staat
für eine gesunde Umwelt und die Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen
eintreten soll, hält sich noch im Rahmen des gegenwärtigen Verfassungsverständnisses.
Wenn darüber hinaus aber gefordert wird, der Staat solle von Rechts wegen auf
Gewährleistung von Wohnraum, Arbeit oder einen Kindergartenplatz verpflichtet
werden, müßte er dafür zunächst einmal über die Wohnungen, die Arbeits- und
die Kindergartenplätze verfügen. Den Weg in ein staatliches Arbeits- und
Wohnungswesen wird aber in Deutschland nach den Erfahrungen in er DDR
sicherlich keine Mehrheit wieder zurückgehen wollen.
Die Bonner Republik leidet bereits heute an einem
strukturellen Mangel ihrer Führungsschicht an Gemeinwohlorientierung; diese
Elite ist selbstreferentiell auf ihre Machterhaltung fixiert, und darum
ist das ganze System nicht flexibel genug für die heute schon sichtbaren
Problemfelder der nächsten Jahrzehnte. Der von der Linken angestrebte Systemwandel
würde diese Mängel verschlimmern statt beheben: Minderheitenbevorzugung
statt Gemeinwohlorientierung schafft eine tendenziell instabile politische
Lage und kann die Probleme des Ganzen schon vom gedanklichen Ansatz her
nicht lösen. Die Linke ist nach ihrem eigenen Selbstverständnis immer
Partei, nie Walterin des Gemeinwohls, und zwar Partei der jeweils Unterlegenen,
Schwächeren, Unterprivilegierten oder "Ausgebeuteten". Der
Emanzipation dieser Menschen gilt ihre Hauptsorge sowie dem, was sie unter
Gleichberechtigung versteht. Im Besitz des Staates wird sie seine Machtmittel
immer für ihre Klientel gegen die aus ihrer Sicht Privilegierten wenden.
Darin erschöpft sich ihr Wollen; hier liegen die Grenzen ihrer Kompetenz.
Aber gibt es dieses hier oft bemühte Ganze überhaupt? Über
den Realitätsgehalt von Gattungsbezeichnungen und Oberbegriffen läßt
sich trefflich streiten: Ist "das deutsche Volk" eine reale,
personal und zahlenmäßig abgrenzbare, tatsächlich existente Größe? Oder
ist "Volk" nur ein stimmlicher Hauch, nichts als ein leeres Wort,
eine Schablone des Verstandes; und sind nur alle konkreten, faßbaren Einzelmitglieder
dieses Volkes wirklich real?
Für wie real man solche Kollektivbezeichnungen hält, ist
nicht nur eine allgemein erkenntnistheoretische, sondern auch eine Frage
der subjektiven Wahrnehmung und damit des persönlichen Standortes. Ohne vorherige
abstrahierende Entscheidung, was als konkret zu gelten habe, ist eine Aussage nicht möglich, etwas Bestimmtes sei konkret.
Letztlich entscheiden Machtbedürfnisse die Frage, was in politicis als
abstrakt und was als konkret jeweils zu gelten hat.
Dem Familienvater ist seine Familie eine
höchst reale Sache, und analog zu ihr mag er seine Sippe, seinen Stamm und
das ganze Volk für reale Größen halten. Mit seiner Frau verbindet ihn
unendlich mehr, als er sich an Gemeinsamkeiten zwischen ihr und allen anderen
Frauen vorstellen kann. "Frauenfragen", womöglich gemeinsame
Interessen "aller Frauen", übersteigen sein Vorstellungsvermögen.
Sein Ordnungsdenken bewegt sich gewissermaßen in vertikalen Bahnen.
Die erlebten sozialen Strukturen beginnen bei seiner Familie und gipfeln
in seinem Volk. Ihm ist diese Sichtweise evident, und "Familie"
entspringt seinem realen, täglichen Erleben. Sie ist für ihn eine wirklich
vorhandene höhere Einheit. So wie der "Mensch mehr ist als die Summe
seiner Atome, der Glieder, Organe und Säfte, aus denen er besteht, ist
eine Ehe mehr als Mann und Frau, eine Familie mehr als Mann, Frau und Kind.
Eine Freundschaft ist mehr als zwei Männer und ein Volk mehr, als durch das Ergebnis
einer Volkszählung oder durch eine Summe von politischen Abstimmungen zum
Ausdruck gebracht werden kann."
Das Ganze ist mehr ist als die Summe seiner
Teile, weil das aufeinander bezogene Zusammenwirken an sich selbständiger
Systeme zu einem Gesamtsystem neuer, und zwar höherer Art mit gänzlich neue
Systemeigenschaften führt.
Aus diesen zwischenmenschlichen Bindungen sucht das linksemanzipatorische
Denken sich loszulösen und sieht die entscheidenden Gemeinsamkeiten
eher horizontal: nämlich zwischen zum Beispiel der Frau - der Frau von nebenan - allen Frauen oder dem Arbeiter - dem Kollegen - der
Arbeiterklasse. Gegenüber der "rechten" Wahrnehmung von Mann,
Frau und Kindern als konkrete Familie sieht die "linke" Weltsicht über eheliche Liebe und
Blutsverwandtschaft hinweg und verknüpft, rein rationalistisch,
Abstrakta zu Oberbegriffen. Meine Frau, die Kassiererin von nebenan,
die Indiofrau aus dem Fernsehbericht von gestern abend und Alice Schwarzer
werden so wegen gewisser anatomischer
Übereinstimmungen zu einem höheren Ganzen vereint: "die Frauen" - Welch scheußliche Vorstellung! - Ähnliches
müssen Millionen von Menschen aller Herren Länder über sich ergehen
lassen, die sich überhaupt nicht kennen, aber für die Arbeiterklasse oder ähnliche Trugbilder vereinnahmt
werden, und weitere "horizontale" Personengesamtheiten von
Menschen, die sich überhaupt nicht kennen und nicht einmal entfernt verwandt
sind. Einem Menschen schlechthin,
spottete schon de Maistre
, sei er noch nie im Leben begegnet.
Er habe nur Franzosen, Italiener, Russen usw. gesehen. Auch Bonald
hatte der aufklärerischen
Linken vorgeworfen, Menschen nur individuell wahrzunehmen und ihnen mit
der "Menschheit" einen rein abstrakten Bezugspunkt zu geben, nur
um ihre traditionellen und für sie grundlegenden Bindungen an Familie,
Stand und Nation zu zerstören. Die Linke hat keine Erklärung für die
Paradoxie, die Solidarität der Menschheit zu behaupten und zugleich die des
Volkes und der Familie zu leugnen, "was behaupten heißt, daß die Feinde
Brüder sind und die Brüder keine sein dürfen."
Unser Volk und sein Wohl, das "Gemeinwohl" des
Staatsvolks also, ist für die Linke keine maßgebliche Größe. Ihr
gedanklicher Weg führt vom autonomen Individuum über die Klassen- oder Geschlechtszugehörigkeit
gleich zur "Menschheit". Dieser universalistische Anspruch
bringt den politischen Vertretern der Linken einen entscheidenden taktischen
Vorteil: Der abstrakte Gedanke einer einheitlichen und in ihrer Einheit
und Universalität an universelle Normen gebundenen Menschheit dient dazu,
den konkreten deutschen Staat einer ethischen Idee wie der
"Gleichheit" zu unterwerfen und somit die Position jener zu stärken,
die sich als berufene Interpreten dieser universellen ethischen Idee empfehlen.
Unter diesem Aspekt argwöhnen wir mit Carl Schmitt: "Wer Menschheit
sagt, will betrügen." Der Betrug besteht darin, daß die selbsternannten
Hohepriester universalistischer Menschheitsansprüche Unterwerfung unter
ihre Moralforderungen mit dem hinterlistigen Nebeneffekt beanspruchen, zugleich
ihr Interpretationsmonopol dieser Menschheitsmoral und damit ihre weitere
Priesterherrschaft zu akzeptieren.
Für uns Ungläubige stellt sich dagegen die elementare
Frage, warum wir ausgerechnet an eine universelle Moral glauben sollen,
die offenkundig mit unseren Gegnern oder Konkurrenten im Bunde ist. Die Berufung
auf universelle Gleichheitsphrasen führt nämlich neben der Unterwerfung
unter ihre berufenen Interpreten zu unserer ideologischen Selbstentwaffnung
gegenüber allen jenen millionen Erdenbewohnern, die täglich in ihren Heimatländern
verhungern, erfrieren oder Kriegen ausgesetzt sind und die unter Pochen
auf abstrakte Menschenrechte gern in Deutschland ernährt, gewärmt, behaust
und beschützt werden möchten. Wer also die
Frauen, die Arbeiterklasse oder die Menschheit für real und
nicht nur für Worte hält, bloß stimmlichen Hauch, mag getrost versuchen,
die Probleme der Frauen oder der Menschheit zu lösen. Wer dagegen
seine Familie und sein Volk als Realitäten wahrnimmt, wird in linken Konzepten
keine Lösungsansätze für deren Gefährdung finden.
Schwerer noch als der Mangel an Gemeinwohlorientierung in bezug
auf das deutsche Volk und den deutschen Staat wiegt der Wille der Linken zu radikaler
Gesellschaftsveränderung. Er führt zu einem entscheidenden Minus an Freiheit
und Flexibilität. Der beabsichtigte Gesellschaftsumbau zugunsten der
Unterlegenen und zulasten der Privilegierten läßt sich nur mit staatlichen
Lenkungsmechanismen durchführen. Die Partei der Unterprivilegierten muß
personell und strukturell in den Rock des Staates wie in eine Handpuppe
schlüpfen und sich seiner bedienen. Die notwendige Trennung von Staat und Gesellschaft
als Vorbedingung menschlicher Freiheit wird dadurch nicht erleichtert, sondern
unmöglich gemacht. Die Benutzung des Staates durch das liberale Postenverteilungskartell
wird ersetzt durch seinen Mißbrauch durch "sozialistische" Gesellschaftsumbauer.
Während dort liberale Pöstchenhaie vor lauter Intrigieren um ihre Karriere
und Pfründen nicht zum Nachdenken über das Gemeinwohl kommen und ein
statisches System zirkulierender Machtcliquen gebildet haben, wollen
sich hier eifrige Gesellschaftsingenieure als Anwälte von Minderheiteninteressen
in den Sattel setzen. Auch sie werden nicht umhin können, ein geschlossenes
System zu bilden und sich vor Machtkonkurrenz abzusichern, denn
erfahrungsgemäß hat es die Mehrheit nicht gern, wenn die Herrschenden zulasten
der Mehrheit eine Minderheit bevorzugen.
Es ist das unbestrittene Verdienst der radikalen Linken, das
Plebiszit als Instrument der Delegitimierung des Repräsentativsystems
wiederentdeckt zu haben. Erfunden haben sie es nicht. Sie brauchten nur
Carl Schmitt
aufzuschlagen, der 1932
formuliert hatte: "Jede Konkurrenz von Gesetzgebern verschiedener Art
und einander relativierenden Gesetzesbegriffen zerstört [...] den Gesetzgebungsstaat selbst." In diesem herrschen Vorrang und Vorbehalt
des Gesetzes; er ist letzter Hüter allen Rechts, letzter Garant der
bestehenden Ordnung, letzte Quelle aller Legalität. Letzte Sicherheit und
letzter Schutz gegen Unrecht sind der Gesetzgeber und das von ihm gehandhabte
Verfahren der Gesetzgebung. Der Staat könne nur einen Gesetzesbegriff haben,
nur einen Gesetzgeber, ansonsten werde er durch innere Widersprüche zerstört.
So gesehen stellt die Konkurrenz der Volksgesetzgebung
mit der parlamentarischen den Versuch einer Fortentwicklung auf das utopische
Ziel einer Demokratie dar und damit einen gezielten Angriff auf die
Legitimationsgrundlagen des rein parlamentarischen Gesetzgebungsstaates
schlechthin.
Die radikale Linke hält das Volk für immer gut, den
Magistrat aber für korruptibel. Sie will das Repräsentationsprinzip zugunsten
eines basisdemokratischen Herrschaftssystems, z.B. nach dem Rätemodell,
völlig abschaffen. Ihre Strategie der Demokratisierung ist eine Strategie
der Systemüberwindung. Daß Demokratie und Parlamentarismus einander
ausschließen, hat die radikale Linke erkannt und nützt die Achillesferse
der Bonner Republik gnadenlos aus: die Lebenslüge, hinter dem schönen
Etikett "Demokratie" verberge sich wirkliche Demokratie. Ohne
den demokratischen Gedanken konsequent verwirklichen zu können, tragen
die Parlamentaristen das Wort von der Demokratie ständig wie eine Monstranz
vor sich her und verbuchen sie in ihrem Guthaben unter den tragenden Werten.
Die linke Strategie der Systemüberwindung hatte sich dieses Wertes des parlamentarischen
Systems bemächtigt und zum Angriff auf es selbst umfunktioniert. Daher greifen
seine systemimmanenten Abwehrmechanismen nicht.
Die ganze Eigenlegitimation des Bonner
Staates beruht dermaßen auf dem Demokratieprinzip, dieses ist so sehr
weltanschaulich überhöht und quasireligiös funktionalisiert worden, daß
es bei Strafe gesellschaftlicher Acht und Banns nicht in Frage gestellt
werden darf. Der hinterlistigen Forderung nach mehr Volksabstimmungen
und -entscheiden kann ohne Verstoß gegen das demokratische Dogma nichts
entgegengehalten werden. Wir wollen uns das gut merken; vielleicht erweist
sich diese Strategie noch an ganz unerwarteter Stelle als tauglich.
Wer heute von "Demokratie" spricht, muß dazu
sagen, was er eigentlich meint. Auch Sozialismus und Mitte, fortschrittlich, liberal oder faschistisch, alle diese vormals
terminologisch abgrenzbaren Termini technici sind zu lange mißbraucht und
abgenutzt worden: als Schlachtruf der eigenen Reihen im Kampf um Positionen
und Begriffe oder auch als Schmähwort für den jeweiligen Gegner. Auch zu
dem Wort rechts, das zunächst eine
Richtung anzeigte, mag dem einen oder anderen ganz Unterschiedliches
einfallen, zum Teil sich begrifflich Ausschließendes, wie konservativ oder reaktionär, nationalistisch oder faschistisch. Da verschiedene
aller dieser sogenannten Rechten meist einig sind über das, was sie für die von ihnen vertretenen Werthaltungen
als bedrohlich empfinden, aber durchaus uneins darin, was dagegen zu unternehmen
sei, müssen wir die rare Spezies etwas genauer betrachten.
Für unsere Überlegungen fruchtbar können nicht die
mannigfachen Ansichten zu irgendwelchen einzelnen Werthaltungen oder Tagesproblemen
sein, sondern nur die zum "System" bezogene Position. Diese reicht
von vorbehaltloser Bejahung bei nationalliberalen Rechten bis zur
heftigen Ablehnung bei Nationalsozialisten. Im wesentlichen lassen sich
drei Hauptmeinungen ausmachen: Die große Mehrheit möchte das parlamentarische
System beibehalten, in ihm zur Mehrheit werden und ihre Wertvorstellungen
zur Regierungspolitik machen. Eine Minderheit sieht ihre völkischen Vorstellungen
nur in einem ebensolchen Staatswesen verwirklicht, und eine noch kleinere
Minderheit will das System verändern, aber nicht aus Sehnsucht nach einem
totalitären Führerstaat, sondern, weil sie das parlamentarischen System
für prinzipiell unfähig hält, dem Gemeinwohl Rechnung zu tragen.
Sie spielt im rechten Gettotheater den tragischen Part. Ihre
Anhänger stammen meist aus bürgerlichen Verhältnissen und wären nie auf
die Idee gekommen, etwas anderen als CDU oder SPD zu wählen, wenn Adenauer
noch Kanzler oder Schumacher noch Oppositionsführer wäre. Sie verstehen
die Welt nicht mehr. Alles könnte doch so schön sein; aber warum hat die CDU
nur damals nicht gegen die Ostverträge gestimmt und Ostdeutschland später an
Polen aufgegeben? Warum gilt plötzlich alles nicht mehr, was man früher gelernt
hatte, in jener guten alten Zeit der fünfziger Jahre? Wieso dürfen CDU-Strategen
plötzlich eine multikulturelle Gesellschaft fordern und Deutschland zum
Einwanderungsland erklären? Weiß das der Bundeskanzler überhaupt? Wenn man
ihm nur einmal schriebe, er würde das schon wieder einrichten!
Es dauert sehr lange, bis diese guten Leute einmal richtig
böse werden. Dann gründen sie in Opas CDU Deutschlandforen oder "wertkonservative
Arbeitskreise". Früher oder später merken sie, daß Idealisten in den
Altparteien fehl am Platze sind; geht es doch nicht um Inhalte, sondern nur
um Machterhalt. Wer jetzt nicht resigniert, macht das nächste Mal sein Kreuzchen
bei irgendeiner bösen kleinen Partei oder wird sogar Mitglied. Das darf man
doch in der freisten Demokratie auf deutschem Boden, in "diesem unserem
Lande". Das haben sie gelernt. Die Nachbarn, Freunde und Kollegen denken
ja genauso, und da wäre es doch gelacht, wenn man nicht gemeinsam in den
Bundestag einziehen könnte.
Groß ist das Erstaunen nach dem ersten Fernsehbericht über
die junge Partei. Da muß der frischgebackene Parteigänger entsetzt erkennen,
daß er ein Radikaler ist! Das hatte er noch nicht gewußt. Seine eigene Mutter
hat ihn in der Reportage kaum wiedererkannt. Früher war er einmal in der CDU
gewesen. Seit diese vieles nicht mehr vertritt, was sie noch vor 20 Jahren
verkündet hatte, war es ausgetreten. Seine Meinung hatte er nie gewechselt
und hält sich für einen mündigen Bürger und guten Demokraten. Jetzt das!
Seit der Fernsehsendung grüßen auch die Nachbarn nicht mehr: Ein ganz verkappter
Nazi muß er doch wohl sein! Und er versteht die Welt nicht mehr...
Die verfassungstreue Rechte hat kein Konzept zur Machtgewinnung;
nicht innerhalb der Altparteien und nicht außerhalb. Sie berücksichtigt
nicht operativ, daß in unserer Republik Demokratie nur ein Etikett ist. Tatsächlich glaubt sie, in fairem
demokratischen Wettbewerb um die Wählergunst an die Regierung kommen zu
können. Hinterbänkler in der CDU oder der Einzug einer konservativen
Partei in den Bundestag sind aber zwar notwendige, aber keineswegs hinreichende
Voraussetzungen politischer Mitgestaltung, sondern böten allenfalls Krümel
und Brosamen vom Tische der Mächtigen. Für die aus rechter Sicht existentiellen
Zukunftsfragen gibt allein die Regierungsverantwortung die Chance einer
Antwort, und auch nur, solange noch etwas zu retten vorhanden ist; darunter
geht gar nichts. Die verfassungstreue Rechte hat noch keine Konsequenzen
aus der Einsicht gezogen, daß Deutschland, der Staatsform nach Republik,
soziologisch gesehen von einem Postenverteilungskartell dominiert wird,
das nur noch seinen eigenen Gesetzen gehorcht. Seine Parteien haben sich
ihr Verfassungssystem selbst auf den Leib geschneidert. Wer mit ihnen konkurrieren
will, muß nach diesen Gesetzen antreten; Will er Erfolg haben, muß er erst
so werden, wie jene schon sind. Gelingt es ihm, stützt er dieses System,
statt es zu verändern. Wertüberzeugungen sind an der Garderobe abzugeben.
Die GRÜNEN sind auf diesem Weg schon weit fortgeschritten.
Die Republikaner treten ihn gerade an. Da stehen sie nun mit
ihrem Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung unter dem
Arm; stehen staunend vor jenem undurchschaubaren Räderwerk des
Parteienstaates. Eine Hand wäscht hier die andere; nur ihre Hand wäscht keiner.
Da strampeln sie sich ab und rufen: "Wir wollen doch nur das
Beste!", doch keiner hört sie, denn die Mikrofone der Kartellmedien
bleiben für sie abgeschaltet. Da stehen sie nun mit ihrer ganzen Ehrenhaftigkeit
und ihrer aufrechten Gesinnung und bleiben doch die Schmuddelkinder im
Medienstaat, in dem es nur "Gemeinsamkeit der Demokraten" hier
gibt und "Radikale" dort und nichts dazwischen. Und weil diese
"Gemeinsamkeit" vor allem Besitzstandswahrung bedeutet, dürfen
andere nicht dazugehören, und wenn sie noch so gerne möchten. Wer
Neuerungen einführen will, hat alle zu Feinden, die aus der alten Ordnung
Nutzen ziehen.
Wer das politische Parkett aus Sorge um das Gemeinwohl
betritt und gesinnungsfest seine Werthaltungen einbringen will, dem geht
es bald wie einem begnadeten Handballspieler, der auf ein Fußballfeld rennt
und ruft: "Alles hört auf mein Kommando!", und der sich dann wundert,
wenn alle nach ihren alten Spielregeln weiterspielen. Mannschaftskapitän
wird er so nie werden, ebensowenig wie ein rechter demokratischer Parteivorsitzender
etwa Bundeskanzler werden könnte. Der einzige Weg zur Regierungsmacht
führt über eine Systemänderung. Ob die Rechten unten bleiben, weil sie
nach den Spielregeln des Parteienstaates gegen die Etablierten und ihre
geballte Medienmacht nicht ankommen, oder ob sie aufsteigen um den Preis,
so zu werden, wie die anderen schon sind, ändert nichts. Die Eigengesetzlichkeiten
des Parteiensystems spülen bei jeder Parteibildung früher oder später jene
opportunistischen Glücksritter nach oben, die Tag und Nacht vor allem von der
Sorge umgetrieben werden, einen sicheren und einträglichen parlamentarischen
Listenplatz zu ergattern, weil daheim der Gerichtsvollzieher mit dem Kuckuck
winkt. Solche Glücksritter gibt es aus denselben Gründen auch bei den
Großparteien, nur sammeln sich dort die erfolgreichen Glücksritter, die das richtige Parteibuch
für ihre Karriere nutzen. Dagegen verhindert der von den Bonner Parteien ausgeübte
Mediendruck, daß rechte systemtreue Parteien in notwendigem Umfang seriöses
Personal rekrutieren können. Beamte und andere qualifizierte bürgerliche
Existenzen möchten aus naheliegenden Gründen nicht mit dem zwar falschen,
von den Medien aber allgemein vermittelten Zerrbild des Extremisten
identifiziert werden. Die Stigmatisierungswaffe greift voll durch: Im beruflichen
oder privaten Umfeld als Mitglied einer rechten Partei erkannt zu werden,
kann im Einzelfall Existenzvernichtung bedeuten. So sammeln sich denn dort
neben wirklichen Idealisten vermehrt ohnehin schon gescheiterte
Existenzen, für die es nur noch aufwärts gehen kann.
Die Republikaner sind keine Gefahr für den Parlamentarismus;
vielmehr ist seine Ergänzung durch einen demokratischen rechten Flügel seine
letzte Chance. Wenn der hohe Prozentsatz von Bürgern mit nationalen und
konservativen Werthaltungen dauerhaft in das parlamentarische System
integriert werden soll, können das nicht zwei große "Volksparteien"
mit gleichermaßen sozialdemokratischen Positionen leisten. Daß die Nichtwähler
mit über 30% bereits stärkste "Partei" geworden sind, ist ein
alarmierendes Zeichen für nachlassende Akzeptanz des Parteienwesens beim
Bürger. Millionen dieser Menschen wollen ihr Land für sich behalten und ihr
Geld für sich behalten - Asylanten und Esperantogeld wollen sie nicht.
Sie sind "ordentliche, ruhige Bürger", und sie denken das, was CDU
und SPD ihnen früher immer erzählt haben. Sie sind beileibe keine Radikalen
und hätten selbst das Postenverteilungskartell als von Gott gewollte
Obrigkeit noch Jahrzehnte ertragen. Aber was zuviel ist, ist zuviel. Vom
Verhalten dieser staatstragenden Schichten wird in den nächsten Jahren
alles abhängen. Wenn sie durch eine Partei wieder in den Schoß des parlamentarischen
Systems zurückgeholt werden können, die ihre Sprache spricht, wird das
Schiff "Bundesrepublik" zwar politische Kursänderungen vollführen,
aber es wird nicht sinken. Andernfalls werden seine Bürger das sinkende
Schiff verlassen und ein anderes besteigen. Dieses steht schon bereit:
Die herrschende Sprachregelung hat uns angewöhnt, die
Diktatur vor allem im Gegensatz zum Begriff der Demokratie zu sehen. Genau
betrachtet ist die Diktatur aber die Staatsform, in der es keine Gewaltenteilung
gibt, namentlich keine Trennung von Exekutive und Legislative.
Ob beide dieser zentralen Gewalten von der
Person eines Diktators beherrscht werden, ob eine Einheitspartei
Gesetzgebung und Regierung kontrolliert,
oder ob ein Postenverteilungskartell im Parlament sitzt und aus ihm heraus
sowohl die Gesetze macht als auch über einen Parlamentsausschuß mit dem schönen
Namen "Bundesregierung" alles im Griff hat, bleibt sich für die
Frage nach Gewaltenteilung oder Diktatur gleich. Das Staatssystem des
Grundgesetzes wirkt wie eine Parlamentsdiktatur auf Dauer einer
Legislaturperiode. Wer über die Mehrheit im Bundestag verfügt, herrscht weitgehend
frei über die beiden wichtigsten Staatsgewalten und unterscheidet sich
nur noch durch die organisatorische Aufteilung auf mehrere Parteien in Form
des Postenverteilungskartells von der Parteidiktatur.
Dieser Umstand für sich genommen ist indessen weder totalitär
noch undemokratisch. Versteht man "Demokratie" bescheiden als
ein bloßes System von Spielregeln für die Regierungsbildung, bei dem ein
numerisches Auszählungsverfahren auf der Grundlage des allgemeinen
Wahlrechts mit mindestens zwei Wahlmöglichkeiten das Hauptmerkmal ist,
mag man eine Parteidiktatur auf Zeit für demokratisch halten.
Für den radikalen Demokraten hat dieses Auszählverfahren
einen eigenständigen Wert. Besteht die Gefahr, daß diese demokratischen
Spielregeln zur Abschaffung der Demokratie benutzt werden, muß er sich entschließen,
auch gegen die Mehrheit Demokrat zu bleiben oder aber sich selbst aufzugeben.
"Es scheint also das Schicksal der Demokratie zu ein, sich im Problem
der Willensbildung selbst aufzuheben."
Ob man das demokratische Prinzip der Parteienverbote
und Grundrechtsverwirkung verteidigt und das dann "wehrhafte Demokratie"
nennt oder ob man offen die algerische Lösung anwendet und 10000 Aktivisten
der undemokratischen, in der Wahl aber siegreichen Partei in Lager sperrt:
Jedenfalls ist die demokratische Diktatur
kein Widerspruch in sich, es gibt sie wirklich.
Totalitär wird die Diktatur, sobald die herrschende Partei
Anspruch auf Gewissenssteuerung des Bürgers erhebt, seinen Alltag in immer
mehr Lebensbereichen erfaßt, indem sie ihn z.B. in Massenorganisationen
zwingt, die Grundrechte suspendiert und Staat und Gesellschaft in allen
Bereichen miteinander vermengt.
So konnte Radbruch 1937 formulieren, eine
"neue Form des totalen Staates" trenne das Recht nicht mehr von der
Moral und fordere auch "die Beherrschung der Gewissen."
Während das Bonner System
eine bürgerlich-rechtsstaatliche Form der Parteiendiktatur auf Zeit der
Wahlperiode ist, verstand sich die DDR als Diktatur des Proletariats auf
Dauer und weist, wie ihr rechtes Pendant, die NSDAP, idealtypisch alle
Strukturmerkmale einer totalitären Diktatur auf. So lehnte der Nationalsozialismus
ausdrücklich jede Gewaltenteilung und somit jede Trennung von Staat und
Gesellschaft ab.
Er hob diese Scheidung im Gegenteil geradezu
bewußt auf, indem er beide, Staat und Gesellschaft, gleichermaßen der Führung
der Bewegung, das heißt der Partei, unterwarf.
Wenn heute wieder nationalsozialistische Kleinstgruppen
solche Positionen vertreten, muß der Vorwurf gegen sie nicht lauten, sie
wollten etwa diese Demokratie durch
eine Diktatur ersetzen. Vielmehr
wollen sie die Herrschaft eines liberalen Blockparteienkartells, also
einer gesellschaftlichen Teilgruppe, durch die einer anderen Teilgruppe
ersetzen. Nicht nur, weil das erst zu einer Diktatur führen würde, muß es
entschieden abgelehnt werden, sondern weil es auf die totalitäre Beherrschung des Ganzen durch einen seiner Teile
hinausliefe. Alle Lösungen, die sich mehr oder weniger offen an das
Dritte Reich anlehnen, würden die geschilderten Strukturprobleme des Parlamentarismus
noch erheblich verschlimmern, statt sie zu überwinden. In diesem Sinne
hatte bereits der Kreisauer Kreis der 20er-Jahre im Gegensatz zur NS-Bewegung
keinen gangbaren Weg zur Überwindung des damaligen Weimarer Parteienstaats
darin gesehen, daß eine Partei das politisch-ideologische Monopol zur Ausschaltung
aller übrigen beanspruchte.
Wer sich erinnert, weiß, daß im Dritten Reich - wie auch in
der strukturell ähnlichen DDR - alles das in Reinkultur vorhanden war, was
wir auch am Parlamentarismus nicht mögen: eine Art Feudalsystem mit Cliquen
und persönlicher Bereicherung der Mächtigen, ein in sich geschlossenes System
ohne Chancen für fähige Köpfe mit abweichlerischen Ansichten, kurz: die Herrschaft
eines Teils über das Ganze. Wir erinnern uns noch einmal an Hitlers Rede auf
dem Reichsparteitag "Triumph des Willens": Nicht der Staat befiehlt
uns - nein, wir, die Partei, schaffen uns unseren Staat. Wir befehlen dem
Staat, und nicht umgekehrt. - Treffender kann man nicht ausdrücken, wie man
es nicht machen sollte.
Ebenso verfuhr der Marxismus im Sowjetsystem:
"Die Partei führt - Der Staat verwaltet!"
Die Nationalsozialisten wollten nicht die
Herrschaft des Staates, sondern die Herrschaft ihrer Bewegung. Entgegen dem
Teilcharakter ihrer Bewegung beanspruchten sie die Totalität des Staates für
sich.
Wenn aber Teile, absolut über die anderen
Teile und das Ganze bestimmen wollen, ist es gleichgültig, ob es sich um
ein Ein-Partei-System oder um einen pluralistischen Parteienstaat
handelt. Die Unterschiede sind unter den hier behandelten Aspekten nur
graduell. Jede Partei drängt nach dem Monopol und betrachtet die Teile des
Ganzen, die sich ihm widersetzen, als gegnerisch.
Ihren Weg zur Macht bahnen sie sich mit Bürgerkriegsgesinnung,
und unter den Gesetzen des Bürgerkriegs stehen ihre Regierungsmaßnahmen.
Wer die Wiederaufrichtung eines wie auch immer gearteteten völkischen
Staatswesens unter Ausschaltung der per definitionem nicht dazu gehörenden
Bevölkerungsteile anstrebt, muß sich darüber klar sein, worauf das nur
hinauslaufen kann: Der Weg kann nur über die Machtergreifung einer Partei
oder Bewegung und die absolute Durchdringung von Staat und Gesellschaft
zur Aufhebung der persönlichen Freiheit führen. Wer sich ganz einer Partei
ergibt, kann das Ganze nicht verstehen.
Wer sich also dem ganzen Volk verpflichtet
fühlt, darf es nicht einem seiner Teile überlassen; alle Teile müssen vielmehr vom Ganzen "genährt, ausgeglichen
und in Einklang gebracht werden, sollen sie ihre Aufgabe erfüllen.
...
Wer" daher
"glaubt, das deutsche Volk, die deutsche Kultur, den deutschen Staat
durch die Diktatur Nationaldenkender retten zu können, sieht nur das Morgen,
nicht das Übermorgen, geschweige denn die ferne Zukunft." Der das 1930 schrieb, Edgar Julius Jung,
wurde 1934 als "einer
der schlimmsten Feinde der Bewegung"
- eine weltanschaulich richtige Einordnung
- von der Gestapo erschossen. Er hatte erkannt, daß sich in ihr nicht die
Gegenrevolution gegen 1789 verborgen hatte, sondern die logische Konsequenz
der französischen Revolution.
Die Einsicht in die Unabdingbarkeit einer Trennung von Staat
und Gesellschaft als Vorbedingung individueller Freiheit hat zu einer Renaissance
etatistischen Denkens geführt. Dieses will den Staat von seiner Knebelung
durch gesellschaftliche Parteiungen und Gruppen befreien und sieht einen
gesellschaftlicher Einflüsse ledigen Staat als notwendige Voraussetzung
für die Entfaltung der Einzelpersönlichkeit und die Wahrung des Gemeinwohls
an. Dieses Denken unbesehen als "rechts" zu bezeichnen, griffe
zu kurz. Gegenüber völkisch-kollektivistischem Gedankengut bestehen
mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Während dort ein Teil der Gesellschaft
den Staat erobern und dessen Machtmittel gegen die anderen Teile richten
will, die seiner Idee von einem homogenen Volkskörper widersprechen,
soll der von gesellschaftlichen Einflüssen entschlackte Staat hier gerade
das verhindern und zum Wohle aller die Freiheit jedes einzelnen schützen.
Daß das gewohnte Rechts-Links-Schema hier nicht richtig
paßt, zeigt sich auch in der Person der zur Zeit wohl konsequentesten Verfechter
etatistischer Positionen in der aktuellen Diskussion: Hans Dietrich
Sander,
geboren in Mecklenburg,
1948-52 während des Studiums in Berlin unter dem Einfluß Brechts;
Günter Maschke,
gebürtiger Erfurter, wirkte
1968-70 in Kuba; und Reinhold Oberlercher,
geboren in Dresden und in
Hamburg neben Rudi Dutschke
alt-68er SDS-Funktionär.
Ihre Biographie begann ganz links; Oberlercher versteht sich heute noch als
Marxist. Die Notwendigkeit des starken, gesellschaftlichen Partikularinteressen
enthobenen Staates, wie sie Carl Schmitt
in seiner dezisionistischen
Politik- und Souveränitätstheorie umrissen hat, betonen sie heute ebenso
wie Armin Mohler,
der sich Carl Schmitt nicht
von links kommend, sondern aus originär rechter Sicht angeeignet hat.
Diese Denker fordern die Emanzipation des Leviathan
von seinen gesellschaftlichen Fesseln.
Die Trennung von Staat und Gesellschaft oder ihre Identität
bildet die Gretchenfrage der heutigen deutschen Staats- und Verfassungslehre.
Eine Trennung ist zwar keine hinreichende, jedoch die notwendige Vorbedingung
individueller Freiheit.
Der moderne Staat entstand in dem Moment, in
dem es gelang, die Herrschaft der mittelalterlichen Stände und die auf
personenbezogener Treue beruhende Rechtsordnung des Feudalismus aufzubrechen
und ihre Kräfte zum Wohle des Ganzen zusammenzufassen. Alle antistaatlichen
Kräfte entsprangen dem Widerstand der Stände und Partikularinteressen,
sich staatlich inkorporieren zu lassen.
Im nachhinein betrachtet lassen diese Kräfte
sich sozialhistorisch in der Schicht der adligen Grundherren als Inhaber von
Regalien und Privilegien fassen und ideologiegeschichtlich unter dem Begriff
des historischen Konservativismus verorten. Ihre Träger waren die eingeschworenen
Gegner einer Trennung von Staat und Gesellschaft, weil diese ihre
Machtstellung beseitigte, deren letzte metaphysische Legitimation auf
einer gottgewollten sozialen Hierarchie beruhte. Dabei nahmen die feudalen
Standesherren für sich in Anspruch, die berufenen Interpreten von Gottes
Willen zu sein.
Diese gesellschaftlichen Kräfte hatte der
Staat auf dem Höhepunkt des historischen Etatismus vorübergehend gebändigt
und sich als adäquate politische Einheit der Neuzeit etabliert. Das
bedeutete konkret, den Adel zu Staatsdienern zu erhöhen und seine Treue auf
das Gemeinwohl in Gestalt des Staates zu beziehen, nicht: Adlige zu Höflingen
zu erniedrigen. Alsbald setzte unter dem Einfluß soziologischer Gesetzmäßigkeiten,
die mit dem ehernen Gesetz der Oligarchisierung treffend beschrieben worden
sind, die Gegenbewegung ein, in deren Endphase wir uns heute befinden. Der
Staat ist von seinem Anbeginn an von den partikularen Kräften in Frage gestellt
worden, die ihn schließlich zur Strecke brachten. So resignierte Carl
Schmitt:
"Die Epoche der Staatlichkeit
geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren."
Angesichts der gegenwärtigen Verschmelzung von Staat und Gesellschaft
und dem Unterworfensein des einzelnen unter ein Amalgam gesellschaftlich-parteiischer
Gewalten, die sich mit staatlichen Machtmitteln bewaffnet haben, stellt
sich immer dringlicher die Frage, von woher die zur Totalität driftende
Staatsgesellschaft, jenes selbstreferentielle Feudalsystem, aufgebrochen
werden kann. Es bedarf dazu eines archimedischen Punktes,
und wer den Staat als neutrale Gewalt über
den gesellschaftlichen Kräften verwirft oder für historisch überholt ansieht,
soll erst einmal einen anderen Ansatzpunkt für den Hebel einer Gegengewalt
suchen und finden. Aus dem Parteienwesen selbst heraus sind die Kräfte für
eine Remedur nicht zu gewinnen.
Hier will der moderne Etatismus direkt an das historische
Modell des Absolutismus als Gegenmodell zur Vergesellschaftung des Staats
anknüpfen. Während die etatistischen Denker der Gegenwart sich einig in
ihrer Ablehnung sind, ist es nicht immer leicht, ein konkretes Bild von dem
zu gewinnen, was ihnen statt des gegenwärtigen Zustandes vorschwebt.
Sicher ist aber: Das Gemeinwesen soll in Richtung auf mehr Gemeinwohlorientierung
hin bewegt werden. Diese erhofft man sich von einem starken Staat als Sachwalter
des Allgemeinen gegen die Partikularinteressen; daher werden starke Institutionen
für unverzichtbar gehalten, Trennung von Staat und Gesellschaft sowie ein
staatsbürgerliches Ethos, in dem "Disziplin, Dienen und Einordnen mit
Toleranz, Bescheidenheit und Sittlichkeit verschmelzen."
Daher wird "starker Staat", ganz anders als in der
liberalen Zerrvorstellung vom starken Staat, gerade als Vorbedingung
individueller Freiheit verstanden. Was uns heute von liberaler Seite mit
warnend erhobenem Zeigefinger als abschreckendes Beispiel für einen
"starken Staat" vorgehalten wird, nämlich die Herrschaft eines
"starken Mannes" von 1933 bis 1945, war aus Sicht der Etatisten
das genaue Gegenteil: ein schwacher, ohnmächtiger Staat unter der Kuratel
einer totalitären Partei. So bringt Sander die von der Mehrparteiengesellschaft
eroberte BRD und das von einer Einheitspartei eroberte Dritte Reich auf
den gemeinsamen Nenner der Unstaatlichkeit: "Jedenfalls erwiesen
sich alle Versuche, die Bundesrepublik, die nie ein Staat gewesen ist, zur
Staatlichkeit zu überreden, nicht minder fruchtlos, als die Experimente von
1933/34, das Dritte Reich, das eine überkommene Staatlichkeit in sich verschlang,
zum Staat zu bekehren."
Und wenn von liberaler Seite weiter entsetzt abgewehrt
wird, ein starker Staat müsse zum Verlust individueller Freiheit führen, kontern
Etatisten mit dem Hinweis auf den jetzigen Zustand bundesdeutscher Geistesfreiheit:
Tatsächlich lastet heute die öffentliche Meinung über unserem Gemeinwesen
wie ein geschlossener Alptraum. Die Herrschaft des bekannten Meinungsmonopols
ist so unangefochten, daß es ausscherende Organe immer wieder unter jenen
Alibizwang setzt, aus dem sie nicht die volle Wahrheit wagen oder sich unbequemer
Mitarbeiter entledigen." "Dabei ist die Spannweite dessen, was
ohne Sanktionen gesagt und gedacht werden kann, seit den fünfziger Jahren
permanent reduziert worden. 1955 etwa erschien das Buch von Winfried
Martini,
'Das Ende aller Sicherheit',
eine der schärfsten Kritiken der parlamentarischen Demokratie, in der
Deutschen Verlagsanstalt, einem der größten Verlage. Dieses Buch könnte
heute allenfalls in einem versnobten oder in einem winzigen rechtsradikalen
Verlag erscheinen. Der Raum der geistigen Freiheit ist geradezu verdampft."
Hat man erst einmal alle heiligen Kühe des Grundgesetz-Katechismus
als magere Ziegen entlarvt, kann es unter dem Schutz des starken Staates
eigentlich nur noch aufwärts gehen. Der Blick hebt sich dann von den Niederungen
der BRD-Gewaltenteilung, die gar keine ist, sondern Parteiendiktatur mit
Pöstchenverteilung; von der Meinungsfreiheit, die man nicht nutzen kann,
weil die Medienforen fest in Händen des Parteienkartells sind, vom Cliquenfeudalismus
auf zu den lichten Höhen der absoluten Republik, in der das Gemeinwohl mit Potestas
und Autoritas in der Hand eines Princeps legibus solutus liegt.
Lassen wir den Hauptvertreter der
"absoluten Republik" selbst zu Wort kommen:
"Wir erhalten eine Vorstellung von den Konturen der
politischen Neuordnung, wenn wir das Muster der absoluten Monarchie, das
in Preußen zur Vollendung gelangte, republikanisieren. An die Stelle des
Monarchen tritt in dieser absoluten Republik der Präsident mit einer
ähnlich langen Amtsdauer, die nötig ist, um wieder eine Kontinuität zu begründen.
Der Präsident regiert wie ein Monarch mit einem Kabinett von Fachministern,
die er ernennt und entläßt. Diese Regierung ist sowohl Exekutive wie
Legislative, deren Trennung zu den Mythen der neueren Staatsrechtslehre
gehört. Sie ist Exekutive und Legislative im Dienst eines Ganzen, und nicht
im Dienst eines Oligopols oder eines Monopols. Die Fachminister stützen
sich, nach dem cameralistischen System der absoluten Monarchie, auf freie
Kammern, die von neu zu gründenden Berufsverbänden durch eine aus Ernennung
und Wahl gemischte Berufungsprozedur beschickt werden, die durchlässig
sein muß für den Aufstieg von Begabungen, die nun einmal meistens sperriger
Natur sind. Das allgemeine Wahlrecht wird auf die kommunale Ebene beschränkt,
die der Wähler übersehen und beurteilen kann, als den traditionellen Bereich
der Selbstverwaltung..."
Auf den Einwand, wie denn der Parteienfeudalismus in die
absolute Republik transformiert werden könne - die Parteien könnten ja
vielleicht etwas dagegen haben - verweisen Staatsabsolutisten auf den
"von der Rechtswissenschaft entwickelten Begriff der kommissarischen
Diktatur". Diese "ist von der Geschichte von verschiedenen politischen
Organisationsformen mit Erfolg angewendet worden; zuletzt sehr kurzfristig,
weil sehr wirkungsvoll, auf dem Höhepunkt der französischen Krise von 1959,
als General de Gaulle die vierte durch die fünfte Republik ersetzte." "Der erste Schritt der Remedur besteht
in einem Elitenwechsel, der einen Orientierungsrutsch voraussetzt, wie
er die SED plötzlich heimsuchte. Der zweite Schritt besteht in einem Abbau
der Europäisierung Deutschlands, der sich auf dem Weg von Bonn nach Berlin zu
vollziehen hat. Der dritte Schritt besteht in einem Systemwechsel durch Preußifizierung.
Gelingt die Remedur nicht im fahrenden Zug, erzwingt sie der Crash." Damit meint Sander
den Zusammenbruch der von
innen verfaulten Bundesrepublik und prophezeit: "Sie kann von nichts
mehr gehalten werden und verdient es auch nicht." -
Dieses Denkmodell geht also über die bloße Trennung von
Staat und Gesellschaft weit hinaus. Es ist eine Kampfansage des Staates an
die Gesellschaft, ein Programm zu ihrer Domestikation und Beherrschung und
eignet sich als extreme Gegenposition zum Parteienstaat besonders zur exemplarischen
Erklärung rein etatistischer Denkweise. Als solche hat sie auch im eigenen
Lager ihre Kritiker. Lorenz von Stein
folgend,
sieht Oberlercher in der "Verstaatlichung der Gesellschaft keine
verlockende Alternative zur gegenwärtigen Unterwerfung des Staates unter
die Gesellschaft mittels ihres Parteiensystems." Der Extremismus des
Liberalismus sei die Natur- und Volkszersetzung, weil alle aus allem
Kapital schlagen wollen; der Extremismus des Etatismus sei aber der Absolutismus.
Er fordert daher ein politisches Konzept, in dem die Gesellschaft als
staatstragend und der Staat als sozialverträglich vorgestellt werden kann. Ganz ähnlich bezeichnet Dahrendorf
die absolute Durchsetzung des
einen Prinzips gegen das andere als "Versuchung": "Die der Wettbewerbsfähigkeit
ist der grenzenlose Individualismus, der die Schwachen beiseite läßt. Die
Versuchung des sozialen Zusammenhalts ist die Volksnation, der
Nationalismus oder Fundamentalismus."
Tatsächlich ist die völlige Trennung des Staates von der
Gesellschaft ebensowenig frei von Gefahren wie ihre völlige Verschmelzung.
Sie bestehen in der Entwicklung des Staates zu einer über der Gesellschaft
stehenden, sich ihr immer mehr entfremdenden Macht. "Daß das in seiner
Natur der konstitutionellen Monarchie entsprechende Modell einer sich auf
'Sachzwänge' gründenden, in einem technokratischen Regime und seiner
Bürokratie verkörperten, von der Notwendigkeit gesellschaftlicher
Legitimation entbundenen Staates von geringer [...] Aktualität [...] wäre, wird angesichts der bekannten Schwierigkeiten moderner Demokratie
kaum angenommen werden können."
Die absolute Republik ist nicht der gemütliche
Wohlfahrtsstaat, nicht die spießbürgerliche Kuschelecke und auch nicht
die gute alte Zeit, in der man sich noch das Herz am angestammten Dynastenhaus
erwärmte. Es ist die hart das Gemeinwohl einfordernde, Disziplin und
Pflichterfüllung heischende, die "absolute" Republik, in der
jeder zuallererst Staatsbürger und damit auf das Staatsethos verpflichtet
ist. Die "feigen, fetten Fritzen" der Wohlstandsgesellschaft
werden allerdings mehrheitlich im "unversöhnlichen Gegensatz"
zu einer solchen preußischen Staatsauffassung
stehen. Die Traditionslinien dieses heute fast ausgestorbenen Staatsethos
ziehen sich von Friedrich dem Großen
("Ich bin der erste Diener meines Staates.")
und dem preußischen Beamtentum aus dem Geist des Dienstes an der Allgemeinheit,
dem Staat, bis in unser Jahrhundert.
Sie verkörpern sich beispielhaft in Persönlichkeiten der konservativen Revolution wie Ernst
von Salomon.
1902 geboren und in einer
preußischen Kadettenanstalt erzogen
,
hatte Salomon sein politisch bewußtes Leben in der Zeit des Zusammenbruches
1918 begonnen und stand mit seiner etatistischen Grundhaltung
,
seiner Verpflichtung auf das Ganze, verständnislos vor den staatsauflösenden
Tendenzen des liberalen Parlamentarismus, der Negation der Staatsräson
und dem ideologisierten Weltbürgerkrieg. Diesen fochten die
Rechts-Links-Parteien auf Deutschlands Straßen blutig aus, während französische
Besatzungssoldaten durch die Straßen marschierten. 1933 erwies die Grundhaltung
dieses auf ein Staatsethos bezogenen Stranges "rechten" deutschen
Denkens sich endgültig als resistent gegenüber der totalitären Versuchung
und der Eroberung des Ganzen durch eine Partei, und nur aus diesem Geist sind
die Worte des 20. Juli 1944 vor dem Erschießungskommando verstehbar:
"Es lebe das ewige Deutschland!", nämlich die geistig ungeteilte
Nation, das Reich, der Staat, nicht hingegen die "Bewegung" einer
einzelnen Partei.
Schon in den 20er und 30er Jahren hat sich das staatsbezogene
Denken eines Teils der rechten Intelligenz in der Zeit der konservativen Revolution
in Deutschland nicht als mehrheitsfähig erwiesen. Zu übermächtig war der
Druck der hochideologisierten Massenparteien KPD und NSDAP
,
zu groß die Versuchung, Partei zu sein und auf der anderen Seite der Barrikade
den absoluten Feind zu vermuten. Sollte das Zeitalter des Weltbürgerkriegs,
1917-1989, aber jetzt tatsächlich zuende gegangen sein, was Ernst Nolte
überzeugend aufgewiesen
hat, und sollten mit dem 20. Jahrhundert auch die ökologisch fetten Jahre
enden, dann könnte sich die Frage nach dem geeigneten politischen System zur
Krisenbewältigung ganz anders stellen.
Während die absolute Republik fraglos kein ausgewogenes Verhältnis
zwischen der durch den Staat verkörperten Gemeinwohlorientierung und dem
Freiheitsanspruch des durch jahrzehntelangen Liberalismus verwöhnten
Individuums darstellt, könnte eine globale Ökokrise die Parameter umkehren.
Wolfgang Venohr
prophezeit, daß die
Öko-Diktatur bestimmt komme. Mit ihr werde die Wohlfahrt des Ganzen die Rechte
des einzelnen überlagern. Schon ein Jahr nach Venohrs Prophezeiung wurde in
Hessen eine Debatte um von der Regierung geplante rigide bürokratische
Vorschriften von der CDU-Opposition unter dem polemischen Begriff der
Öko-Diktatur geführt. Wenn im kommenden Jahrhundert ganze Völker von Überschwemmungen
bedroht sind, sagt Venohr weiter voraus, das weltweite Ozonloch nur noch einen
15minütigen Aufenthalt im Freien erlaubt, die Wälder gestorben und die Böden
ausgedörrt sind, wenn täglich in der Welt nicht mehr nur Tausende, sondern
Millionen verhungern und die Heerscharen der Halbverhungerten in die landwirtschaftlich
noch produzierenden Länder einströmen, dann könne man nicht mehr nach dem
Interesse des einzelnen fragen und habe auch keine Zeit mehr, parteipolitische
Beratungsgremien diskutieren zu lassen. Der Freiheitsraum des einzelnen
kann nicht mehr das höchste aller Güter sein, wenn die Existenz ganzer Völker
auf dem Spiel steht. Im Innern des Staates werden dann schnell drakonische
Maßnahmen getroffen werden müssen, die den einzelnen empfindlich treffen,
um die Gemeinschaft zu retten. "Eine neue Zeit kündigt sich an. Um in
ihr zu bestehen, werden sich insbesondere die Deutschen an ein großes
Vorbild erinnern müssen, an eine öffentliche Haltung, in der Disziplin, Dienen
und Einordnung mit Toleranz, Sittlichkeit und Bescheidenheit verschmolzen
waren, kurz: Die Deutschen, wenn sie überleben wollen, werden sich in eine
preußische Façon versetzen müssen."
Man empfindet die Genugtuung in den Worten des Preußen Venohr,
für den prophezeiten Fall
einer schrecklichen Zukunft gerade diejenigen Tugenden als lebensnotwendig
herausstellen zu können, die ihm sowieso Herzenssache sind. Hier trifft
sich seine Zukunftsvision in der Sache, wenn auch nicht der Intention, mit
Ernst Nolte,
der als Liberaler seufzend
zugeben muß: "Entschlossene Handlungsbereitschaft oder ein Ethos
der Tapferkeit und des Verzichts sind ihm (erg.: dem Liberalismus) nicht
eigentümlich, und es mag eine Zeit kommen, wo eine Notsituation nach eben diesen
Eigenschaften verlangt, so daß das System erneut in Gefahr geraten könnte." Ob man diese Entwicklungen nun als Morgenrot
begrüßt wie Venohr oder sie als Gewitter dräuen sieht wie Nolte: Es bleibt mit
der Idee der preußischen, der absoluten Republik das Modell eines streng
disziplinierenden Machtstaates, das nur zur Zeit nicht aktuell ist, eines
Staates, den man nicht liebt und nach dem sich sicherlich auch nur wenige
sehnen, der aber dereinst einmal die Ultima
ratio sein könnte, wenn die Alternative zu ihm nur noch das Chaos ist.
Die geschichtliche Erfahrung und der Ausblick auf die sich
abzeichnenden Probleme des 21.Jahrhunderts lehren, daß ein Volk in seiner
Geschichte, je nach Lage, verschiedene Verfassungen brauchen kann, um
seine Identität zu bewahren. Wir befinden uns in einer Zeitenwende, die
einen Systemwechsel erfordert, wenn wir uns nicht als deutsches Volk selbst
aufgeben und durch eine von Brüssel und der Macht multinationaler Konzerne
und Einflußlobbies leicht manipulierbare, multikulturelle, amorphe Verbrauchermasse
ersetzen lassen wollen. Daß der deutsche Staat der archimedische Punkt
ist, der allein unsere Gegenkräfte bündeln kann, haben alle die schon lange
begriffen, die aus unterschiedlichen Gründen am Fortbestand des deutschen
Volkes uninteressiert sind oder es substantiell zerstören wollen.
Wie Hitler mit den Juden als Volk die von Juden maßgeblich
getragene Moderne und den Intellektualismus physisch vernichten wollte,
möchten heute radikale Multikulturalisten mit
den Deutschen als Volk geistige Traditionslinien ausmerzen. Das erinnert
"an Bert Brechts
eigentlich satirisch gemeinten
Rat, wenn der Regierung das eigene Volk nicht mehr passe, solle sie doch ein
anderes wählen. Tatsächlich braucht die Linke in der Mitte Europas etwas
anderes als das bisherige deutsche Staatsvolk, will sie sich auf unserem
Gebiet über das Jahrhundert hinweg behaupten."
"'Deutsche Antifaschisten' vertreten [...] eine These der anti-deutschen Propaganda des Zweiten Weltkrieges: Der Nationalsozialismus
sei das zwangsläufige Ergebnis autoritärer, kriegerischer, obrigkeitsstaatlicher,
antiliberaler Tendenzen der deutschen Geschichte. Für die 'progressiv'-hedonistischen
Intellektuellen stellt der ordnungsliebende, autoritätshörige, aggressive,
'ausländerfeindliche' Deutsche den Gegentypus des progressiven Ideals
dar. Der 'Antifaschist' wird damit automatisch zum Gegner deutschen Wesens,
deutscher Tradition und nationalen Selbstbewußtseins."
Er hofft, "daß in einer nicht allzu
fernen Zukunft die Mitte Europas nicht mehr von einer deutschen Nation bewohnt
werden würde, die ihr Geschichtsbewußtsein, nach der Korrektur von allzu
einseitigen Anklagen, auf neue Weise begründet hätte, sondern von einer
multiethnischen Bevölkerung, die, wie man meint, den Frieden der Welt
sichern sowie einen höchst erwünschten Beitrag zum Ausgleich der Lebensverhältnisse
auf der Erde leisten würde. [...] So wie einst an die Stelle der geschichtlichen
Nation die naturhafte 'Rasse' treten sollte, so soll heute die Nation oder
das Staatsvolk durch eine nicht mehr geschichtliche Bevölkerung der Supermarktzivilisation
abgelöst werden."
In diesem Sinne fordert ein "Friedrich
auf der Hut" unter dem Titel 'Gleich und gleich macht krank und bleich' aggressiv antideutsch
und "umgekehrt"-rassistisch die Schaffung einer "höheren"
Menschheitsmischrasse, weil das deutsche Volk ohnehin inzüchtig-dekadent
sei: "Die Gesetzgeber aller Länder sind nun gefordert. Ehen unter
Gleichhäutigen, Gleichhaarigen und Gleichäugigen müssen strikt untersagt
werden. Ziel: Hebung des globalen Intelligenzquotienten. [...] Helfen Sie [...] mit, den Homo futurus [...] zu schaffen."
In ihrem pathologischen Selbsthaß zerstören sie bewußt die
kulturelle, dann die politische und schließlich die physische Existenz des
deutschen Volkes. Auf ein derartiges, im Verfassungsschutzbericht 1990
abgedrucktes Grundlagenpapier der aus dem Kommunistischen Bund hervorgegangenen Radikalen Linken verweist Knütter: "Die Linke müsse den
Haß auf das eigene Vaterland schüren und dieses bekämpfen. Das erklärte
Ziel sei die Zerstörung des deutschen Staates und die Auflösung des
deutschen Volkes in eine multikulturelle Gesellschaft."
Diesen Absichten zu widersprechen, ist mehr
als eine Frage anderen Geschmacks oder weltanschaulicher Beliebigkeit. Die
Endlösung der deutschen Frage wird Hand in Hand betrieben von einer Front
politischer Exterminatoren, die von Autonomen bis zur Geißler
-Süßmuth-Truppe reicht. Sie bietet nicht nur denjenigen besonderen
Anlaß zur Gegenwehr, denen ein heroischer Realismus ohnehin Herzenssache
ist.
Für jeden, der sich mit dem deutschen Volk identifiziert,
geht es um nichts weniger als das nackte Überleben, nämlich darum, als
Deutscher in einem als "deutsch" definierten Land unter Landsleuten
leben zu dürfen. Wenn der Begriff vom 'Naturrecht' überhaupt irgend einen
Sinn haben soll, dann denjenigen, daß jeder sich und die Seinen mit allen
Kräften verteidigen können darf und muß. "Welcher Edeldenkende will
nicht und wünscht nicht in seinen Kindern und wiederum in den Kindern dieser
sein eigenes Leben von neuem auf eine verbesserte Weise zu wiederholen und in
dem Leben derselben veredelt und vervollkommnet auch auf dieser Erde noch
fortzuleben, nachdem er längst gestorben ist?" Wer wollte nicht durch
das beste Vermächtnis seines Denkens in seinen Nachkommen "offenbare
Denkmale hinterlassen, daß auch er dagewesen sei?" Die Fortdauer seiner
Wirksamkeit gründet er auf die "Hoffnung der ewigen Fortdauer des Volkes,
aus dem er selber sich entwickelt hat, und der Eigentümlichkeit desselben."
Diese ist "das Ewige, dem er die Ewigkeit seiner selbst und seines
Fortwirkens anvertraut"; die "Ordnung der Dinge", die sich in
ihm verkörpert und in der er sich selbst wieder findet. Ihre Fortdauer muß
er wollen, denn sie allein ist ihm das Mittel, wodurch "die kurze Spanne
seines Lebens hienieden zu fortdauerndem Leben ausgedehnt wird."
Wenn der Selbsterhaltungstrieb als 'natürlich' gelten darf,
muß der umgekehrte Rassismus, die Lust an der Selbstzerstörung, als widernatürliche,
pathologische Perversität bezeichnet werden. "Es ist moralisch nicht
vertretbar, aus ethnischem Selbsthaß oder aus Gleichgültigkeit
Bedingungen herbeizuführen, durch die die Zukunft der eigenen Gemeinschaft
gefährdet wird. [...] Selbstherabsetzung, Selbstbeschuldigung
und unentwegte Übung in Selbstzerknirschung führen zur Selbstzerstörung. [...] Man verschenkt nicht die Zukunft seiner Enkel, auch nicht aus humanitären
Gründen. Wer alle Welt umarmt und darüber seine Angehörigen vergißt, handelt
nicht human, mag er sich noch so in dieser Rolle gefallen. [...] Es muß gestattet sein, das nicht zu akzeptieren," resümiert der Verhaltensforscher
Eibl-Eibesfeldt.
Während in deutschen Städten Jugendliche "Nie wieder
Deutschland!" an Hauswände schmieren und sich als antifaschistische
Helden vorkommen, macht man sich beim Bonner Establishment und seinen
westlichen Freunden vor allem Sorgen, wie man Deutschland machtlos hält, indem
man es militärisch, politisch und wirtschaftlich "einbindet". Dem
geplanten multikulturellen Genocid am deutschen Volk entspricht im
politischen Bereich die eingeleitete Entmündigung und Unterstellung
unter die Brüsseler Bürokratie. Während die deutsche Staatlichkeit im Innern
an liberalistischer Schwindsucht leidet und das Gemeinwohl Sonderinteressen
zum Opfer gefallen ist, werden die Restbestände souveräner staatlicher Handlungsmacht
von Brüssel aufgesogen. So wird die einzige Instanz, die nach ihrer Zweckbestimmung
originär deutsche Interessen vertreten müßte, von zwei Seiten in einen
Zangengriff genommen und entleert.
Wie durch Millionen fortpflanzungsfreudige Türken und
andere ausländische Mitbürger und moslemische Mitchristen in deutschen
Zentren irreversible Fakten geschaffen werden sollen, will die heute herrschende
Generation der "Betroffenen" auch durch den Weg nach Europa alle
Brücken hinter sich abbrechen. Hier sieht sie die letzte Zuflucht vor ihrem
ungeliebten Schicksal, als Deutsche auch deutsche Politik machen zu müssen. Es
irrt aber, wer meint, durch eine Freundschaftserklärung an alle Welt oder
durch Aufgabe der eigenen Selbstbestimmung das Politische aus der Welt schaffen
zu können. "Wenn ein Volk die Mühen und Risiken der politischen Existenz
fürchtet," bemerkte kühl Carl Schmitt, "so wird sich eben ein
anderes Volk finden, das ihm diese Mühen abnimmt, indem es seinen 'Schutz gegen
äußere Feinde' und damit die politische Herrschaft übernimmt; der Schutzherr
bestimmt dann den Feind, kraft des ewigen Zusammenhanges von Schutz und Gehorsam."
So marschierten die politischen Großväter Helmut Kohls 1812 unter der Trikolore
zum Ruhme Frankreichs gegen Rußland, und so werden deutsche Söhne
dereinst unter "europäischem" Kommando sterben, in Somalia, im
Irak, in Libyen oder anderswo. "Dadurch, daß ein Volk nicht mehr die
Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet
das Politische nicht aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches
Volk."
Unser strategisches Ziel kann nur die selbstbestimmte und
daher selbstorganisierte deutsche Staatlichkeit sein. Ihre Aufgabe es ist,
die Fundamentalgarantie für den Frieden im Innern und den Schutz nach außen
zu übernehmen,
die jede Art von
individueller und gesellschaftlicher Freiheit und den Frieden
erst ermöglicht.
Wir brauchen unseren Staat als umfassende
Schutzhülle für unser gesellschaftliches Leben im Inneren und für unsere
gemeinschaftliche Existenz nach außen. Objekt der Befriedung und des Schutzes
ist also auch das deutsche Volk als geschichtliche Größe, also nicht nur
als Gesamtgesellschaft, also Summe der bloß zufällig heute hier wohnenden
Menschen. Dieses Volk als Schutzgemeinschaft für unser aller Freiheit zu
denken und uns Lebende in diesem Sinne als unseren Vorfahren und Nachkommen
verpflichtet zu verstehen,
ist der Sinn deutscher Staatlichkeit.
"Keiner lebt für sich allein. Jeder ist auf Gemeinschaft
...
in der Abfolge der
Generationen angewiesen."
Zu dieser Gemeinschaft gehören alle, die
sich zum "deutschen Volkstum als national geprägter Kulturgemeinschaft,
nicht als anerkannter oder nicht anerkannter Rechtsinstitution, sondern
als einer rechtlicher Wertung a priori vorgegebenen Seinsform, bekennen
oder nicht bekennen."
Wer das anders sieht, mag sich der deutschen Vergangenheit
schämen, kinderlos bleiben und Deutschland zum Einwanderungsland erklären,
damit die Kinder anderer Völker ihm im Alter seine Rente zahlen. Er mag sich
auch von Brüssel reglementieren lassen und sich als "Europäer" oder
gar "Weltbürger" fühlen. Danken wird es ihm niemand. Für diese
Haltung ist charakteristisch, daß viele Deutsche heute nicht mehr in der
Lage sind, sich als eigenes Volk mit eigentümlichen Merkmalen und eigenen
Interessen wahrzunehmen.
Wer sich, von jahrzehnterlanger
Charakterwäsche indoktriniert und neurotisiert, seiner Wurzeln schämt, mag
lustvoll selbst seine Identität aufgeben. Doch wird er mit ihr seine Freiheit
verlieren und sich selbst auf die Rolle eines Konsumenten in einem gemeinsamen
Markt von ein paar hundert Millionen Verbrauchern reduzieren. Der Verlust
von Identität und Tradition ebnet den Weg zum "zur Masse degradierten,
naturentfremdeten, nur an kommerzielle Werte glaubenden, gefühlsarmen,
verhaustierten," politisch indoktrinierbaren und durch die Großindustrie
manipulierbaren
Einheitsverbraucher; ebnet den american way of life. Die von
ihren modernen Geldherren in dumpfem Liberalismus gefangene Masse in ein seiner selbst bewußtes
Volk zurückverwandeln zu wollen, heißt daher nicht, für das Volk als "völkisches"
Hirngespinst einzutreten, sondern Bevölkerung zum für jede Demokratie
unentbehrlichen Subjekt zurückzuverwandeln, zum selbstbewußten ÄÞìïò. Es bedeutet auch, die
republikanische Tugend der virtú gegenüber
egozentrischer Eigensucht wiederzubeleben, und diese Tüchtigkeit bezieht
sich immer zurück auf das Volk als
Subjekt.
Strategisches Ziel muß daher sein,
ein gerade so starkes Maß an deutscher Staatlichkeit zu bewahren, wie es
benötigt wird, um das deutsche Volk substantiell zu erhalten, Bürgerfreiheit
gegenüber inländischen und internationalen gesellschaftlichen Machtgruppen
zu bewahren und zurückzugewinnen, die selbstbestimmende Mitverantwortung
dem Postenverteilungskartell wieder abzuringen und vor Fremdbestimmungsgelüsten
zu schützen. "Der Staat ist notwendige Bedingung einer gerechten,
sozialverträglichen, die Freiheit aller ermöglichenden Ordnung des
menschlichen Zusammenlebens, und er muß sich darum gegenüber allen innnerstaatlichen
Machtgruppierungen als überlegen erweisen."
Ein starker Staat ist ebenso notwendig wie
eine starke Gesellschaft, und eine starke Gesellschaft ebenso notwendig
wie ein starker Staat. Das menschliche Zusammenleben darf nicht einseitig
von einem dieser seiner beiden Aspekte regiert werden. Wir müssen daher
das strategische Ziel klar ins Blickfeld rücken, weil wir es sonst einerseits
nicht erreichen können, andererseits aber auch nicht über das Ziel hinausschießen
und in der absoluten Republik landen dürfen, die wir uns als freiheitsliebende
Menschen allenfalls für den letzten Notfall aufheben möchten. Wer meint,
dieser Notfall sei heute schon da, mag das anders sehen.
Vor allem aber müssen wir klar zwischen Strategie und Taktik
unterscheiden. Möglicherweise werden wir das strategische Ziel nicht direkt,
sondern nur auf einem Umweg über taktische Zwischenlösungen erreichen können:
Bedauerlicherweise gibt es nämlich viele Politiker und politikabhängige
Bürger, die vom gegenwärtigen System gut leben und es daher bis aufs äußerste
verteidigen werden. Niemand von ihnen wartet etwa darauf, hier nach
Feierabend nachzulesen, wie er sich selbst dadurch entmachten kann, daß er
uns freiwillig die Macht überläßt. Haupthindernisse auf dem Weg zum Ziel
sind also alle, die dem von Scheuch so genannten Postenverteilungskartell
der etablierten Parteien angehören, weil diese die Zugänge zu den von ihm
befallenen staatlichen Entscheidungsgremien mit ihren Gefolgsleuten verstopft
halten. Der Speyerer Verfassungsrechtler von Arnim
sieht durch sie eine
"systembedingte Reformblockade". Ihr Feudalsystem muß, wie Scheuch
so schön formulierte, auf
Bundesebene beseitigt werden. Mit "beseitigt werden" sind natürlich
nicht jene Parteien als solche gemeint, sondern die ihre Macht stabilisierenden
soziologischen und verfassungsrechtlichen Sicherungen. Oder mit den
Worten von Arnims: Weil die Mängel ganz überwiegend struktur- und systembedingt
sind, gilt es, diese Strukturen und damit das System selbst zu ändern. Die Verfassungsstrukturen müssen so umgebaut
und reformiert werden, daß sie dem Staat die Verfolgung des Angemessenen
und Notwendigen erleichtern und die organisierten Partikularinteressen,
die "intermediären Kräfte"
,
in ihre Schranken weisen. Das Ziel läßt sich daher nur erreichen, wenn
vorher das selbstreferentielle Feudalsystem aufgeknackt und dadurch
für Strukturveränderungen geöffnet wird. Jedes Mittel, das uns diesem
Zwischenziel näherbringt, darf uns als taktische Zwischenlösung willkommen
sein. Das liberale Syndrom kann gegenwärtig nur so bekämpft werden, daß wir
den demokratischen Gedanken gegen den liberalen ausspielen. Dieser ist der
Feind, jener ist unser Mittel zum Zweck.
Was also steht dem Ziel im Weg? Welche Regelhaftigkeiten
sind es konkret, die diejenigen Politiker zu tragischen Helden machen, die
nicht mit den Wölfen heulen? Die Regeln des Systems sind im Verfassungsstaat
zuallererst und an wichtigster Stelle immer die im Staatsgrundgesetz
niedergelegten materiellen Verfassungsnormen. Darüber hinaus sind von
größter praktischer Wirksamkeit alle diejenigen faktischen Regeln und
soziologischen Gesetzmäßigkeiten des innenpolitischen Machtkampfes,
die von der Verfassung stillschweigend impliziert oder geduldet werden.
Das "System" ist überwölbt von einer abstrakten
Herrschaftsideologie und stellt sich konkret als Wirkeinheit einer Fülle sich
gegenseitig stabilisierender und bedingender rechtlicher und soziologischer
Regeln sowie faktischer Machtverhältnisse dar. Dabei stabilisieren sich jeweils die Machtpositionen
der Etablierten in konkreten Verfassungsgesetzen; diese Gesetze
erhalten die Macht usw. Das Perpetuum mobile des selbstreferentiellen Systems
scheint perfekt; aber gerade dieser perfekte Kreislauf von sich in den
Verfassungsgesetzen stetig selbst stabilisierender Macht relativ
kleiner Einflußgruppen provoziert die Frage, von welchem Punkt aus der
Kreislauf durchbrochen werden kann. Die Alternativen wären einerseits
die Hoffnung, die herrschenden Machteliten könnten auf irgendeinem Wege
veranlaßt werden, "freiwillig" die sie stützenden Verfassungsregeln
durch andere zu ersetzen und so das geschlossene System zu öffnen, oder
andererseits der Gedanke: Trotz der entgegenstehenden Spielregeln
könnte eine Systemopposition vom Volke als Bundestagsmehrheit gewählt
werden.
Wo liegt nun von Verfassungs wegen das Haupthindernis für unser
strategisches Ziel? Was muß von Verfassungs wegen geändert werden? Was
wollen wir als unverzichtbar erhalten? Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten
hatten wir den Parlamentarismus und den Parteienstaat, soziologisch das
Feudalsystem als Basis für den Machterhalt des Bonner Establishments
ausgemacht und alle diese Phänomene letztlich aus ins Extreme übersteigertem
Liberalismus abgeleitet. Wenn wir davon ausgehen dürfen, daß faktische
Machtverhältnisse schwerer zu kippen sind als Verfassungsregeln und daß
die Macht letztlich demjenigen zufällt, der zu seinen Gunsten die Spielregeln
verändern kann, müssen wir den verfassungsrechtlichen Kern des Parlamentarismus
suchen und verändern. Dieser besteht in der bekannten Stufenleiter des
Repräsentationsprinzips: Das Volk wählt Abgeordnete als seine Repräsentanten,
und diese wählen ihrerseits einen Kanzler als Regierungschef. So ist das
Parlament funktional ein Ausschuß des Volkes und die Regierung einer des
Parlaments. "Das parlamentarische Prinzip betrachtet das Ministerium
als geschäftsführenden, wenn auch nicht notwendig aus ihrem Schoß hervorgegangenen Ausschuß der Volksvertretung." Das Verfassungsrecht hat dafür den Begriff
des parlamentarischen Regierungssystems im Gegensatz zum weiter gefaßten
Begriff der parlamentarischen Demokratie gebildet.
Im Grunde ist es eine Art Rätesystem, nur
ohne permanente Abwählbarkeit und - de jure - ohne imperatives Mandat.
Dieses System muß sich die Frage nach seiner inneren Logik
gefallen lassen: Wem oder welchen Interessen gegenüber soll das Parlament
eigentlich wen oder wessen Interessen "repräsentieren", wenn es
kraft seiner Allzuständigkeit alle Interessen überhaupt in sich vereint?
Repräsentation setzt nämlich dreierlei voraus: Einen Repräsentanten,
einen Repräsentierten und einen Dritten, dem gegenüber repräsentiert wird.
"Die Bedeutung des dritten Faktors ist
dabei nicht geringer als die der beiden erstgenannten. So verlören etwa diplomatische
Vertretungen ihren Sinn, gäbe es keine fremden Regierungen mehr, denen gegenüber
sie Repräsentationsaufgaben wahrzunehmen hätten. Geschäftsführer von
Gesellschaften wären überflüssig, träte das Unternehmen nicht in Außenbeziehungen.
Übertragen auf die parlamentarische Repräsentation, erfüllt sie ihren
Sinn in der Vertretung aller im Volk vorhandenen Meinungen, solange ein
tatsächlicher Dualismus zwischen Parlament und Regierung besteht."
Ein solcher Interessengegensatz kann
nicht bestehen, wenn die Regierung funktional ein Parlamentsausschuß ist,
zumal beide Staatsorgane ohnehin unter den Bedingungen des Parteienstaats
von einer jeweiligen Majoritätspartei oder -koalition überlagert werden.
Das ist das eigentliche Spezifikum des Parlamentarismus im
hier dargestellten engeren Sinne: Die absolute Parlamentsherrschaft,
seine prinzipielle Allzuständigkeit, die
sogenannte Kompetenz-Kompetenz des Parlaments, das heißt die gesetzliche
Zuständigkeit, über den Umfang der eigenen Zuständigkeit zu entscheiden.
Das ursprünglich nur den Staat überwachende Parlament hatte nach Teilhabe an der Macht verlangt; und
nach der Teilhabe verlangte es nach der ganzen, ungeschmälerten Macht.
"Je mehr der Gegenspieler, die monarchische Repräsentation, entfiel, um
so mehr entfiel auch die Repräsentation des Parlaments, und die
repräsentative Körperschaft verwandelte sich in einen Ausschuß der
Wählermassen." Historisch war als erste den Weg der radikalen
Repräsentation unter Ausschaltung des empirischen Volkes die französische
Konstituante von 1789 gegangen und begründete damit "eine demokratietheoretische
Tradition, die
...
sich nunmehr der Gefahr
eines repräsentativen Absolutismus aussetzte."
Ihre heutige Allmacht läßt sich weder mit
Geist und Buchstaben der Gewaltenteilungslehre vereinbaren noch wirklich
mit dem Prinzip der Interessenrepräsentation.
Die Existenz eines Parlaments als solche macht das System
noch nicht zum Parlamentarismus,
ebenso wie ein Verfassungsstaat wie Schweden trotz eines machtlosen Königleins
keine Monarchie im Sinne der Staatslehre; wie ein dem sozialen Gedanken verpflichteter
Staat wie unserer nicht gleich ein Sozialismus und ein dem nationalen Gedanken
verpflichteter Staat wie Frankreich deshalb nicht gleich ein Nationalismus
ist. Der apodiktische "Ismus" rechtfertigt sich erst durch die verfassungsmäßige Allmacht des Parlaments.
Wie in der absoluten Republik die absolute Macht beim regierenden und gesetzgebenden
Staat liegt, ruht sie im Parlamentarismus bei der Gesellschaft in Gestalt
des gesetzgebenden und regierenden Parlaments. Das eine wie das andere
ist als Absolutismus im Prinzip abzulehnen. Wo nämlich der Ismus zum allein selig machenden
Prinzip erhoben wird und keine Götter neben sich duldet, unterdrückt er andere
notwendige Voraussetzungen menschlicher Freiheit. Allein durch das Hinzufügen
der harmlosen Silben ismus kann eine
gefährliche Umwälzung des Wortsinnes bewirkt werden dank ihrer Elastizität.
Eine nur einer fixen Idee verpflichtete Sicht der Welt nennen wir Ideologie, und ihre
praktische Durchsetzung und Unterdrückung anderer Grundwerte ist extremistisch.
So liegt der spezifische Extremismus des Liberalen also darin, daß alle möglichen
Interessen repräsentiert sein dürfen, ausgerechnet das allgemeine Interesse
aber nicht, was mit der rein ideologischen Behauptung gerechtfertigt wird,
diesem sei durch das ungehemmte Wirken der gesellschaftlichen Gruppen
genügt; man könne der jeweiligen Majorität ohne Bedenken die Obhut über das
Allgemeininteresse anvertrauen, die anderen seien ja durch Minderheitenrechte
vor ihrer gänzlichen Vernichtung ausreichend geschützt; sowie durch die
empirisch widerlegte Fiktion, in ein Gremium entsandte Parteienvertreter
könnten dort andere Interessen als die ihrer Partei vertreten. Die Fiktion, die
Repräsentanten von Gesellschaftsgruppen verträten das Wohl aller, ist der
Kern der Herrschaftsideologie Liberalismus.
Ihrer bedient sich zur Zeit die Bonner "politische Klasse" als sozialgeschichtlich
greifbare Gruppe konkreter Menschen. Diese leitet ihre persönliche Macht
aus ihrer Funktion als Repräsentanten ab und rechtfertigt mit ihrer
Herrschaftsideologie den Anspruch gegen alle, ihren Gesetzen Gehorsam zu
leisten.
Folgerichtig erkennen sie jeden auch nur philosophisch gegen
den Liberalismus geführten Angriff als Angriff auf die Grundfesten ihrer
Macht. So urteilte das Verwaltungsgericht Stuttgart im Prozeß einer rechten politischen Partei
um die Rechtmäßigkeit gegen sie eingesetzter nachrichtendienstlicher
Mittel: Die Partei stehe im Verdacht, die freiheitliche demokratische Grundordnung
zu bekämpfen. Sie habe zwar ihr Programm nunmehr geändert, doch habe sie
ihr "Gedankengut nicht grundlegend und vor allem aus innerer Überzeugung
heraus in eine liberalere Richtung
(sic!) geändert." Ohne dies eigentlich juristisch begründen zu können,
erkannten die systemtreuen Verwaltungsrichter instinktiv im Liberalismus
die ungeschriebene Staatsdoktrin der BRD. Tatsächlich sind nämlich alle
Bundestagsparteien einschließlich der Grünen liberal, wenn man den Begriff
korrekt aus der Tradition des historischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts
und seinen politischen Forderungen ableitet. "Heute nennen sich 'Konservative' jene Liberalen, die das
unter den Bedingungen der industriellen Massengesellschaft in jeweils
verschiedenem Ausmaß und Tempo vollziehende Abgleiten (eines Flügels) des
Liberalismus in Positionen der sozialen Demokratie ablehnen."
Das Grundgesetz verwirklicht seiner Konstruktion nach,
vor allem durch das System der Parlamentsregierung, idealtypisch rein
liberale Forderungen. Indem das Gericht der vom Verfassungsschutz beobachteten
Partei ausgerechnet das vorgehalten hat: sie sei nicht liberal!, hat es
schlaglichtartig aufgezeigt, worum es geht: Nicht darum, die Übereinstimmung
oder Abweichung von Parteiprogrammen mit Wesensmerkmalen der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu prüfen; Wie bei dem Streit
um den CDU-Bundespräsidentenkandidaten Heitmann geht es "um die
Herrschaft über die Diskurse, also darum, wer wen zwingen kann, politische
Aussagen moralisch zu legitimieren."
Seit der Wiedervereinigung bröckelt die
linksliberale Hegemonie in der politisch-intellektuellen Öffentlichkeit.
Linke und Liberale merken das und verteidigen mit der Herrschaftsideologie Liberalismus ihre Macht an der entscheidenden
Einbruchstelle. Nur hier können wir sie ideologisch entwaffnen, und erst
dann ist ihre Macht zu brechen.
Es sind also der Parlamentsabsolutismus sowie die "blinden
Flecke" der Verfassung gegen die nicht vorgesehene Macht des Parteienstaates
mittels Verfassungsergänzungen zu beseitigen, und es darf gehofft werden,
daß die Machtträger des bisherigen Systems mit den sie stabilisierenden
Regelmechanismen mittelfristig werden weichen müssen. Ihre
"Stabilität heißt doch mittlerweile nichts anderes mehr als Festgezurrtheit.
Dieser Parteienstaat muß aufgebrochen werden."
Vier Akteure eines Systemwechsels sind denkmöglich: Das System
könnte von den nach dem Grundgesetz vorgesehenen verfassungsmäßigen Gremien
geändert werden, soweit die Ewigkeitsklauseln der Art. 79, und 20 GG es
zulassen. Zweitens könnte das Volk von seiner verfassunggebenden Gewalt Gebrauch
machen und sich in freier, demokratischer Selbstbestimmung gemäß Art.146
GG eine neue Verfassung geben. Drittens könnte eine gesellschaftliche oder
staatliche Machtgruppe putschen und eine andere Verfassung erlassen.
Viertens könnte eine bisher an der gesellschaftlichen und staatlichen Macht
nicht beteiligte Gruppe eine Revolution machen und ein anderes System installieren.
Letztlich könnten mehrere dieser vier möglichen Akteure gemeinsam eine
schleichende Systemänderung bewirken.
Einen bewußten und freiwilligen Systemwechsel dürfen wir von
keinem der gegenwärtigen Machtträger erwarten. Niemand wird sich selbst entmachten.
Die für Verfassungsänderungen zuständigen Staatsorgane wie Bundestag
und Bundesrat sind von Vertretern der Partei- und Sonderinteressen vereinnahmt,
die jeden Änderungsvorschlag sofort als für ihren Machterhalt feindlichen
Akt durchschauen werden. Da sie überdies die medienöffentliche Meinung gut
im Griff haben, sind verfassungsändernde Mehrheiten zugunsten systemüberwindender
Reformen nicht zu erwarten.
Es kommt als systemstabilisierende Klammer um alle zur Zeit
"gesellschaftlich relevanten" Kräfte eine weitgehend homogene
Ideologie hinzu, die auch diejenigen Personen das System verteidigen
läßt, die ökonomisch noch nicht von ihm abhängig sind. Voraussetzung für die
dauernde Herrschaft einer Oligarchie ist ihre Geschlossenheit. Diese kann,
wie beim früheren Geburtsadel, auf verwandtschaftlichen Bindungen, auf
gleichen ökonomischen Interessen, aber auch auf weltanschaulicher
Übereinstimmung beruhen. In Deutschland dominiert heute der linksliberale
Mainstream des derzeitigen BRD-Establishments, der, aus dem Geiste der
1968-Studentenrevolte geboren, seinen Marsch durch die Institutionen
erfolgreich beendet hat. Die revolutionäre Linke von 1968 hatte das
damalige Establishment als illegitim bekämpft und seine Throne umgestürzt,
auf denen es sich selbst bequem gemacht hat. Bekanntlich sind die Revolutionäre
der Gegenwart die Reaktionäre der Zukunft. Die 68er haben ihre revolutionäre
Gegenwart schon hinter sich, und verbissen verteidigen sie ihren Einfluß von
den errungenen Posten in Parteien und Medien herab gegen jede ideologische
Diversion. Ihre wütende Verteidigung gegen den Zangengriff der jüngeren,
nachdrängenden Generation und einzelner aus der Generation der Großväter
trägt alle Züge eines Kulturkampfes.
Schon Robert Michels
hatte 1911 festgestellt: Im
Besitze der Macht geht in dem Revolutionär eine Umwandlung vor, an deren Endpunkt
er, wenn nicht der weltanschaulichen Legitimation, so doch der Substanz
nach, den Entthronten so ähnlich wird wie ein Haar dem anderen.
Soziologischer Beobachtung nach findet normalerweise kein
völliger Elitenaustausch statt, sondern eine Verschmelzung des nach oben
drängenden Neuen mit dem Alten. So gehen die Revolutionäre nach einer Periode
glorreicher Kämpfe und einer Periode ruhmloser Teilnahme an der Herrschaft
zuguterletzt in der alten dominierenden Klasse auf. "Jedoch gegen sie
erheben sich namens der Demokratie wieder neue Freiheitskämpfer. Und
dieses grausamen Spieles zwischen dem unheilbaren Idealismus der Jungen
und der unheilbaren Herrschsucht der Alten ist kein Ende. Stets neue Wellen
tosen gegen die stets gleich Brandung. Das ist die tiefinnerste Signatur der
Parteigeschichte."
Heute sind wir unten, wir sind die Welle, die
"revolutionären Freiheitskämpfer". Wir dürfen von denen da oben
nichts erwarten, gar nichts. Sie werden uns den Gefallen nicht tun, uns einen
1.Klasse-Fahrschein in den Bundestag zur Verfassungsänderung zu schenken.
Nur Naive und im Grunde Unpolitische können übersehen, daß die Bonner
"politische Klasse", nach einem bekannten Wort Heinrich Bölls
, mit rattenhafter Wut die
verfaulenden Reste ihrer Macht verteidigt. Ihr Wille, oben zu bleiben,
ist ein ganz unbändiger, und nur wer persönlich hinter die schönen Kulissen
geblickt hat, vermag die völlige Skrupellosigkeit und den im schlechten
Sinne machiavellistischen Willen zum Machterhalt in seinem ganzen Ausmaß
zu überschauen.
Das Hoffen auf eine Revolution hat in gewissen Kreisen alle Züge messianischer Heilserwartung
angenommen. Die fixe Idee der Crash-Theorie,
hier werde in absehbaren Jahren irgend etwas umgestoßen werden können oder
von selbst in sich zusammenbrechen, ist nichts als ein von eschatologischen
Vorstellungen genährter frommer Wunsch. Wie mittelalterliche Christen vor
runden Daten wie dem Jahre 1000 ihr Hab und Gut verschleuderten, weil sie die
Wiederkehr Christi oder das jüngste Gericht als unmittelbar bevorstehend erwarteten,
so übt die Vorstellung, "das System" werde demnächst zusammenbrechen,
kurz vor dem Jahr 2000 eine starke Faszination aus. Dieser Glaube hat vor
allem die praktische Wirkung, den Gläubigen von jedweder tatsächlichen
politischen Tätigkeit abzuhalten. Vor allem Rechte mit linker oder
marxistischer Vergangenheit haben die fixe Idee in ihre neue politische Heimat
importiert, die Geschichte müsse dem Sog historischer
Notwendigkeiten folgen und zwangsläufig die eine oder andere Richtung nehmen. Da man den Liberalismus und andere
politische Phänomene als historisch
widerlegt betrachtet, erwartet man für die nächsten Jahre seinen Zusammenbruch.
Dann werde eine neue Elite wie der Deus ex machina aufstehen und das Vaterland
retten. Daß es - aus rechter Sicht - immer weiter abwärts gehen oder daß es
etwa am "Ende" überhaupt keinen Sieg geben könnte, können sich die
zur Vaterlandsliebe bekehrten Linken überhaupt nicht vorstellen.
Vielleicht wird es ja auch so kommen, wie sie prophezeien.
Zu bestreiten sind derartige gläubige Zukunftserwartungen jedenfalls nur
mit konträren gläubigen Erwartungen und kaum mit Argumenten. Für die
Gegenwart läßt sich aber eine Auswirkung solcher Endzeiterwartung klar
feststellen: Zur Zeit ist diese neue Elite noch damit beschäftigt, mit dem
Hut herumzugehen und um fünf Mark zu betteln, wenn sie eine geistreiche
rechte Zeitschrift verschicken will. Ihr erklärter Unwille zur Organisations-
oder gar Parteibildung führt zu ihrer weitgehenden Wirkungslosigkeit.
Diese Haltung wird mit der These entschuldigt, jede Parteibildung wirke
innerhalb des Verfassungsbogens systemstabilisierend, während eine
verfassungsbekämpfende Partei verboten werden würde. Die Richtigkeit
dieser These hängt aber von der Partei, ihren Strukturen und den sie
führenden Politikern oder lenkenden Strategen ab. Eine spiegelbildliche
Debatte hat sich vor einigen Jahren in den Reihen der GRÜNEN abgespielt und
mündete in die Differenzierung in Realos und Fundis: In der Bekämpfung des
System war man sich einig, nur ob man dies besser von innen oder von draußen
bewerkstelligen könne, stand zur Debatte. Diese ist von der Geschichte noch
nicht entschieden.
Ein Revolutionär, der sich für seine Schicksalsstunde
Chancen erhofft, darf nicht so weltfremd sein, diese Stunde unorganisiert
und blind auf die Gunst des Schicksals oder "historische Notwendigkeiten"
vertrauend kommen zu lassen. Für einen Putsch oder eine Revolution fehlt
es in Deutschland an allen Voraussetzungen; vor allem fehlt es an Revolutionären,
die diesen Namen verdienen. Der deutsche Michel, wenn er sich als
Revolutionär versucht, kauft sich nach einem bekannten Satz Lenins erst eine
Bahnsteigkarte, bevor er den Bahnhof stürmt. "Zur parlamentarischen
Mitwirkung gibt es" im Geltungsbereich der Spielregeln des Parlamentarismus
nun einmal "keine echte Alternative. Die Möchtegern-Intellektuellen, die
in verschwiegenen idyllischen Waldorten abendelang in Revolutionsszenarien
schwelgen und über den Untergang des Parteiensystems philosophieren,
sind Relikte einer längst vergangenen Zeit. Die selbsternannten Dezisions-Theoretiker
und Politapokalyptiker eint, bei genauem Hinsehen, die praktische
Politikunfähigkeit und der mangelnde Wille zur Macht."
Zudem sind alle systemeigenen Abwehrinstrumente gerade
auf einen gedachten Umsturz von "rechts" geeicht und zugeschnitten,
von der Beobachtung durch den "Verfassungsschutz", der Verwirkung
von Grundrechten und dem Parteienverbot bis zum Widerstandsrecht des
Art.20 Abs.IV GG. Die Parolen der wehrhaften
Demokratie lauten: "Augen rechts!" und "Wehret den Anfängen!",
und darum sind vor der "rechten Gefahr" alle Türen fest
verrammelt: die gesetzlichen Türen zur Macht und die Medientüren in die
Köpfe der Menschen. Ganz abgesehen von der Frage der Legitimität eines
gewaltsamen Staatsstreiches oder einer Revolution: Hier gibt es keinen tatsächlich
gangbaren Weg.
Wer fest in der Mausefalle sitzt, muß als erstes versuchen,
diese zu lockern. Das selbstreferentielle Bonner System ist eine solche Mausefalle.
Wie man sie auch dreht und wendet: Die systemimmanente Logik führt wie ein
Teufelskreis immer wieder zum System zurück. Nichts scheint sich hier zu bewegen.
Wenn sich allerdings auch nur irgendwo ein bewegliches Scharnier finden
ließe, wäre die Hintertür gefunden, durch die man vielleicht doch in System
einbrechen und über diese taktische Zwischenlösung zum Ziel gelangen
könnte. Tatsächlich gibt es einen deutlichen Riß im Gebäude des Bonner Systems,
einen wunden Punkt, einen eingebauten Denkfehler im System. Dieser liegt im
nicht eingelösten Anspruch des Bonner Parlamentarismus, eine demokratische
Volksherrschaft zu sein. Wer wie wir die Strukturmerkmale von Demokratie
und Parlamentarismus miteinander verglichen hat, weiß natürlich, daß
die beiden Ideenkreise einander teilweise ausschließende Begriffsmerkmale
aufweisen. Der Parlamentarismus ist natürlich keine Demokratie, und daran
ist auch aus Sicht seiner Verfechter nichts Aufregendes, weiß man sich doch angesichts
des utopischen Moments der Demokratie
mit dem Prinzip "demokratischer Repräsentation" so demokratisch wie real nur irgend möglich. Doch wissen das die Bürger? 1968 sind
doch auch Tausende der scheinbar neuen Erkenntnis auf den Leim gegangen,
daß in Deutschland, bei Lichte betrachtet, eine ganze Menge zu "demokratisieren"
ist. Der utopisch-emanzipatorische Impuls, für jeden größere demokratische
Mitsprache einzufordern, hat sich als äußerst kraftvoller Motor der Destabilisierung
von Herrschaftsstrukturen erwiesen.
Der demokratische Anspruch des Bonner Systems ist zur
Doktrin erstarrt. Millionen gläubiger Bürger haben ihn so verinnerlicht,
daß allein schon der Gedanke, nicht in demokratischen Verhältnissen zu
leben, nur einen allgemeinen Aufschrei der Empörung zur Folge haben kann.
Die Masse der Deutschen ist mit Leib und Seele Demokrat - oder was sie selbst
so darunter versteht. Solchen Gläubigen kann man nicht mit akademischen
Spitzfindigkeiten in der Art kommen, die Demokratie sei eine Utopie, und
deshalb sollten sie sich mit der Herrschaft ihrer Repräsentanten über sie
selbst auf unabsehbare Zeit abfinden. Wie viele DDR-Nostalgiker heute noch
an ihren Sozialismus glauben, der
nur nicht richtig verwirklicht worden sei, so spukt in der Köpfen der meisten
Bundis eine fundamentalistische Idee von Demokratie nebulös herum, die mit äußeren Kennzeichen wie Meinungsfreiheit und theoretischen
Mitwirkungsmöglichkeiten am politischen Geschehen wie Wählengehen verbunden
ist. Es ist ganz ausgeschlossen, an die Stelle des Gottes der Demokratie
einfach mal so irgend einen anderen Gott zu setzen. Wir können die herrschenden
Liberalen nur ideologisch entwaffnen, wenn wir unsere Forderungen im demokratischen
Gewand der direkten Berufung auf das Volk präsentieren.
Die metaphysisch überhöhte Gläubigkeit an die Demokratie
gleicht in unserem Jahrhundert einer Massenpsychose, die sogar Potentaten
mit unzweifelhaft diktatorischen Gelüsten zum demokratischen Etikett
greifen ließ: "Man denke an die 'gelenkte Demokratie' des früheren indonesischen
Präsidenten Sukarno
, an die 'organische Demokratie' des
spanischen Diktators Franco
, an die 'wahre Demokratie'
des libyschen Staatschefs Khadafi,
an den Begriff 'demokratische
Diktatur' des Marxisten Georg Lukács
oder gar an die nach 1945 in
Mittel- und Osteuropa geschaffenen 'Volksdemokratien'." Selbst
Hitler nannte sich einen "Erzdemokraten",
und Goebbels
rühmte am 19.3.1934 den nationalsozialistischen
Führerstaat als "die edelste Form der europäischen Demokratie".
Alle diese Herren meinten natürlich nicht
eine Regierungsform Demokratie, sondern Demokratie als Staatsform; und so
regierten sie angeblich auf Grundlage der Souveränität des Volkes, ohne
dieses allerdings häufiger als eben nötig nach seiner Meinung zu fragen.
Jedwede Regierungsform kann sich mit der Behauptung als demokratisch
bezeichnen, das Volk wolle es so, ob ein Diktator die tatsächlichen
Entscheidungen trifft, ein Bürgerkönig oder ein Parlament. Die Mehrzahl
unserer braven, biederen Deutschen hält den faktischen Parlaments- und
Parteienabsolutismus für demokratisch. Sie ist durch die Gewohnheit jahrzehntelanger
Indoktrinierung von der Schulbank an mit den inneren Beweggründen
randvoll gefüllt, die sie für demokratisch
hält. Sie hat den demokratischen Anspruch unseres Staatswesens so verinnerlicht,
daß sie sehr böse werden könnte, wenn sie einmal bemerken sollte, daß die
scheinbare Demokratie nur Fassade vor der Macht von Interessentencliquen
ist. Einen Eindruck davon gibt uns die Wut linksextremer Demonstranten
gegen einschreitende Polizeibeamte als Vertreter "des Systems."
Seit immer offensichtlicher wird, daß jene Interessentencliquen
nur noch ihre eigenen Machtprobleme kennen und nicht die Probleme der
Mehrheit des Volkes lösen, hat ein massiver Prozeß des Nachdenkens und des
Mißtrauens eingesetzt. Von der Verdrossenheit über einzelne Skandalpolitiker
wendet sich der erstaunte Blick langsam auf die Parteien und ihr System und
den einzig gangbaren Weg aus der Misere: Dieser führt über das taktische
Zwischenziel einer möglichst umfassenden Durchlöcherung des selbstreferentiellen
Repräsentativsystems durch Instrumente der direkten Demokratie. Hans
Herbert von Arnim
meint, hier noch zwei Wege zu
sehen: "Innerhalb des Systems gibt es wohl nur zwei Wege, an den alle
Schlüsselstellungen beherrschenden Parteien vorbei etwas zu bewirken: die
Gründung neuer Parteien und das Herbeiführen von Volksentscheiden."
Es spricht viel dafür, den erstgenannten Weg als empirisch
widerlegt anzusehen. Das gilt jedenfalls, wenn man ihn am angestrebten Erfolg
der Regierungsbeteiligung mißt. Die praktische Erfahrung in einer mit den
Herrschenden konkurrierenden neuen Partei fehlt dem Professor von Arnim; vor
allem aber die Erfahrung am eigenen Leibe, wie Medien und Establishment mit
einer parteipolitischen Konkurrenz umspringen. Dazu müßte er als Theoretiker
erst einmal zum Parteiführer und dem Establishment praktisch gefährlich
werden. Er müßte eine Reportage von Monitor,
Panorama und Konsorten über ihn sehen, in der ihn seine eigene Mutter
nicht wiedererkennen würde; er müßte am nächsten Tag erleben, wie
Autonome unter deeskalierend zuschauenden Polizeibeamten seinen Parteitag
sprengen, weil sie in Monitor gesehen
haben, daß er eigentlich ein Nazi sei; er müßte ein Verwaltungsgerichtsverfahren führen, um erst die
Stadthalle anmieten zu können, und ein zweites gegen den Staat, der seinen
Parteitag wegen befürchteter autonomer Ausschreitungen verbot. - Nein:
nur das Volk selbst kann heute überhaupt noch etwas bewegen; und wenn sich
alles wieder bewegt, wird man weitersehen können.
Dem Pochen auf den nicht eingelösten demokratischen Anspruch,
der Forderung nach Volkswahl politischer Mandatsträger und nach Volksgesetzgebung
und -entscheid haben die Parlamentaristen kein populäres Argument entgegenzusetzen.
"Daß die Bürger über wichtige Fragen in Volksabstimmungen selbst
entscheiden können, gehört für 60% im Westen und 72% im Osten unbedingt zur
Demokratie. Unter solchen Umständen läßt sich über repräsentative oder plebiszitäre
Demokratie nicht diskutieren. Man kann sich aber auch die Enttäuschung
vorstellen, wie wenig die deutsche Realität den vermeintlichen Versprechen
der Demokratie entspricht."
Gerade vielen linken Demokraten erscheint
ein Plebiszit allemal einleuchtender als eine vom Volke abgehobene
Repräsentation. Das Plebiszit ist die Achillesferse des Parlamentarismus,
und das wissen seine politischen Strategen sehr genau. Nicht umsonst stoßen
alle plebiszitären Forderungen überall dort auf erbitterten Widerstand,
wo die CDU das Sagen hat. Für drohenden Machtverlust hat man im Konrad-Adenauer-Haus
eine ausgezeichnete Nase. CDU-Vordenker und unionsnahe Verfassungsrechtler
sprechen sich regelmäßig gegen jeden Ansatz zu plebiszitären Lösungen
aus. So hat der Bonner Professor Isensee
seinen Carl Schmitt
gut gelesen, wenn er im Grundsatzmagazin
der Konrad-Adenauer-Stiftung erkennt: "Schon die offizielle Einleitung
einer Volksabstimmung führt dazu, der geltenden Verfassung Legitimation
zu entziehen."
Recht hat er! Aber genau das ist notwendig,
weil das Bonner Postenverteilungskartell, dem Isensee nahesteht, seine innere
Legitimation und seine äußere Legitimität aus eben diesem Verfassungs-
und Gesetzgebungssystem zieht und nur durch dessen Änderung gesprengt
werden kann. Ebenso wie Isensee argumentiert sein Kölner Kollege Hartmut
Schiedermair: Plebiszite mit ihrem genau einkalkulierten Konflikt zwischen
Volk und Parlament seien geeignet, das parlamentarische System zu schwächen.
Das Repräsentationssystem beruht auf einem tiefsitzenden Mißtrauen
der Regierenden gegenüber dem Volk. Ihm mißtrauten schon die Schöpfer des
Grundgesetzes 1949 und vermieden absichtlich jedes unmittelbare Entscheidungsrecht,
weil sie das Volk auch nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches noch nationalsozialistischer
Neigungen für fähig hielten. Gerade linksliberale Fundamentalisten
halten heute noch das Volk für durchaus unsichere Kantonisten: So gestand
1991 der Kieler SPD-Politiker Norbert Gansel der britischen Zeitung The Spectator, seine persönliche Philosophie
beruhe auf einem Element des Mißtrauens gegenüber den Deutschen, die er
vertrete, weil ihre Väter und Großväter Hitler möglich gemacht hätten. Obwohl dieses Grundmotiv bis heute überall
hinter vorgeschobenen Scheinargumenten erfühlbar ist, wird es selten so
offen zugegeben. Vielmehr versucht man, Plebiszite mit den üblichen, keinen
Widerspruch duldenden Stereotypen aus dem Handbuch der Bewältigungspädagogik
madig zu machen. So gehören Volksentscheide nach christdemokratischer Ansicht
"zu den abgefeimten Techniken totalitärer Diktaturen." Im Plebiszit
sei nämlich derjenige souverän, der die Frage formuliert. Das Volk, so
weiß man in der CDU, ist ein bißchen dumm, und außerdem neigt es zum Wählen
schlimmer Parteien: Als die CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg
im April 1992 die absolute Mehrheit verloren hatte, sprachen ihre
Vorstandsmitglieder im Konrad-Adenauer-Haus bei lautem Nachdenken aus,
man müsse angesichts der Uneinsichtigkeit der Wähler eine
"erzieherische Politik" betreiben.
Damit die feinen Herrschaften des Bonner Parteienkartells
unter sich bleiben dürfen, muß das Volk also von jeder direkten Mitwirkung
ferngehalten werden, vor allem aber von den entscheidenden Hebeln der
Macht. Die wirkungsvollsten wären die Direktwahl eines Bundespräsidenten,
der über die Person des Kanzlers zu befinden hätte, und die Volksentscheidung
von Verfassungsfragen und Fragen der Tagespolitik. Das französische Volk
hat solche Rechte. Die Schweizer entscheiden durch Abstimmung traditionell
selbst über politische Grundsatzfragen. Das deutsche Volk ist nach christdemokratischer
Ansicht dafür offenbar zu unreif. Die Unionsjuristen wehren sich gegen
die Ausübung der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes mit Händen und
Füßen und verraten damit, welch schlechtes Gewissen sie haben angesichts
ihrer "Art, wie Macht ausgeübt und mißbraucht wird."
Panisch beschwört der Münchener Ordinarius Peter Badura
die Legitimität des Parteiensystems
und treibt jeden Gedanken an die verfassunggebende Gewalt des Volkes in
exorzistischer Manier aus: Es "ist die verfassungsgebende Gewalt nicht eine Kompetenz- oder Verfahrensregel
des Rechts oder der Politik, sondern eine Doktrin zur Herbeiführung oder
zur Legitimierung einer revolutionären Staatsumwälzung.
...
Abwegig ist es, aus
einer geltenden Verfassungsnorm einer legitimen Verfassung, dem Art.146
des Grundgesetzes, das Gebot zu entnehmen, dem Volk das Revolutionsinstrument
der verfassungsgebenden Gewalt zur möglichen Abschaffung eben dieser Verfassung
in die Hand zu geben."
Daß die Apologeten und Nutznießer des Liberalismus bei der
bloßen Erwähnung des Wortes Plebiszit wütend aufheulen, zeigt uns, daß wir
hier ihren einzigen wunden Punkt getroffen haben. Hier können sie
zappeln, solange sie wollen. Sie kommen nicht ohne Verstoß gegen ihre
eigenen demokratischen Prämissen aus dem Dilemma, weil diese demokratischen
Prämissen mit denen des Liberalismus und seinem Repräsentativgedankens
in Wahrheit unvereinbar sind.
Was die Verteidiger des Status quo auch tun -
sie können nur Fehler machen. Das Demokratieprinzip als tragender, aber
unverwirklichter Wert des Systems muß zur Angriffswaffe umfunktioniert werden,
weil die systemimmanenten Abwehrmechanismen dann nicht greifen.
Gibt das System nach und läßt die Volksgesetzgebung
zu, öffnet es damit nämlich weit das Tor zu seiner eigenen möglichen Veränderung
und Abschaffung durch das Volk. Damit wäre das taktische Zwischenziel
erreicht und die Zukunft wieder offen.
Gibt das System aber nicht nach, kann es als undemokratisch
"entlarvt" werden, bis die Zahl seiner Verteidiger so weit
abnimmt, daß es dem Veränderungsdruck nicht mehr standhält. Als Anlaß für
solche Operationen eignet sich hervorragend die Forderung nach Volksentscheid
über alle jene Reizthemen, in der die demoskopisch ermittelte Meinung einer
von Lösungsinkompetenz der Politiker genervten Bevölkerung auf den
entschlossenen Widerstand des Parteienestablishments treffen wird, das
hinter dem Plebiszit schnell die Gefahr des Systemwechsels am Horizont erkennen
und daher keinen Volksentscheid zulassen wird.
Gewöhnlich wird jeder Gedanke an plebiszitäre Mitwirkungsrechte
des Volkes umso entschiedener verworfen, je weiter jemand
"rechts" steht und der Weisheit derjenigen wenig zutraut, die zufällig
die meisten sind. Umgekehrt erhofft man sich vom Plebiszit als Mittel der
"Basisdemokratie" geradezu den allumfassenden Schlüssel für die
Hauptprobleme unserer Zeit, wenn nicht die Aufhebung der Herrschaft des
Menschen über den Menschen, je weiter man "links" steht und dem
Idealbild des von Natur aus vernünftigen, autonom entscheidenden Individuums
anhängt. Die skeptische, "rechte" Position hat Günter Maschke mit
dem Argument auf den Punkt gebracht, wir müßten das Grundgesetz verteidigen,
wie es ist, "weil das, was ein inzwischen völlig umerzogenes Volk daraus
machen würde, eine noch schlechtere Verfassung wäre." Der größte Fehler
von Rechten sei ihr Rousseauismus, der von seinem linken Pendant gar nicht
weit entfernt sei. Die Rechte glaube, das Volk sei gut; nur der Magistrat
sei korruptibel: "Das ist das Gerede, daß das Volk manipuliert werde
von den Politikern, die es unterdrücken, und in Wahrheit haben wir die totale
Demokratie - das ist ja die Misere! Wir haben ein System, in dem oben die
gleiche Moral bzw. Amoral herrscht wie unten. Man regt sich auf über Parteienfinanzierung,
Lügen, Korruption etc.... Aber Lüge und Korruption und 'nichts als Geld' sind
doch schon längst Volkssport geworden. Die BRD wird peu a peu ein orientalisiertes
Land, weil die staatlichen Strukturen nicht mehr funktionieren, weil es, bis
rauf in die Bürokratie, kein Staatsethos mehr gibt. Die vollkommene Demokratie,
das ist die Universalisierung des Schweinchen Schlau, und die haben wir
doch. Und deshalb verpufft der Unmut über die "politische Klasse" so
rasch. Die Leute haben oft eine Ahnung davon, daß sie sich ganz genauso verhalten
würden, genauso von partikularen Interessen determiniert."
Eine andere Idee, den Motor notwendiger Veränderung wieder
anzuwerfen, hat Günter Maschke
aber auch nicht. Und selbst
wenn eine Mehrheit "Panem et circenses" rufen und Rudi Carell zum
Kanzler wählen würde, gilt doch: Wenn man ganz unten ist, kann es eigentlich
nur noch aufwärts gehen. Gegenüber der Notwendigkeit, daß sich erst einmal
überhaupt etwas bewegt, muß Maschkes berechtigter Einwand als zweitrangig
zurückstehen. Verkehrt man alle Begriffe seiner Kritik in ihr Gegenteil,
spürt man hinter seinem Abscheu gegenüber dem jetzigen Zustand der
Gesellschaft die positive Vision eines hohen, das Allgemeinwohl
einfordernden Staatsethos durchschimmern: Maschkes Sehnsucht nach einer besseren
Welt - vielleicht eines idealen Staates. Die alles entscheidende Frage aber,
wie er dorthin kommen möchte, läßt er unbeantwortet.
Bekanntlich gelangt man erst durch Mühe zu den Sternen,
manchmal vielleicht auch auf Umwegen. Auf die Jakobinerdiktatur von 1792
war schließlich auch nicht sofort Napoleon gefolgt. Erst hatte der Pöbel
sich einmal kräftig austoben müssen. Erst hatte Frankreich durch das Tal der
Tränen und der Ochlokratie gemußt, bis Überdruß am Guillotinieren und
Erschöpfung die überlebenden Revolutionäre einsehen ließen, daß ein bestimmtes
Maß an überparteilicher, ordnender Staatlichkeit zum Vorteil Aller wäre.
Dieser Einsicht folgte ein qualitativer Sprung: Dieselben Massen, die noch
die Bastille gestürmt, den König geköpft und die Fahne der Gleichheit über
Europas Schlachtfelder getragen hatten, wählten Napoleon 1799 mit 3 Millionen
gegen 1562 Stimmen und erneut 1802 zum Alleinherrscher auf Lebenszeit.
Statt "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" schallte "Vive le empereur!" durch Frankreichs Straßen.
Hinter diesen nur scheinbar paradoxen Vorgängen stehen allgemein
gültige Gesetzmäßigkeiten. Vom Kreislauf der Staatsformen waren schon
Aristoteles
und Polybios
überzeugt: Auf das Königtum, die Herrschaft
des dem Allgemeinwohl verpflichteten Tüchtigsten, folgt als Entartungserscheinung
die Tyrannis des eigensüchtigen Diktators. Dieser wird von wenigen der
Edelsten gestürzt. Deren Aristokratie neigt zum Umschlagen in eine eigensüchtige
Oligarchie. Diese wird vom Volk gestürzt, das mit der Demokratie die höchste
Staatsform verwirklicht. Auf die Dauer gewinnt in ihr aber der Pöbel die Oberhand
und tobt sich in einer Ochlokratie aus, bis ein Tüchtigster das zerrüttete
Staatswesen wieder aufrichtet und der Kreislauf mit ihm als König von neuem
beginnt. - Diese klassische Staatsformenlehre läßt sich heute natürlich
nicht wortwörtlich als Patentrezept anwenden. Gegenüber der herrschenden
Doktrin unwandelbarer Verfassungsklauseln, wonach es aus den historischen
Niederungen vorsintflutlicher Zeiten immer nur linear aufwärts gehe bis
zu irgendeinem Ende der Geschichte in einem idealen Staat, wirkt die
bescheidene Einsicht der Antike in die Vergänglichkeit und Wandelbarkeit
gesellschaftlicher Organisationsformen erfrischend realitätsnah.
"Sobald die Demokratie ein gewisses Stadium ihrer Entwicklung
erreicht hat, setzt ein Entartungsprozeß ein; sie nimmt aristokratischen
Geist, bisweilen auch aristokratische Formen an und wird dem immer ähnlicher,
gegen das sie einst zu Felde zog. Dann entstehen ihr aus ihrem eigenen Schoß
neue Ankläger, die sie der Oligarchie zeihen."
Am 9.November 1918 waren die Demokraten voller Idealismus
aufgebrochen, eine verknöcherte und privilegierte wilhelminische Oberschicht
abzulösen. Bis 1994 haben sie es geschafft, der dekadenten
Adelsoberschicht des Kaiserreichs in allen ihren abstoßenden Zügen ähnlich
zu werden: Sie haben eine neue Obrigkeit gebildet, und wo 1914 Adelsdünkel
vorherrschte, dünken sich heute selbsternannte politische Tugendbolde über
das einfache Volk erhaben, das man nach einer "falschen" Wahl nur
"besser erziehen" muß. Wo früher Adelsprivilegien bestanden,
mästen sich heute Exponenten des modernen Feudalsystems an gedeckten
Aufsichtsratstischen und anderen Pfründentrögen. Das BRD-Establishment hat
tief in die Pandorabüchse der Macht gegriffen und sich alle menschlichen
Schwächen angeeignet, die als Strafe auf ihren Genuß folgen; nur die Tugend
hat es auf dem Grund der Büchse liegengelassen und schnell den Deckel geschlossen:
nämlich die Tugend der Pflichterfüllung gegenüber den Regierten. Wo der
wilhelminische Adel bei aller Dekadenz und allem Dünkel ein strenges,
auf das Gemeinwohl bezogenes Staatsethos besessen hatte, wo Adel verpflichtete,
erlaubt sich unsere demokratische Parteiobrigkeit alles. Mit den Worten
Erwin Scheuchs ist die Politikerkaste zu einem "selbsternannte Adel verkommen",
der sich die Taschen füllt, ohne dabei die geringsten Skrupel zu empfinden.
1918 hatte es mächtiger Anstöße von außen bedurft,
die Vorherrschaft der alten Stände zu brechen. Heute sind Krieg, Revolution
oder Putsch weder in Sicht, noch wären sie wünschenswert. Das einzige Instrument,
das in sich geschlossene Kartell der neuen Obrigkeit aufzubrechen, ist
die Souveränität des Volkes. Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Mythos.
Heute erfüllt der Glaube, daß alle Gewalt vom Volk komme, eine ähnliche
Funktion wie früher der Glaube, daß alle obrigkeitliche Gewalt von Gott komme.
Das Schwert dieses Glaubens muß gegen die
Bonner Parteienoligarchie geführt werden, weil alle anderen Waffen
stumpf sind.
Nur durch Aktivierung des Volkes kann es
gelingen, dem Parteienabsolutismus entgegenzuwirken.
-
Die Bonner "politische
Klasse" führt uns ins Brüsseler Multikultopia. Dort werden wir erst unsere
Souveränität verlieren. Diese ist nach Jean Bodin
die innere Kraft des Zusammenhalts,
ohne die das politische Gemeinwesen zerfällt. Ohne sie wird es uns in einigen
Jahrzehnten als Volk nicht mehr geben. In der kurzen, uns noch übrigen Zeit
eigenstaatlicher Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung muß das Bonner
Establishment auf demokratischem Wege durch Entscheidung der Mehrheit des
Volkes entmachtet werden, wenn unser Land eine deutsche Zukunft haben soll.
Nur das Plebiszit kann dies leisten. Weil es zu einer
"impliziten Abwertung des Parlaments" führen wird, ist es nicht etwa
abzulehnen,
sondern aus genau diesem Grund zu begrüßen.
Und wenn Maschke warnt, bei der derzeitigen Degeneration des Volkes würden
sich die Rechten ganz schön wundern, was bei einer Änderung der Verfassungslage
herauskäme, würden sich die zahlreichen linken Befürworter des
Plebiszits wahrscheinlich noch mehr wundern, was das deutsche Volk zur Zeit
noch mehrheitlich zur multikulturellen Gesellschaft sagen würde, zur Ausländereinwanderung,
der Abschaffung der Mark und dem Weg in die Brüsseler Eurokratie. Ein
klein wenig muß man seinen Landsleuten auch mal vertrauen können. Und sollte
das Volk wider Erwarten weiter den radikalliberalen Rattenfängern hinterherlaufen
und seiner eigenen Abschaffung zugunsten eines Brüsseler Multikultopia
zustimmen, hat es wenigstens nachher den kleinen Trost, aus freiem Willen
gehandelt zu haben und nicht nur durch frei schwebende Führungsoligarchien
behandelt worden zu sein. -
Die gesetzestechnische Einfügung des
Plebiszits in das Grundgesetz und der Erlaß näherer Ausführungsgesetze bieten
keine juristischen Schwierigkeiten und sind daher hier nicht näher
darzustellen. In einigen Landesverfassungen sind inzwischen Volksbegehren
und -entscheid vorgesehen, wenn auch nicht im hier geforderten Umfang. Auf
Einzelheiten der mannigfachen Möglichkeiten zur Regelung von Einzelfragen
wie der des erforderlichen Quorums für Volksbegehren kommt es für unseren
Zusammenhang nicht an.
Für das angestrebte taktische Ziel genügt
die Forderung, dem Volk möglichst umfassende Rechte zur Mitwirkung bei
den Fragen einzuräumen, die sein Wohl und Wehe als Ganzes berühren.
Volksinitiativen und -entscheide sind sowohl über Landes- und Bundesgesetze
wie auch wegen administrativer Einzelfragen denkbar wie über die Nutzung
der Kernkraft, der Größenordnung des erwünschten Ausländerzu- oder
-wegzugs oder den Einsatz der Bundeswehr als Hilfstruppe der UNO bzw. der
USA.
In der Öffentlichkeit kann für solche Plebiszite das unbestreitbare
verfassungsrechtliche Argument ins Feld geführt werden, daß das Grundgesetz
in Art.20 Abs.II einen ausdrücklichen, aber bisher nicht erfüllten Auftrag
zur Beteiligung des Volkes an der Staatsgewalt enthält: "Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt." Die Parteien haben sich bisher gescheut, dem Volk durch Gesetz
das in der Verfassung vorgesehene Recht der Abstimmung, also des Plebiszits,
in die Hand zu geben. An der Vereinbarkeit dieses Rechts mit der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung kann es nicht nur keinen Zweifel geben; das
Grundgesetz verlangt sogar ausdrücklich danach. Da alle Staatsgewalt vom
Volke ausgehen und dieses nicht nur durch Organe, sondern auch selbst handeln
können soll, steht das Volk über seinen Organen, so daß kein Organ von vornherein
und ohne triftige Gründe von einem Rückholrecht des souveränen Volkes ausgenommen
werden sollte: Wo der Vertretene selbst entscheiden will, muß der Vertreter
zurückstehen.
Das Plebiszit ist, wie jede Wahl, "das elementarste
Sicherheitsventil gegen oligarchische Giftdämpfe."
Es ragt aber nicht bloß als Destruktionswaffe
hervor, indem es das Repräsentativprinzip durchlöchert, jenes Bollwerk
der Parteienmacht. Es ist vielmehr in Gestalt einer Volkswahl des Bundespräsidenten
auch konstruktiv unentbehrlich. Unter demokratischen Prämissen muß jede
Regierung, überhaupt jede Staatstätigkeit, durch eine Wahl demokratisch
legitimiert sein. Die Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk
wie in der Weimarer Republik und heute in Frankreich wäre eine solche Legitimation.
Sie würde eine volle Nutzung des Präsidentenamtes im Rahmen des Verfassungssystems
ermöglichen. Heute ist das wegen der doppelt indirekten Wahl des
Präsidenten nicht möglich: Der prozeduralen Distanz zwischen Volk und Präsidentenamt
entspricht die geringe Kompetenz seines Inhabers. Die innere Logik des
Liberalismus will mit möglichst wenig Staat auskommen und benötigt die
Amtsfunktion eines regierenden Staatsoberhauptes nicht.
Wir brauchen aber das Präsidentenamt konstruktiv für die die
gewaltenteilende Trennung von Staat und Gesellschaft und um das Repräsentationsdefizit
bezüglich des Gemeinwohls zu füllen. Das kann das Amt nach heutigem Verfassungszustand
nicht leisten. In der Zeit des Fürstenabsolutismus hatte sich der Staat
gegenüber der Gesellschaft in der Person des Monarchen verkörpert, seinen
Ministern und seinem Heer. Zwischen ihm und der gesellschaftlichen Repräsentation,
dem Parlament, hat seit Einführung konstitutioneller Verfassungen in
Deutschland bis 1918 meist ein Schwebezustand geherrscht. Beide Gewalten
hielten ein Machtgleichgewicht, obwohl jede Seite die anderen gerne überwunden
hätte. Es liegt in der Logik des Gegensatzes zwischen Staat und Gesellschaft,
daß jede Seite gern zur Absolutheit werden möchte. Solange das keiner Seite
gelingt, sind wir Bürger so frei wir irgend möglich. Abgesehen von behebbaren
demokratischen Schönheitsfehlern wie einem ungleichen Wahlrecht hatte die
Reichsverfassung vom 16.4.1871 diese Grundbedingung bürgerlicher Freiheit
erfüllt, indem sie Staat und Gesellschaft trennte. Monarchie nannte sie sich
zwar noch in dem Sinne, in dem heute Länder wie England und Holland Monarchien
heißen. Der Verfassungsform nach aber hatte das Reich "mit der
Monarchie gebrochen, denn es [war] eine Republik." Sein Kaiser, seufzte ein
Monarchist, war rechtlich "der Präsident einer Republik, welchen man
überein gekommen [war], Kaiser zu nennen."
In Berlin hatte sich der Sündenfall deutscher Verfassungsgeschichte
am 28. Oktober 1918 ereignet: An diesem Tage trat ein Reichsgesetz in
Kraft, mit dem Reichskanzler und -regierung nicht mehr dem Souverän verantwortlich
waren. Sie wurden aus ihrer Bezogenheit auf das Ganze, damals noch personifiziert
im Kaiser, herausgelöst und der jeweiligen Mehrheit der im Reichstag versammelten
Parteienvertreter unterworfen. Ohne deren Einverständnis konnte der
spätere Reichspräsident keinen Kanzler ernennen. Damit hat die Machtergreifung
der Gesellschaft über den Staat begonnen, die im 3. Reich und in der DDR als
Parteiherrschaften traurige Höhepunkte erreichte und bis heute nicht wieder
abgeschüttelt werden konnte. Seit 1918 saugen die partikularen Kräfte alles
Gemeinschaftliche, Staatsbezogene in sich hinein, so daß Begriffe wie
Staatsräson und Gemeinwohl zu von Jüngeren nicht mehr verstandenen
Worthülsen wurden und jedes politische Handeln in den Augen der meisten Bürger
nur noch mit innergesellschaftlichem Catch-as-catch-can assoziiert wurde,
einem schmutzigen Geschäft, von dem man sich verdrossen, ja angeekelt abwendet.
Gegen denselben Versuch der Gesellschaft, den Staat zu
erobern, setzt sich gegenwärtig der letzte regierende Reichsfürst des Heiligen
Römischen Reichs Deutscher Nation und des Deutschen Bundes, Hans Adam II.
von Liechtenstein,
mit erstaunlich treffenden Argumenten
zur Wehr: "Fürst Hans Adam II. von Liechtenstein hat mit Wegzug aus dem
Land gedroht, wenn seine verfassungsmäßigen Rechte eingeschränkt werden
sollten. Sie sichern ihm in der Innen- und Außenpolitik großen Einfluß.
Zu der Eröffnung des neuen Landtags sagte der Regent am Wochenende, er
sehe es als seine Aufgabe an, darüber zu wachen, 'daß die demokratischen
und rechtsstaatlichen Institutionen nicht durch die Oligarchie (Herrschaft
einiger weniger) geschwächt werden'. Vor allem dürften Parteiinteressen
nicht über jene des Staates gestellt werden."
Mit dem Gesetz vom 28.10.1918 haben die Parteienvertreter
im Reichstag dem Kaiser nicht mehr schaden können, weil dieser am 9. November
abdankte. Mit der faktischen Installierung einer Parlamentsregierung
schlugen die im Reichstag versammelten Parteienvertreter vielmehr dem
Volk als neuem Souverän ein Schnippchen, ohne daß dieses es bemerkte: Sie
machten sich die Regierung botmäßig und begründeten, nicht dem Verfassungsbuchstaben,
aber der Sache nach, eine Art eigener Souveränität, nämlich die der Gesellschaft
über den Staat. Der Schlag vom 28.10.1918 war formal noch gegen den Kaiser
als alten Souverän geführt worden und durfte seine Legitimität auf die Souveränität
des Volkes stützen. Dieses aber handelte ihm Rahmen des neu installierten Parlamentarismus
nicht selbst, sondern durch das Parlament. Während die Parteienvertreter
das Volk nur nominell als souveränen Herrscher einsetzten, wußten sie sich im
tatsächlichen Besitz der maßgeblichen Gewalten, der entscheidenden Hebel
der Macht: der Gesetzgebung und dem Zugriff auf das Amt des Reichskanzlers.
Dieser wurde zwar formell vom Reichspräsidenten ernannt, bedurfte aber des
Vertrauens des Reichstags.
Diese Machtergreifung wirkte über die Augenblickslage weit
hinaus und trug nicht nur zur schließlichen Abdankung des faktisch schon
entmachteten Kaisers bei; die Weimarer Parteien gaben die Macht auch danach
nicht wieder her. Daß das Volk nach der Weimarer Verfassung mit dem
Reichspräsidenten noch einen direkt gewählten Vertreter und damit einen
Verfechter des Gemeinwohls hatte, half ihm nicht. Paul von Hindenburg
nahm als Reichspräsident
die ihm obliegende Neutralität über die Parteien ausgesprochen ernst.
Die wirkliche Macht lag aber nicht in seinen Händen. "Die parlamentarische
Verantwortlichkeit der Reichsregierung, die jederzeit durch ein Mißtrauensvotum
von der Mehrheit des Reichstags abberufen werden konnte (Art.54 WRVerf),
machte praktisch die gesamte Regierungstätigkeit zum Gegenstand
parlamentarischer Kognition."
Diesen Zustand hat das Grundgesetz noch verschärft,
indem es dem Bundespräsidenten gegenüber dem Parlament die Rechte vorenthält,
die der Weimarer Reichspräsident noch gehabt hatte.
Zu konstitutionell-monarchischen Zeiten rechtfertigte sich
die Idee der parlamentarischen Regierungsform als systemüberwindendes
Kampfinstrument gegen die Idee der monarchischen Souveränität:
Dem Monarchen sollte die Verantwortlichkeit für die Regierungsgewalt
entwunden werden, weil er keine demokratische Legitimation besaß. Nach 1918
wurde die Idee der parlamentarischen Regierungsform mit den Worten Roman
Herzogs
"in die demokratische
Epoche herübergeschleppt", die Exekutive "demokratisiert",
ihr jede Tätigkeit ohne Grundlage eines parlamentarisch beschlossenen
Gesetzes untersagt und darüber hinaus noch die parlamentarische Abhängigkeit
der Regierung "in exzessiver Form eingeführt." Hier gilt es den Hebel anzusetzen. Die
fossilen Überbleibsel aus der Epoche des Parlamentskampfes gegen die Krone
müssen beseitigt und eine demokratisch gewählte Vertretung des Gemeinwohls
eingesetzt werden: Der Bundespräsident als Vertreter des ganzen Volkes. In
seiner Hand liegt allein die Verantwortung für Kanzler und Regierung.
Nichts, aber auch gar nichts würde
gegen diese Forderung die polemischen Behauptung rechtfertigen, dieser werde
ein starker Mann sein oder wie die
alten Sprüche aus der radikalliberalen Mottenkiste noch lauten. Die
Prinzipien und Wesensmerkmale der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
wären miteinander teilweise unvereinbar, wenn man den Ehrgeiz hätte,
jedes dieser Gestaltungsprinzipien uneingeschränkt verwirklichen zu
wollen. Dann würde es andere verdrängen. Jede Verfassungsordnung muß sich
um ein Austarieren und aufeinander Einwirken teils gegenläufiger Wünsche
bemühen. Die stärkere Betonung des einen Merkmals bewirkt unter Umständen
eine zwangsläufige Gewichtsverringerung eines anderen. So hat die Einsetzung
des Kanzlers durch den Präsidenten ein stark gewaltenteilendes Gewicht; ja
eigentlich entspricht nur ein solches Präsidialsystem einigermaßen dem
Bild einer gewaltenteilenden Demokratie, in dem das Parlament die vom
Präsidenten berufene Regierung weder von Rechts wegen zu bestätigen noch zu
stürzen befugt ist.
Wenn der Kanzler von der parlamentarischen Kontrolle befreit
und nur noch dem Gemeinwohl verpflichtet, also vom Vertrauen des Bundespräsidenten
abhängig ist, erfordert dies eine andere Art von Kontrolle der regierenden
Gewalt. Formal liegt eine demokratische Verantwortlichkeit der Regierung
schon in der Abhängigkeit des Kanzlers vom volksgewählten Bundespräsidenten.
Inhaltlich stößt die Regierung an ihre Grenzen und wird auf Kompromisse
und ein grundsätzliches Vertrauen des Bundestags faktisch angewiesen
sein, weil dieser das Haushaltsrecht besitzt. Ohne Geld läßt sich nicht regieren.
Darüber hinaus sind für Fälle extremen Machtmißbrauchs des Bundespräsidenten
oder seines Kanzlers eine permanente Eingriffsmöglichkeit des Volks und
eine besondere rechtliche Unterworfenheit unter verfassungsgerichtliche
Kontrolle zu erwägen. Das Parlament muß als Verfassungsorgan wenigstens das
Recht haben, wegen eines angeblichen Verfassungsverstoßes der Exekutive
das Verfassungsgericht anzurufen. Die politische Kontrolle durch das Volk
ist nach dem hier vorgeschlagenen Maßnahmenbündel schon durch die Möglichkeit
des Volksentscheids über konkrete Regierungsmaßnahmen gegeben. Eine
geordnete Regierungstätigkeit setzt allerdings voraus, daß ein hoher Prozentsatz
der Wähler einen solchen Entscheid begehrt. Dieses Quorum muß hoch genug
liegen, so daß es nur in wichtigsten Richtungsfragen und großer
Mobilisierung der Wähler zu einem Volksentscheid kommen kann.
Das gilt entsprechend für ein Recht des Volks, den
Bundespräsidenten während seiner Amtszeit durch Wahl eines anderen zu stürzen.
Weil der Präsident notfalls auch erforderliche, aber unpopuläre Maßnahmen
treffen können muß, kann dieses Volksrecht nur auf Ausnahmesituationen beschränkt
sein, wenn kein permanenter Wahlkampf herrschen soll. Denkbar wäre auch ein
nur gemeinsam von Bundestag und Volk jeweils mit den Stimmen der Mehrheit
auszuübenden Initiativrecht.
Oben waren wir auf die
Ausbildung des neuzeitlichen Phänomens "Staat" gegenüber der mittelalterlichen
Lehnsgesellschaft eingegangen. Wir haben das Auf und Ab der Macht des Staats
von ihrer vollen Entfaltung im Fürstenabsolutismus bis in unser Jahrhundert
der totalitären Ideologien verfolgt, in dem der Staat häufig nur noch geduldet
und mißbraucht wurde als von einer Einheitspartei vereinnahmter Knecht,
wenn seine Amtswalter, die Polizei und Justiz auf Parteibefehl Unrecht tun
mußten. Schließlich haben wir auch in der Ideenwelt des Liberalismus ein
ideologisches Grundprinzip gefunden, dessen extreme, ultraliberale
Anwendung auf eine weitestmögliche Reduzierung staatlicher Funktionen hinausläuft,
wenn nicht gar zu einem in letzter Konsequenz erwünschten "Absterben"
des Staates, den der Liberale allenfalls als leider unentbehrlich duldet.
Daß diese Zukunftsperspektive nicht übertrieben ist, beweist
das Verhalten der liberalen deutschen Parteipolitiker tagtäglich. In
Deutschland gibt es bedeutende Bereiche, die traditionell "staatlich"
geführt oder zumindest kontrolliert sind. Diese Bereiche werden allgemein
mit dem umfassenden Begriff der Daseinsvorsorge und -fürsorge umschrieben.
Für das Gemeinwohl für unentbehrlich gehaltene Tätigkeiten sind so seit dem
18. Jahrhundert staatliche Domänen geworden: Von den merkantilistischen
Wirtschaftsbetrieben Friedrichs des Großen führt eine direkte Verbindung
zum staatlichen Bau des Volkswagenwerks und den Aktienanteilen des
Bundes an der Lufthansa. Staatlich wurden in Deutschland seit dem 19.
Jahrhundert die Post geführt, die Eisenbahn, die Wasserversorgung und
andere Unternehmungen, mit denen der Staat eine erforderliche Grundversorgung
der ganzen Bevölkerung sicherstellen wollte. Bekanntlich werden zur Zeit
alle diese bisher staatlichen Wirtschaftsbetriebe privatisiert. Die
Entstaatlichung zeichnet sich aber auch in den Bereichen am Horizont ab, wo
der Staat uns Bürgern bisher mit hoheitlicher Machtbefugnis gegenübergetreten
ist. Wo wenig Polizei von Politikern als liberaler empfunden wird als mehr
Polizei, spart man im Staatshaushalt und läßt den Bürger mit den Problemen
der wachsenden Kriminalität allein. In ganzen Stadtvierteln ist der
Staat mit seiner Polizei nicht mehr präsent und überläßt die ratlosen Bürger
ihrem Schicksal, der Selbstbewaffnung oder teueren privaten "Sicherheitsdiensten".
In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf das klassische
Land des Liberalismus, die USA, und auf dort als Zukunftsperspektiven
gedrehte utopische Spielfilme. Diese geben uns einen realitätsnah
dargestellten Ausblick auf eine auch bei uns mögliche Zukunft. Die
Drehbücher signifikant vieler aktueller Hollywood-Produktionen verwenden
als gesellschaftlichen Hintergrund utopischer Spielhandlungen die Vision
einer Welt ohne Staat: die totale Gesellschaft.
So werden die Geschicke der zukünftigen
Menschheit in Science-Fiction-Filmen wie "Aliens - Die Rückkehr" (1986) oder "Total Recall" (1989) ausschließlich durch private Firmen
gelenkt: Großkonzerne haben die alleinige Macht übernommen. Neben ihren Ordnungstruppen
gibt es keine staatliche Polizei mehr. Wer in der Zukunftswelt auf dem Mars
in "Total Recall" atmen
will, muß die Luft von einem allmächtigen Industriebetrieb und seinem
Inhaber kaufen, der dort von der Druckkuppel bis zur letzten Schraube alles
gebaut hat und beherrscht. Tatsächlich liegt ein solcher Endzustand in der
inneren Logik des Liberalismus. Er markiert den Endpunkt einer historischen
Entwicklung vom totalen Staat des Fürstenabsolutismus zur totalen Gesellschaft
eines Absolutismus des Partikularen. Rohrmoser hat hierzu darauf
aufmerksam gemacht, insbesondere Hegel habe begriffen, "daß die moderne
Gesellschaft zu einer Art neuem Absoluten" werde, wenn "sie sich
an die Stelle von Geschichte, von Volk, von Nation" setze
:
Mit dem wenigen, was bei weiterem ungehemmtem Wirken des Liberalismus übrigbleiben
wird, werden wir keinen Staat mehr machen können.
Hier gilt es Gegenkräfte zu mobilisieren, die Tendenz umzukehren
und den Staat vor seiner gänzlichen Beseitigung zu bewahren, weil wir ihn noch
benötigen, und ihn insbesondere vor einem Aufgehen im nur Gesellschaftlichen
zu schützen. Eine vollständige und in allen Lebensbereichen sauber
durchzuhaltende Trennung von Staat und Gesellschaft ist zwar nach allgemeiner
Ansicht nicht möglich. Diese Einsicht ist aber kein Grund, die mit Staat und Gesellschaft bezeichneten Aspekte menschlichen Zusammenlebens
nicht voneinander zu trennen, wo dies möglich ist. Dazu bedarf es zuallererst
eines Verfassungsorgans, dem die Verkörperung des Staats gegenüber der Gesellschaft
obliegt. Dieses Organ ist der Bundespräsident. Während er heute nur
symbolische Funktionen erfüllt, sind ihm die Entscheidung über den Kanzler
und damit die Regierungsgewalt und damit deren Kontrolle alleinverantwortlich
zu übertragen.
Da das Ganze in der Bonner Verfassung nicht hinreichend
vertreten ist, liegt das Strukturdefizit des Grundgesetzes vor allem in einem
Repräsentationsmangel. Der in ein gesellschaftliches Kräfteparallelogramm
eingebundene Bürger bedarf der Repräsentation seiner Interessen gegenüber
anderen gesellschaftlichen Mächten in einem pluralen Vertretungsorgan,
dem Bundestag. Aber auch sein Fundamentalinteresse an der Integrität
desjenigen Ganzen, das seine individuelle Freiheit schützt, müßte vertreten
werden. Das eigentliche Problem besteht im Konflikt zwischen verschiedenartigen
Einzelbelangen und ihrem möglichen Gegensatz zum umfassenden öffentlichen
Interesse. Weil man mit dem Repräsentationsmodell im
Grundgesetz 1949 ein Höchstmaß an "demokratischer"
Legitimation bewirken wollte, muß der Parlamentsabsolutismus als korrigierbarer
Konstruktionsfehler der Verfassung angesehen werden, weil das Repräsentationsprinzip
nur unvollständig durchgeführt wurde. Darin liegt ein Systembruch, ein
Widerspruch des gedanklichen Modells der Interessenvertretung in
sich. Dieser Widerspruch beruht auf einer extremistischen Übertreibung
der oben dargestellten liberalen Grundannahmen. Die entscheidende falsche
Grundprämisse des modernen Liberalismus war danach die, das Gemeinwohl
als bloße Resultante des innergesellschaftlichen Interessendrucks
anzusehen. Die Balance zwischen den wechselseitigen Interessen führt
eben tatsächlich nicht zu einer Art höherer Harmonie. Dieses Modell läßt sich
mit dem Prinzip der Interessenrepräsentation aus dem Grund nicht in vollständigen
Einklang bringen, weil es die innergesellschaftlichen Umverteilungsinteressen
fälschlich für die einzigen zu repräsentierenden Interessen hält. Jeder
einzelne hat aber zwei Seelen in seiner Brust:
Er hat ein Interesse an einem möglichst großen
Anteil an den volkswirtschaftlich verfügbaren Gütern, der im Geldzeitalter
seinem innergesellschaftlichen Rang entspricht; zugleich aber auch ein
Interesse, das sich spezifisch auf den unbeschädigten Fortbestand des
Ganzen gegen alle Teilkräfte als solche und gegenüber anderen Ganzheiten
richtet, also gegenüber anderen Staaten. Es geht also um Interessen von
grundsätzlich zweierlei Natur. Es gilt die "durch den Staat
organisierte homogene Volksgesamtheit" durch andere Repräsentanten zu
vertreten als die Gesellschaft in ihrer wirtschaftlichen, regionalen, weltanschaulichen
und politischen Zersplitterung.
Dieses Fundamentalinteresse jedes einzelnen kann aber in
einem interessenpluralistisch organisierten Gremium nicht repräsentiert
werden, sondern nur in einer Person. Diese repräsentiert das Ganze gegenüber
seinen Teilen. Die Interessen des Ganzen und die seiner Teile können nicht
in demselben Organ vertreten sein. Dieses müßte sonst gleichzeitig
gegensätzliche Interessen vertreten, was es der Natur der Sache nach nicht
kann. Das zeigt sich heute z.B. an der Person des Bundeskanzlers, der, obwohl
Parteivorsitzender, das Wohl des ganzen Volkes zugleich mehren soll, also
auch das der Interessengegner seiner Partei. Im 18. Jahrhundert, der Epoche
des absoluten Staates, repräsentierte der König das Volk und verkörperte dessen
Einheit. In unserem Jahrhundert der absoluten Gesellschaft wählt es sich ein
Parlament voller kleiner Könige, die es in seiner pluralen Form als Gesellschaft
repräsentieren sollen. Es wird Zeit, wieder beide Aspekte zwischenmenschlichen
Daseins zugleich zu repräsentieren.
Nach deutscher Verfassungstradition ist der berufene Vertreter
der Fundamentalinteressen aller Bürger der vom Volke direkt gewählte Bundespräsident.
Dieser ernennt einen nur von ihm abhängigen Kanzler, wie in Frankreich
und der Weimarer Republik, oder er regiert selbst, wie in den USA. Sein
Kanzler ist aber nicht vom Parlament abhängig wie im Parlamentarismus. Ihm
wird gerade gegenüber dem Parlament, das auch künftig die Gesellschaft mit
ihren Binneninteressen vertritt, die notwendige Repräsentation des zu den
innergesellschaftlichen Interessen meistens quer liegenden
Allgemeininteresses obliegen, und als
dessen Vertreter wird er mit staatlicher Regierungsmacht in einem gewaltenteilenden
Verfassungssystem dem gesetzgebenden Parlament ebenbürtig gegenüberstehen.
Das wird dann im Ergebnis kein Parlamentarismus im
engeren Sinne mehr sein, sondern ein Präsidialsystem, das im Prinzip so funktionieren
wird, wie es auch bei unseren amerikanischen und französischen und russischen
Nachbarn funktioniert. Nebenbei bemerkt wäre ein Präsidialsystem, wie hier
vorgeschlagen, mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne
des BVerfG ohne weiteres vereinbar. Art.79 III und 20 GG verlangen nicht das
rein parlamentarische Regierungssystem, sondern lassen ein präsidiales
durchaus zu.
Wünschenswert ist dabei eine möglichst
weitgehende Trennung von Staat und Gesellschaft in Form einer völligen
Unabhängigkeit des Präsidenten und der Regierung vom gesetzgebenden Parlament.
Als Pragmatiker würden wir eine Verfassung wie die Weimarer und die jetzige
russische
mit einer Regierung, die vom Vertrauen von
Parlament und Präsident abhängt,
natürlich als Teilverwirklichung unserer Prinzipien immer noch lieber sehen
als unser heutiges System reiner Parlamentsherrschaft.
Die Ironie der Geschichte des historischen Liberalismus
bringt es mit sich, daß gerade das hier geforderte Regierungssystem einmal
liberalen Forderungen exemplarisch entsprochen gehabt hatte: Bevor es
Liberale 1918 und 1948 bevorzugten, nach der ganzen Macht zu greifen und einen liberalen Parlamentsabsolutismus
zu errichten, sahen sie "das Wesen des echten Parlamentarismus gerade darin, daß die Exekutive nicht das untergeordnete Instrument des
Parlamentswillens ist, sondern ein Gleichgewicht zwischen beiden Gewalten besteht."
Machtgleichgewichte verhindern ihrer Natur
nach die eindeutige Entscheidung zwischen zwei antagonistischen Prinzipien. Das
hier eingeforderte Gleichgewicht zwischen den repräsentierten Interessen
des Ganzen und denen seiner Teile ist aber notwendig, wenn ein Absolutismus der
einen oder anderen Seite vermieden werden soll. Entgegen Carl Schmitt
ist es also kein
"Mangel" dieser "rechtsstaatlichen Idee", daß sie
"die letzte, unabwendbare, politische Entscheidung und Konsequenz der
politischen Formprinzipien umgehen will."
Wenn man schon von der Vertretbarkeit von Interessen
ausgeht, dann muß man auch konsequent sein und mit dem Repräsentationsgedanken
ernst machen. Es genügt dann eben nicht, die Interessen derjenigen in
einem Parlament zu bündeln, die sich aufgrund ihres Lebensalters und ihrer
Kraft überhaupt organisieren können. Nur bestimmte Eliten können die gegebenen
Beteiligungsmöglichkeiten ausschöpfen und dabei ihre Interessen artikulieren.
Aus verbandssoziologischen Gründen
lassen sich vor allem ganz allgemeine Interessen und die Interessen von
Randgruppen ohne Macht zur Konfliktsaustragung nicht organisieren; und was nicht organisiert ist, bleibt nach
dem rein liberalen Modell weitgehend ungeschützt. Sind Partikularinteressen
regelmäßig stärker organisiert, stellt von Arnim
weiter mit Olsonscher Logik
fest, bleibt der Appell zum Allgemeininteresse auf der Strecke.
Daß es ein Gemeinwohl überhaupt gibt, kann schlechterdings
nicht ohne Widerspruch zu seinen eigenen Prämissen bestreiten, wer Interessen
überhaupt für vertretbar hält. Merkwürdigerweise pflegen aber dieselben
Autoren die Existenz des Gemeinwohls aller Bürger eines Staates oder aller
Angehörigen eines Volkes als ideologisches Kunstprodukt oder Gedankenfiktion
zu bezeichnen, die überhaupt keine Probleme mit der Annahme eines gemeinsamen
Wohls aller ÖTV-Mitglieder oder aller Proletarier oder aller Frauen haben. Daß
es ein auf ein politisches Gemeinwesen zu beziehendes gemeinsamen Wohl grundsätzlich
geben kann, wie auch immer es konkret zu bestimmen sein mag, ist nur zu bestreiten,
wenn man generell die Möglichkeit des gleichen Interesses zweier Menschen
abstreitet. Dieses gemeinsame Wohl kann vertreten werden, wenn überhaupt
irgendein gemeinsames Interesse zweier Menschen vertreten werden kann. Wer
es vertreten will, muß dabei einen Standpunkt einnehmen, der sich gegenüber
den auch vorhandenen Privat- und Einzelinteressen möglichst neutral verhält.
Daß sich die Staatsgewalt als pauvoir
neutre über die gesellschaftlichen Kräfte
erheben kann, ist also keineswegs Ideologie,
sondern folgt zwingend aus der Idee der Vertretbarkeit
von Interessen.
Mit Recht hat Böckenförde darauf hingewiesen, daß der politische
Ort zur Austragung von Fundamentalkonflikten fehlt, wenn konstituierte
Interessengruppen die einzigen Faktoren der politischen Willensbildung
sind. Diese Konflikte würden verdrängt, und sie wären nur bei einer
Mobilisierung der Gesamtheit aller Bürger artikulationsfähig. Diese
Mobilisierung bedürfe staatlicher Leitungsorgane.
Ein solches Organ wäre der Bundespräsident
mit den hier vorgeschlagenen Kompetenzen. Das strukturelle Defizit des
ultraliberalen Bonner Modells liegt darin, daß er diese Befugnis nicht
hat. Das ist ein Repräsentationsmangel, der die jeweilige Majorität der
Gruppeninteressen durch den Bundestag uneingeschränkt herrschen läßt
und dem Gemeinwohl keine wirksame Vertretung zugesteht. Diese Vertretung
ist eine Bedingung, ohne die Staat und Gesellschaft nicht voneinander geschieden
werden können. Es gibt demzufolge nur eine realistische Strategie für ein
Roll Back des Parteienstaates: Sie bedient sich des beidseits scharfen
Schwertes des Plebiszits: Dieses bekämpft destruktiv die verkrusteten
Strukturen des selbstreferentiellen Parteienfeudalismus, und sie gibt
dem Neuen konstruktiv durch Wahl des Bundespräsidenten die nötige demokratische
Legitimation.
Anders als heute wird und muß das Volk doppelt repräsentiert
sein: In seiner Erscheinungsform als bürgerliche Gesellschaft mit pluralen
Interessen in einem Parlament abgeordneten Vertreter dieser Einzelinteressen;
als ganzes Volk hingegen in einer vom Volke direkt gewählten Einzelpersönlichkeit,
die den Staat verkörpert und durch ihren Kanzler die Belange des Ganzen
vertritt. Das folgt aus dem genuin aufklärerischen Ansatz erforderlicher Interessenvertretung
und führt diesen konsequenter durch als das extrem liberale Modell einseitiger
Entfaltungsmöglichkeiten vor allem für den ökonomisch Stärkeren und das
linke Modell klassenmäßiger Interessenvertretung. Jeder hat also ein
unmittelbar selbstbezogenes Eigeninteresse und ein manchmal damit konkurrierendes Eigeninteresse am Bestand
der Gruppe hat, zu der er gehört und die ihn schützt. Wer nicht erkennt, daß
es Völker gibt, die Staaten zur Wohlfahrt ihrer Angehörigen bilden, mag
freilich dem Irrtum verfallen, Staaten seien nur zum Privatvergnügen boshafter
Potentaten erfunden. Er mag dann etwa gegen die hier vertretene Position
formulieren: "Auch wenn sie von Demokratie reden, meinen sie doch nichts
anderes als den für sie wünschenswerten starken Staat (Diktator), unter
dessen Interessen sich die Menschen unterzuordnen haben."
Welch bemerkenswertes Begriffsmikado und
Sammelsurium von Halbverstandenem steckt doch in einem solchen, immerhin in
Auflage von 5000 Stück verbreiteten Satz!
Aus der inhaltlichen Aufgabe des Bundespräsidenten zur Vertretung
des Ganzen gegen seine Teile folgt zwingend die formale Forderung, daß er
keinem dieser Teile angehören darf. Da niemand zugleich zwei Herren dienen
kann, darf der Präsident nicht Mitglied irgendeiner Partei oder Interessengruppe
sein. Nun läßt sich die innerliche Gemeinwohlorientierung eines Menschen
nicht verordnen, und das Volk muß in der Auswahl der Person frei sein, die
es insgesamt repräsentieren soll. Ein ganz ungebundener Kandidat wird
die Ausnahme sein und ohne Parteienunterstützung keinen Wahlkampf gewinnen
können. Andererseits kann gerade die Kandidatur eines parteiunabhängigen
Bewerbers alle Parteien hoffen lassen, dieser werde allseits neutral auftreten,
und gerade das könnte eine allgemeine Unterstützung über Parteigrenzen
hinweg nach sich ziehen. Spätestens mit der Annahme der Wahl und seinem
Amtseid auf das Wohl des ganzen Volkes muß der Bundespräsident aber ältere
Bindungen lösen und ein eventuell vorhandenes Parteibuch zurückgeben.
Heute wird die Bundesregierung von einem Kanzler geführt,
der zugleich Parteivorsitzender ist. Eine absolute Mehrheit an Bürgern hat
andere Parteien oder gar nicht gewählt. Für sie repräsentiert er den innenpolitischen
Gegner. Jeder Gewerkschaft gesteht man aber Gegnerfreiheit zu. Sie braucht
niemanden aufzunehmen, geschweige denn in Führungspositionen zu lassen,
der eine von ihr willkürlich als gegnerisch angesehene andere Bindung hat,
z.B. ein Parteibuch einer von den Gewerkschaftsfunktionären nicht gern gesehenen
Partei. Kirchen müssen keine Angestellten beschäftigen, die gegen Kirchenrecht
verstoßen haben. So kann eine Küchenhilfe eines kirchlichen Altersheims
entlassen werden, nur weil sie nicht kirchlich geheiratet hat. Nur der
Staat, das Ganze, soll es heute hinnehmen müssen, daß seine Schaltstellen mit
Personen besetzt werden, die nach Parteiproporz ausgewählt oder nach parteitaktischem
Machtkalkül protegiert worden sind und die sich ihrer Partei verpflichtet
fühlen, nicht dem Ganzen.
Aber wie ist der Gefahr zu begegnen, der Bundespräsident als
einzelner könne, was noch schlimmer wäre als die Herrschaft einer Teilgruppe,
im wesentlichen eigennützig für sich selbst regieren? Ist er als Person nicht
auch Teil der Gesellschaft? Wenn die Herrschaft einer Gesellschaftsgruppe
über den Staat, das Ganze, von Übel ist - muß nicht die Herrschaft eines einzelnen,
also eines Teils einer Teilgruppe, das Übel noch verstärken?
In der parlamentarischen Demokratie behauptet die jeweilige
Parlamentsmajorität ja auch, für das Ganze zu herrschen. Daß sie ihrer Natur
nach nicht das Ganze, sondern nur sich selbst vertreten kann, ist eine
wesentliche kritische Einsicht gegen das System der Parlamentsregierung.
Wenn ein einzelner Präsident das Ganze inhaltlich soll repräsentieren
können, wenn wir ihm zutrauen, für die Belange Aller einzutreten, warum
soll ein vom Parlament gewählter Bundeskanzler das nicht auch können? Warum
können es die Parlamentarier praktisch nicht, obwohl sie es nach Art.38 GG
doch sollen?
Der wesentliche Unterschied liegt in der nötigen
persönlichen Unabhängigkeit des Bundespräsidenten und dem ihm
abzufordernden Amtsverständnis. Ein Bundeskanzler von Parlaments Gnaden ist
stets dem Gutdünken der jeweiligen Mehrheit ausgesetzt und muß für diese
Entscheidungen treffen. Im täglichen Ringen um Kompromisse zwischen den
Interessen innergesellschaftlicher Machtgruppen kann er nicht zugleich für
die Unorganisierbaren, Ungeborenen und Schwachen und schon gar nicht für das
Ganze gegen den Interessendruck seiner Teile eintreten. Das gilt erst
recht, wenn er zugleich Vorsitzender der Majoritätspartei ist. Ohne Ungebundenheit
von solchen Abhängigkeiten kann ein Präsident daher nicht für das Ganze
regieren oder regieren lassen. Keine formelle Parteigebundenheit darf
Zweifel an der Neutralität und inneren Unbestechlichkeit des Amtsinhabers
wecken. Die Freiheit von Partikularbindungen und Basisimperativen ist
Grundvoraussetzung demokratischer Repräsentation.
Wichtigstes Erfordernis für ein Präsidentenamt im
Präsidialsystem ist aber ein auf das Ganze gerichtetes Amtsverständnis. Ein
Präsident mit dem Wahlspruch Ludwig XIV. "Der Staat bin ich!" würde
alle Übel kumulieren: Er würde den Staat für eine selbstbezogene Herrschaft
mißbrauchen und mit seiner Einpersonenherrschaft den kleinsten Baustein der
Gesellschaft zum Eroberer des Staatsapparates machen. Damit wäre die Herrschaft
aus Sicht des Staats absolut, aber doch wieder ausgeübt durch und bezogen
auf einen gesellschaftlichen Kleinstteil. Gegen diese absolutistische
Versuchung hilft nur ein Amtsverständnis, wie es Friedrich der Großen mit
seinem Motto ausgedrückt hat: "Ich bin der erste Diener meines Staates."
Auch Ernst-Wolfgang Böckenförde
fordert eine derartige, auf die Erfordernisse
der Allgemeinheit gerichtete, aus einem Amtsethos kommende und von
Partikularbindungen und Basisimperativen freie Vertretung und nennt sie
"inhaltliche Repräsentation". Das Vorhandensein einer solchen, auf
die Belange des Volkes insgesamt gerichteten Repräsentation ist Voraussetzung
dafür, daß die parlamentarische Demokratie nicht zu einer delegierten
Individual- und Gruppenherrschaft, einem wechselnden Mehrheitsabsolutismus oder der autokratischen Selbstherrschaft
eines einzelnen absinkt. Der Mehrheitsabsolutismus ist aber der Istzustand
der totalen Gesellschaft, deren radikaler Liberalismus den Gegensatz zwischen
dem Ganzen und seinen Teilen konsequent zulasten des Ganzen aufgelöst hat.
Immer folgt aus dem Liberalismus in letzter Konsequenz Mehrheitsabsolutismus,
niemals Freiheit.
Seine Abgeordneten sind in reale,
soziologisch, ökonomisch und innerparteilich greifbare Zwänge und Gesetzlichkeiten
eingebunden und können in ihrer Masse selbst dann nicht für das Wohl aller
eintreten, wenn sie das gerne wollten. Nichts zwingt sie zu einem auf das
Ganze bezogenen Amtsethos, wohingegen sie von Gruppeninteressen und
ihrem Eigeninteresse an Wiederaufstellung persönlich abhängig sind.
Allein der Amtsbegriff eignet sich als Ausgangspunkt
für eine prinzipiell fremdnützige
Vertretung der Interessen des Ganzen durch sein Oberhaupt. Diesem muß, praktisch
auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere, durch geeignete Maßnahmen persönliche
und sachliche Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit ermöglicht werden. Zum
Beispiel sollte er bei Gesprächen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden einer
multinationalen Aktiengesellschaft nicht weniger verdienen als einer der
untergeordneten Manager dieser AG. Die Freistellung von Partikularbindungen
darf aber nicht in die Beliebigkeit des nackten Willens des Amtsträgers
führen. Zum Begriff des Amtes gehört vielmehr die Fremdnützigkeit, also
die Ausrichtung auf Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die von den eigenen
Interessen unterschieden sind.
Mit der Forderung nach dieser inneren Ausrichtung
stoßen wir an die Grenzen dessen, was von Rechts und Verfassungs wegen
herbeigeführt werden kann. Wir gelangen in den primär menschlichen Bereich
mit seinen Schwächen, aber auch der Möglichkeit menschlicher Größe. Wir
können hier, wie bei jeder Wahl und Vertretung der Gewählten, nur mit der
Mehrheit der Wähler hoffen, daß sich im Einzelfall das alte Behördensprichwort
einlösen möge: Wem der Herr ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand; und
wir ergänzen: auch das nötige Amtsethos als Primärtugend.
Tatsächlich ist die Geschichte reich an Beispielen, daß
derselbe Mensch, der unter den einen Gesetzen der einen Sache und ihren Zwängen
unterworfen war, unter anderen Gesetzen und damit befreit für eine andere
Sache mit ganzer Kraft eintrat. So machte Heinrich II. von England seinen
Gefolgsmann Thomas Becket
(1118-1170) in der Hoffnung
zum Erzbischof von Canterbury, dieser werde dort des Königs Macht vertreten
und so die Kirche lähmen. Kaum hatte dieser den Bischofsstuhl erklommen,
wandelte er sich vom hörigen Saulus des Königs zum Paulus und unerbittlichen
Verfechter kirchlicher Rechte und päpstlicher Politik. Wir entsinnen uns auch
des Wortes von Hans Herbert von Arnim von den vielen Politikern, die heute nur
die Wahl haben, im Rahmen des Systems nach dessen interessenegoistischer Partikularlogik
zu handeln oder zum tragischen Helden zu werden. Es gibt noch viele mutige
Menschen in unserem Lande, die es bis heute vorziehen, lieber tragische Helden
zu sein als sich dem System des puren Eigennutzes zu unterwerfen; Menschen,
die es hübscher finden, für eine gute Sache unterzugehen als mit einer
schlechten zu gedeihen. Ihre Stunde wird kommen.
Alle Überlegungen zur notwendigen
Freiheit des Staatsoberhauptes von parteilichen Bindungen gelten auch für
alle ihm nachgeordneten oder föderal nebengeordneten Behörden. Niemand
kann gleichzeitig zwei Herren dienen: dem Staat und einer Partei.
Art.130 der Weimarer Reichsverfassung hatte
das noch erkannt: "Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer
Partei." Überall in Bund, Ländern und Gemeinden, wo heute Parteien
kraft ihres Machtanspruchs ihre Leute in Schaltstellen der Macht gesetzt haben,
prallen tagtäglich Staatsräson und Parteiräson aufeinander. Die formale, durch
Beamtengesetze abgestützte Pflicht, das Gemeinwohl zu vertreten, erweist
sich im Alltag als unerfüllbar, wenn die wirklichen Entscheidungsstränge
im Innenleben der Parteien zu suchen sind. Nach Art.33 II GG gilt das Leistungsprinzip:
Jeder hat nach seiner Eignung gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern. Ein wucherndes
Parteienunwesen benötigt Ämter aber zur Versorgung seiner Pfründner
und zur Ausdehnung seiner Machtbasis. So werden die Funktionäre der Verwaltung
durch die jeweilige Mehrheitspartei bestimmt. "Das staatliche und
kommunale Beamtentum verwandelt sich auf diese Weise in eine Parteigefolgschaft,
wobei die leitenden Beamten zu Parteifunktionären und Wahlagenten werden."
Darum gilt in weiten Teilen der öffentlichen Verwaltung seit
Jahren, daß man ohne das jeweils richtige Parteibuch nichts wird. Dieser Zustand
verkehrt den Sinn des Grundgesetzartikels 33 in sein Gegenteil und
schwächt entscheidend die Sachkompetenz und Schlagkraft der Staatsverwaltung.
Er hat ihr Ansehen in der Öffentlichkeit und das Zutrauen der Bürger in
die Unparteilichkeit der Behörden schwer und nachhaltig erschüttert. Es
gibt keinen justiziablen Weg, dem Leistungsprinzip Geltung zu verschaffen,
solange Parteigänger als Beamte über die Beamtenkarriere anderer Parteigänger
entscheiden. Diese können mit einfachsten Tricks bevorzugt werden: So
braucht eine Schulbehörde nur eine hinreichenden Anzahl von Bewerbern um
eine Direktorenstelle durchweg mit demselben Prädikat und der formal
bestmöglichen Beurteilung zu versehen, um sie so formal "gleich" zu
machen; dann hat sie die verwaltungsgerichtlich unangreifbare Möglichkeit,
willkürlich "zufällig" den von ihr gewünschten Bewerber mit dem
richtigen Parteibuch zu befördern. Hier hilft nur eine juristisch
geringfügige, in der Wirkung aber einschneidende Maßnahme: In Art.33 GG
ist ein Absatz VI anzufügen: "Beamte dürfen nicht Mitglied einer
Partei sein." Wollen sie einer Partei dienen, dürfen sie nicht als
Beamte vortäuschen, für das Gemeinwohl zu arbeiten; und wenn sie den Eid
auf das Gemeinwohl ernst nehmen, kann es ihnen nichts ausmachen, nicht zugleich
einer Teilgruppe oder politischen Weltanschauung dienen zu dürfen.
Bohlander und Latour fordern das speziell für Richter und verweisen auf Art.395 Satz 1 der
spanischen Ley Orgánica del Poder Judical: "Art.395. (1) Richter dürfen
weder einer politischen Partei noch einer Gwerkschaft angehören, noch in deren
Diensten stehen..." und resümieren: "Im Sinne von Art.33 II und III 2
GG wäre eine solche Regelung sicher zu begrüßen, obwohl natürlich ein
Spannungsverhältnis zur politischen Meinungs- und Vereinigungsfreiheit bestünde,
das genauerer Abwägung bedürfte." Auch nach Hans Herbert von Arni
m sollte "das Übel
einfach an der Wurzel gepackt" und von Verfassungs wegen die
"Wählbarkeit von Beamten und Richtern ins Parlament untersagt"
werden.
Schwierig abzugrenzen ist der staatliche Bereich, in dem
parteiorientierte Amtsinhaber nicht geduldet werden dürfen, vom Bereich öffentlicher
Dienstleistungen. Während noch unmittelbar einsichtig ist, warum ein Polizeibeamter,
Lehrer oder Richter nur der Allgemeinheit verpflichtet und darum nicht parteigebunden
sein darf, bildet etwa der Gemeindeangestellte im Sozial- oder Bauamt einen
Grenzfall, während gegen eine Parteimitgliedschaft eines Müllwerkers
oder eines städtischen Bademeisters nichts einzuwenden sein dürfte. Die
Problemlage ist dieselbe wie in der allgemeinen Debatte um das Staatshandeln
durch Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes: Der Trend der Zeit
geht vom öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis der Beamten
weg. Gerade wenn man an die Beamteneigenschaft, wie hier vorgeschlagen,
die Forderung nach einem Parteibuchverzicht knüpft, muß der staatlich-hoheitliche
Bereich der Eingriffsverwaltung säuberlich vom Bereich bloßer Leistungsverwaltung
getrennt werden, der kein so hohes Maß an Neutralität erfordert. Während in
diesem nur die Daseinsfürsorge gewährleistet wird, tritt der Staat in jenem
dem Bürger mit der Ermächtigung gegenüber, ein Handeln zu verbieten oder zu
befehlen, so z.B. im Polizei- und Ordnungsrecht.
Vor allem im Bereich der Leistungsverwaltung für den Bürger
bedient der Staat sich zunehmend normaler Arbeitnehmer. Gerade die Führungsetagen
dieses mittelbar staatlichen Sektors, also z.B. die Aufsichtsräte und
Vorstände kommunaler Eigenbetriebe, sind aber als Pfründenobjekte besonders
dem Zugriff der Parteien ausgesetzt. Hier handelt der Staat nicht hoheitlich,
sondern tritt in bürgerlich-rechtlichen Formen wie ein privater Unternehmer
zur Gewinnerzielung oder zur Versorgung der Öffentlichkeit mit Gütern des
allgemeinen Bedarfs auf. Für die Führungsetagen solcher
staatlicher Betriebe wie öffentliche Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung
usw. ist ein Parteibuchverbot ebenso notwendig, wie in gleichwertigen Positionen
der hoheitlichen Staatsverwaltung. Damit die kommunalen Betriebe nicht
mehr zur Versorgung altgedienter Parteifunktionäre mißbraucht werden
können, muß aber noch mehr geschehen. Diese könnten ja vor ihrer Berufung
mit gegenseitigem Augenzwinkern aus ihrer Partei austreten und so das
Verbot umgehen. Erwin Scheuch fordert hier mit Recht, Vorstands- und Geschäftsführerpositionen
von Betrieben der öffentlichen Hand müßten öffentlich ausgeschrieben
werden. Die Bewerbungen seien dann von einem unabhängigen Unternehmensberater
zu prüfen.
Da ein einzelner, "unabhängiger"
Unternehmensberater aber leicht unter der Hand abhängig werden könnte, wäre
hier ein direkt der jeweiligen Landesregierung unterstehendes Gremium
vorzuziehen. Dessen Mitglieder müßten die Eigenschaften preußischer
Genauigkeit und Unbestechlichkeit mit persönlicher Unabhängigkeit von
Parteieinflüssen in ihrer Person vereinigen. Dem Gremium könnten sinnvollerweise
mit beratender Stimme Vertreter des Bundes der Steuerzahler oder ähnlicher
gesellschaftlicher Kontrollorganisationen angehören. Da die Furcht vor
öffentlicher Entlarvung ein beträchtliches Stimulans für gesetzestreues
Wohlverhalten sein kann, sollten Sitzungen dieses Gremiums öffentlich
sein. Letztlich muß man als Bremse für Postenprotektion an das Instrument
des Strafrechts für nachgewiesene Fälle denken, wobei die erwünschte Wirkung
des Strafrechts in der Abschreckung und der öffentlichen Bewußtseinsbildung
liegt.
Versteht man jedes gesetzliche Regelwerk als von Menschen
zur Legitimation der Herrschaft über Menschen aufgestellte allgemeine Befehle
auf Grundlage einer Herrschaftsideologie, dann stellt sich eigentlich nur
noch die Frage nach dem persönlichen Anknüpfungspunkt: Wer herrscht über
wen in wessen Namen und wessen Interesse? Wer unter Berufung auf demokratische
Prinzipien das Volk zum Dreh- und Angelpunkt dieser Überlegungen macht, kann
nicht ohne Verstoß gegen seine eigenen Prämissen auf eine Repräsentation
des Volks als Ganzem gegenüber seinen Teilen und ihren Sonderinteressen
verzichten. Daher kann eine Repräsentation ohne Berücksichtigung und Vertretung
des Volks als übergreifendem Bezugspunkt ihrer Natur nach nicht demokratisch sein.
"Die Regierung ist in erster Linie bestrebt, ihr Regierungsprogramm und damit die politischen
Vorstellungen der hinter ihr stehenden Parteien zu verwirklichen.
...
Die Parteien wieder
werden nur von Teilen des Volkes gebildet
und müssen nach den Intentionen dieser Teile agieren."
Sie erklären dagegen gern, mit der Wahl habe sich doch der
Wille "des Volkes" gezeigt, ihnen bis zur nächsten Wahl "freie
Hand" zu lassen. Sie seien nun einmal der klügste und fortschrittlichste
Teil des Volkes. Die anderen machten es schließlich ebenso, das sei nun einmal
der Pluralismus. "Hinter diesen Erklärungen steht eine Auffassung von
'Volk', die im demokratischen Staat
gar nicht existieren dürfte. Was sie bewirkt, ist die 'Parteienherrschaft',
'Gruppenherrschaft' oder 'Mediokratie', wie sie von niemandem gewünscht
oder gebilligt wird. Was dagegen Grundlage des demokratischen Denkens bilden müßte, wäre eine aus der Tiefe
des Bewußtseins stammende Liebe und Bejahung des Volkes als eines vertrauenerweckenden,
richtig denkenden und handelnden Ganzen." Es bedarf daher neben dem Bundestag als
gesellschaftlichem Repräsentationsorgan einer weiteren, im Wortsinne
demokratischen, also auf den Demos, das ganze Volk in seiner Totalität bezogenen
Repräsentation.
In diesem Zusammenhang wandte sich der Bundesverfassungsrichter
Böckenförde
mit Recht gegen die einseitige
Ansicht, unmittelbar Ideen, Werte oder einen abstrakten Gemeinwohlbegriff
als Bezugspunkt der Repräsentation heranzuziehen: Will diese demokratisch
sein, kann sie nicht losgelöst werden von ihrem Bezugspunkt, dem Volk;
und zwar nicht irgendeinem idealen oder hypothetischen, sondern dem wirklich
existierenden Volk.
Ohne ein auf das repräsentierte Volk
insgesamt bezogenes Amtsverständnis des Repräsentanten wäre ein Handeln
des Bundespräsidenten demnach von vornherein undemokratisch. Eine vom konkreten
Volk losgelöste, rein formale, also nur auf abstrakte Verfassungsnormen
bezogene Repräsentation kann den ihr unterworfenen Menschen weder die
Frage nach dem Sinn dieser Verfassung beantworten, noch kann sie auf die
Existenzfragen ihrer Bürger Rede und Antwort stehen.
Darum ist eine sich nur auf abstrakten
Verfassungspatriotismus stützende Repräsentation nicht demokratisch,
und sie kann auch auf Dauer mangels demokratischer Legitimation keine
stabile Herrschaft begründen: "Wenn eine Regierung lediglich im konstitutionellen
Sinne repräsentativ ist, wird ihr früher oder später durch einen repräsentativen
Herrscher im existentiellen Sinne ein Ende bereitet, und sehr wahrscheinlich
wird der neue existentielle Herrscher nicht allzu repräsentativ im konstitutionellen
Sinne sein."
Da alles staatliche Handeln nach Art.30 GG Ländersache ist,
soweit das Grundgesetz nicht ausdrücklich Zuständigkeiten auf den Bund
überträgt, untersteht den Ländern der quantitativ größere Teil der
Staatsverwaltung. Jedes Land ist ein Staat im Kleinen, nur ist er nicht souverän,
sondern eingebunden in die bundesstaatliche Ordnung. Eine Reform des
Parteienstaates durch institutionelle Trennung von Staat und Gesellschaft
kann nicht sinnvoll nur auf Bundesebene durchgeführt werden. Gerade auf
Länder- und Gemeindeebene müssen alle obigen Ausführungen sinngemäß in gleicher
Weise gelten.
So ist der Ministerpräsident jedes Bundeslandes durch das
Volk zu wählen, wie der Bundespräsident auf höherer Ebene. Ob die Funktionsaufteilung
zwischen einem Bundespräsidenten und einem Kanzler auch auf Landesebene sinnvoll
ist, müssen die einzelnen Länder selbst entscheiden. Die besondere Würde
eines über Staat, Gesellschaft und Ländern stehenden Präsidenten, der sich
nicht selbst in die Niederungen der Politik begibt und statt dessen einen
Kanzler regieren läßt, dürfte auf Landesebene nicht erforderlich sein. Der
vom Volk gewählte Ministerpräsident eines Landes
sollte also auch selbst die Landesregierung
bilden, wie das bereits der Fall ist. Auf Gemeindeebene schließlich ist die
direkte Wahl eines Bürgermeisters als Kommunaloberhaupt durch das Volk ein
eigentlich unentbehrliches Mittel, die Identifikation der Bürgers mit
ihrer Gemeinde und damit demokratisches Bewußtsein zu stärken.
Repräsentative Demokratie erfordert ein hohes Maß an Identifikation
des Bürgers mit seinen Vertretern. Heute hat die Öffentlichkeit ein sehr
feines Gespür dafür entwickelt, daß die Parteienvertreter tatsächlich
nur noch Parteieninteressen repräsentieren, und das hat in Deutschland
traditionell einen unangenehmen, anrüchigen Beigeschmack. Erfolg oder
Scheitern der repräsentativen Demokratie werden in den nächsten Jahren
davon abhängen, ob es gelingt, durch Direktwahl verantwortungsbewußter,
gemeinwohlorientierter und unabhängiger Kandidaten dem Bürger und Wähler
wieder das Bewußtsein zu vermitteln, daß da oben für ihn Politik gemacht
und das Gemeinwohl vertreten wird. Was die Politik in den Augen der Mehrheit
zu einem so schmutzigen Geschäft macht, ist nämlich der berechtigte Eindruck,
daß hinter den demokratischen Kulissen nichts als eigensüchtige Interessenvertretung
getrieben wird. Nur durch klare institutionelle Abgrenzungen auf allen
Ebenen ist eine Änderung möglich: Es muß nachvollziehbar und transparent
werden, wo das Gemeinwohl vertreten wird. Dann wird auch die Vertretung von
Sonderinteressen, zur rechten Zeit und am rechten Ort, in den Augen der
Bürger ihre innere Legitimität wiedergewinnen.
Eine ursprüngliche Aufgabe der in Deutschland aus Landständen
hervorgegangenen Parlamente war die Repräsentation der gesellschaftlichen
Gruppen gegenüber dem Monarchen, in dessen Person sich die legitimen
Interessen des Ganzen verkörperten. Mit dem allmählichen Zurückweichen des
Gedankens monarchischer Legitimität ging im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend
die gesetzgeberische Aufgabe auf die Parlamente über. Montesquieus Lehre
von der Gewaltenteilung eignete sich hervorragend dazu, der Allgewalt des
Absolutismus Scheibchen für Scheibchen an Macht abzuringen: Erst die gesetzgebende,
später die richterliche und, in Deutschland seit 1918, die regierende Gewalt,
bis die ursprüngliche prinzipielle Allzuständigkeit der Monarchen durch
eine ebensolche des Parlaments ersetzt war.
Diese Allgewalt muß gestutzt werden, wenn Gewaltenteilung
mehr sein soll als Salamitaktik zur Eroberung der Macht des Staates
durch die Gesellschaft und bloße Aufteilung von Verfassungskompetenzen
auf gleichermaßen von Regierungsparteien abhängige Filialen des Parlaments.
Wie der einer gesellschaftlichen Repräsentation nicht zustehende
Einfluß auf die Regierungsgeschäfte für das Ganze zu beseitigen ist, wurde
bereits dargelegt: Das Parlament darf sich nicht mehr einen von ihm
abhängigen Kanzler halten und sich in seine konkreten Regierungsentscheidungen
einmischen. Ebenso muß die Kompetenz des Parlaments zur Besetzung von
Richterstellen mit Parteifreunden beseitigt werden. Diese Befugnis ist
partei- und parlamentsunabhängigen Richterwahlausschüssen unter Aufsicht
des Bundespräsidenten zu übertragen. Diese Aufsicht beschränkt sich auf
die Unabhängigkeit der Ausschußmitglieder und die formale Rechtmäßigkeit
deren Entscheidungen. Die Sachentscheidungen des Ausschusses sind verwaltungsgerichtlich
überprüfbar, wobei das Gericht befugt ist, die Einhaltung des Leistungsprinzips
materiell zu überprüfen.
Im Vordergrund der modernen Parlamentstätigkeit steht die Gesetzgebung.
Sie kann dem Bundestag als dessen originäre Aufgabe nicht grundsätzlich entzogen
werden. Die Gesetzgebung nach Gutdünken der jeweiligen Mehrheit der gesellschaftlichen
Kräfte ist in einem Gemeinwesen nicht entbehrlich, das Wert legt auf die Legitimität
und Akzeptanz seiner Rechtsregeln durch die Bevölkerung. Der Grundsatz
der alleinigen Gesetzgebung durch das Parlament ist aber bereits heute vielfach
durchbrochen, und der verbreitete Glaube, es gebe in Deutschland eine wegen
der Gewaltenteilung strikt durchgehaltene ausschließliche Gesetzgebung
durch den Bundestag und die Landtage, ist ein laienhaft falscher Glaube.
Die Juristerei unterscheidet spitzfindig zwischen Gesetzen im formellen
und im materiellen Sinne: Formell gelten nur die vom Parlament beschlossenen
Regeln als Gesetze. Materiell, also inhaltlich, gilt eine Fülle nicht von
den Parlamenten beschlossener, abstrakt-genereller Regelungen. Bekanntestes
Beispiel ist die von der Regierung, nämlich dem Bundesverkehrsminister, aufgrund
einer gesetzlichen Ermächtigung im Straßenverkehrsgesetz erlassene Staßenverkehrsordnung.
Auch solche Regelungen sind inhaltlich Gesetze, weil wir uns alle an sie
halten müssen.
Das Parlament konnte schon seit der Weimarer Zeit nicht mehr
den sprunghaft steigenden Normenbedarf befriedigen, weil dieser immer
wieder die Kapazität der gesetzgebenden Organe überstieg. Was damals
aber als Übergangserscheinung angesehen wurde, erwies sich als bis heute
anhaltender Dauerzustand, der nicht auf Deutschland beschränkt, sondern in
allen hoch entwickelten Staaten anzutreffen ist. "Das unter der
Voraussetzung einer Autonomie der Gesellschaft entstandene parlamentarische
System ist insoweit der modernen Staatswirklichkeit nicht mehr kongruent,
wie die Gesetzgebungsrückstände der modernen Parlamente erkennen lassen."
Heutige Gesetzgebungstätigkeit ist mehr
und mehr auf einen fachjuristischen Mitarbeiterstab angewiesen, wie ihn
faktisch nur die Regierung mit ihrer Ministerialbürokratie effektiv und
dauerhaft leisten kann. Die Realität der täglichen Gesetzgebungsarbeit der
Bundestagsabgeordneten besteht daher darin, daß die Mehrzahl der Gesetze
paketweise die Lesungen durchläuft, ohne daß mehr als einige wenige Abgeordnete
von Einzelheiten ihres Inhalts überhaupt noch Kenntnis nehmen, geschweige
denn sie durchblicken oder gar Einzelfragen beeinflussen können.
"Unser Parlament ertrinkt in einer Flut von Gesetzgebungsaufgaben.
Die Gesetze sind zu dick und zu kompliziert, kaum noch jemand versteht
sie."
Die politischen Grundsatzentscheidungen werden gewöhnlich
auf Parteitagen oder in Verhandlungen der Koalitionsspitzen getroffen,
von Beamten der Ministerien oder von fraktionsangestellten wissenschaftlichen
Mitarbeitern ausgearbeitet und von der Abstimmungsmaschine Bundestag nur
noch am Fließband durch die gesetzlich erforderlichen formalen Verfahrensstationen
gepeitscht. Partei- und Fraktionsdisziplin, in der Praxis oft Fraktionszwang,
frustrieren viele Abgeordnete maßlos; und "häufig sind sie kaum mehr als
Ratifikationsmaschinen."
Nur wenn eine Gesetzesvorlage sich einmal
auf einen für alle verstehbaren Einzelpunkt beschränkt, wie das bei der
Debatte um die Strafbarkeit der Abtreibung der Fall war, sticht das echte
Ringen der Abgeordneten um eine überzeugende Lösung gerade als seltene
Ausnahme hervor. Und wenn dann noch ausnahmsweise der Fraktionszwang fehlt,
wird durch diese Auffälligkeiten nur bestätigt, daß Gesetzgebungsarbeit
im Regelfall mit argumentierender Debatte nichts zu tun hat.
Im gesetzgeberischen Alltag hat der einzelne Abgeordnete
nicht viel beizutragen und muß sich auf Vorgaben seiner Partei oder Vorgaben
der Regierung verlassen. Diesen faktischen Zwängen sollte künftig auch
normativ entsprochen werden, indem die Abgeordneten in größerem Maße
als bisher von den Aufgaben einer routinemäßigen Gesetzgebungsmaschinerie
entlastet werden. Dafür sollten sie zu schade sein und sich auf die
Entscheidung grundsätzlicher Fragen beschränken dürfen. Die Diskussion solcher,
auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbarer Fragen wie z.B. die nach dem
Schwangerschaftsabbruch, der Übertragung von Hoheitsrechten auf Brüssel
oder der Ausländereinwanderung muß von den engen Machtzirkeln der Parteien
dahin verlagert werden, wohin sie gehört: ins Parlament, sofern nicht das Volk
selbst zu entscheiden begehrt.
Der ungeheure Ballast an minder grundsätzlichen Gesetzesvorhaben
muß dagegen in größerem Umfang als bisher durch gesetzliche Verordnungsermächtigungen
an die Regierungsbehörden delegiert werden, die allein die erforderliche
fachjuristische Kompetenz und die quantitative Kapazität besitzen. Unbeschadet
eines jederzeitigen Rückholrechts des Bundestages sollten durch Regierungsverordnung
nicht nur der Straßenverkehr geregelt werden, sondern auch Materien wie die
Pfändungsfreigrenzen nach der Zivilprozeßordnung, Gebührenordnungen und
weite Bereiche des Verwaltungs- und Sozialrechts. Es genügt völlig, wenn
der Bundestag einen Rahmen setzt, den der regierende Verordnungsgeber
schnell und flexibel handhaben kann.
Diese Forderungen rechtfertigen sich einerseits aus der
Überlegung, daß sie bereits weitgehend dem realen Einflußverhältnis zwischen
Regierungsverwaltung und Parlament entsprechen, den Bundestag aber
entlasten und dort Kapazität für die wirklich für wichtig gehaltenen
Entscheidungen schaffen; und andererseits aus dem unverzichtbaren Grundsatz,
daß das Parlament als Normengeber über der Regierungsbürokratie steht und
eine Materie jederzeit wieder an sich ziehen kann. Dasselbe Über- und Unterordnungsverhältnis
muß zwischen dem Parlament und dem Volk bestehen: Wie das Parlament jederzeit
der Regierung die Normsetzung entziehen können muß, so muß das Volk seinem
Parlament jederzeit die Gesetzgebungsbefugnis entziehen können, wenn eine
qualifizierte Menge des Volkes das begehrt. Die Zuständigkeit der Vertreters
endet immer, wo der Vertretene selbst zu handeln gedenkt. Daß das Volk
dieses Recht heute auf Bundesebene nicht hat, macht seine von vielen Bürgern
empfundene Unmündigkeit aus und verstärkt den Eindruck, daß die abgeordneten
Vertreter hier eine eigene Souveränität auf Kosten der des Volkes begründen
wollen.
Die Gesetzgebung der Parlamente ist also von zwei Seiten her
zu beschneiden: Allfällige Routinemaßnahmen wie die Anpassung gesetzlich
festliegender Zahlenwerke (z.B. Gebührenordnungen) sind in weit größerem
Ausmaß als bisher auf die Regierung als Verordnungsgeber zu delegieren,
wobei das Parlament die Normsetzung aber an sich ziehen kann, wenn es das
für geboten hält. Auf der anderen Seite unterliegt das Parlament dem Recht
des Volkes, das seinerseits immer begehren kann, eine Rechtsmaterie zu regeln,
wenn ein ausreichend großer Teil der Öffentlichkeit die Frage für wichtig
genug hält.
Erst recht ist es nicht Aufgabe des Parlaments, als eine Art
Nebenregierung Regierungsakte zu ersetzen und darüber zu debattieren und zu
entscheiden, ob etwa deutsche Truppen der UNO zur Verfügung gestellt werden
sollen. Im System des Parlamentarismus ist diese Art der parlamentarischen
Direktregierung allerdings konsequent und veranschaulicht, daß von
Gewaltenteilung oder einer Trennung von Staat und Gesellschaft heute nicht die
Rede sein kann. Der Gesetzgeber hat die abstrakten und generellen Normen zu
setzen. Einzelfälle zu entscheiden hat er der Regierung zu überlassen. Die
Entscheidung eines Einzelfalles ist immer eine Maßnahme, ein konkreter Befehl,
und vor dem Einzelfallbefehl kann es keine Gleichheit ohne Ansehen der Person
geben. Gleichheit vor dem Gesetz ist aber unverzichtbarer Teil der
Rechtsstaatlichkeit.
Wie ein roter Faden hat sich die Übermacht der Parteien
bisher durch unsere Überlegungen gezogen; und ihr wesentliches Ziel ist
es, auf mehr Bürgerfreiheit und Mitentscheidung hinzuwirken. Heute liegt
der Machtanspruch der etablierten Parteien wie ein Leichentuch überall
dort gebreitet, wo unabhängige Meinung sich regen will. Die Parteien haben
sich nicht nur rechtlich institutionell abgesichert, sondern auch ein
Vorfeld der Meinungskontrolle geschaffen. Dieses wird von Parteigängern in
öffentlichen und gesellschaftlichen Institutionen und den Medien
gebildet und sucht jeden mundtot zu machen, der den universalen Machtanspruch
der Parteien in Frage stellen oder gefährden könnte. Wer grundsätzliche
Kritik am Alpdruck der Parteienherrschaft zu üben wagt, wird von den
Schaltstellen gesellschaftlicher Kommunikation ausgesperrt. Man redet
in Talk-Schauen, jenen Mitternachtsmessen der liberalen Diskursgesellschaft,
betroffen über ihn, aber niemals mit ihm. Er wird ausgegrenzt, gesellschaftlich
geächtet, stigmatisiert, durch den Verfassungsschutz beobachtet oder gar
kriminalisiert.
Die Mitwirkung der Parteien an der öffentlichen Meinungsbildung
hat sich längst zu ihrer Erzeugung und Manipulation durch die allein seligmachende
Verkündung des volkspädagogisch Erwünschten durch seine Medienapostel gemausert.
Sogar Richard von Weizsäcker
fragte besorgt: "Ist
das so vom Grundgesetz gewollt? Der Einfluß der Parteien geht ohnehin über
den politischen Willen, von dem allein die Verfassung redet, weit hinaus.
Die Parteien wirken an der Bildung des gesamten gesellschaftlichen Lebens
aktiv mit. Sie durchziehen die ganze Struktur unserer Gesellschaft bis tief
hinunter in das seiner Idee nach doch ganz unpolitische Vereinsleben."
Die Allgewalt der Parteien kann nur durch eine umfassende
Rechtsreform gebrochen werden, die sie auf ihre verfassungsmäßige Rolle
zurückführt. Als Ausdruck gesellschaftlicher Selbstorganisation sind
Parteien für ein Gemeinwesen freier Bürger geradezu kennzeichnend. Und
das Recht, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, entspringt
einem so grundlegenden menschlichen Bedürfnis, daß es gegen jede totalitäre
oder absolutistische Versuchung verteidigt werden sollte. Hier beginnt
die Berechtigung des Parteienwesens, und hier endet ihr legitimer
Entfaltungsspielraum aber auch schon. Wo immer sich eine Partei darüber
hinaus den Zugriff auf staatliche, also der Allgemeinheit dienende Machtmittel
erlaubt und dadurch die unabdingbare Neutralität des Staates in Frage
stellt, darf dieser illegitime Übergriff nicht legalisiert werden. Weder
dürfen gesellschaftliche Teilgruppen auf Kosten des Ganzen parasitieren,
noch gar die erbeuteten Geldmittel dazu mißbrauchen, sich bei ihren Opfern,
den steuerzahlenden Bürgern, in teueren Wahlkämpfen als deren Wohltäter aufzuspielen.
Durch die Verfügung über das Geld der nicht parteigebundenen Bevölkerung
üben die Parteien Macht über die Bürger aus.
Daß die Parteien das Geld der Allgemeinheit
auch wieder nur für die Allgemeinheit ausgeben dürfen, wenn sie in den
Parlamenten Haushaltsgesetze beschließen, und daß an ihren Händen kein
Geld kleben bleiben darf, muß im Grundgesetz ergänzt und zu einer Staatsfundamentalnorm
erhoben werden: Jedwede Finanzierung politischer Parteien aus Steuergeldern
und jedwede steuerliche Bevorzugung von Parteien ist zu verbieten.
Auch das zweite, entscheidende Herrschaftsinstrument der
Parteien über das Volk muß ihnen aus der Hand genommen werden: die Parteibuchwirtschaft,
das Bilden parteilicher Metastasen in der öffentlichen Verwaltung und die gesamte
damit verbundene Pfründenwirtschaft, die Versorgung von Parteigängern
mit Staatsämtern. Wenn es nicht mehr von persönlichem Vorteil sein wird, Parteigenosse
zu sein, wird auch niemand mehr systematisch zurückgesetzt werden, der dies
nicht ist. "Wes' Brot ich eß, des' Lied ich sing?" - das wird in
Staatsverwaltung und Massenmedien hoffentlich nicht mehr nötig sein.
Nach liberaler Doktrin sollten die Parteien eine Brückenfunktion
zwischen Staat und Gesellschaft wahrnehmen: Als gesellschaftlich frei
gebildete Organisationen mündiger Bürger sollten sie gleichsam mit ihren
Wipfeln in die Sphäre der Verfassung hineinragen. Das Bundesverfassungsgericht
hält sie gar als Wahlvorbereitungsorganisationen für unentbehrlich. In
allen diesen Funktionen haben die real existierenden Bundestagsparteien
aber kläglich versagt und ihre Macht mißbraucht. Wo ihnen der Staat gestattete,
einen Fuß in die Tür staatlicher Organisation zu setzen, brachen sie in
einem beispiellosen Marsch durch alle Institutionen und eroberten den
Staat von innen. Oder nach dem Bilde der in der Gesellschaft wurzelnden und
mit den Wipfeln ins Verfassungsrecht ragenden Parteien: Die Parteien haben
sich am Stamm der staatlichen Organisationshierarchie hochgerankt wie
eine tropische Schlingpflanze, im Wipfel entfaltet und ersticken jetzt den
Staat, ihre "Wirtspflanze" unter der Last wuchernder Triebe.
Damit ist das liberale Modell einer sich selbst regierenden
Gesellschaft gescheitert. Ebenso wie der Marxismus vom endlichen Absterben
des Staates träumte, begegnet der Liberale allem Staatlichen mit tiefem
Mißtrauen und suchte dieses möglichst zugunsten nur gesellschaftlicher
Organisation in den Hintergrund zu drängen. Der real existierende Parlamentarismus
in seinen Mutterländern Großbritannien und den USA wie auch seine nach
Deutschland verpflanzte Variante machen augenfällig, daß ein schwacher
Staat und eine Gesellschaft, der man freien Lauf läßt, nicht zu einem solidarischen
Gemeinwesen freier Bürger führt, sondern zu einer Zweidrittelgesellschaft,
in der die wohlorganisierten Interessengruppen den Ton angeben und mafiose
Strukturen die Staatlichkeit allmählich auflösen und Bürgerfreiheit, demokratische
Mitverantwortung und den inneren Zusammenhalt der Res publica gesetzmäßig
verringern. Die liberale Vorstellung einer Brückenfunktion der Parteien
zwischen Staat und Gesellschaft hat sich damit als untauglich erwiesen.
Allenfalls sind die Parteien wie herabgelassene Zugbrücken, über die die
formierte Gesellschaft in die Burg des Staates eindringen kann. Wer den
Grundgesetzsatz, nach dem die Parteien an der politischen Willensbildung
des Volkes mitwirken sollen, so versteht, der Staat sollte sie wie Verfassungsorgane
inkorporieren, macht sie zum trojanischen Pferd des Partikularen.
1948 trat auf der Insel Herrenchiemsee eine seltsame Schar
gutsituierter Persönlichkeiten zusammen, fast ausschließlich Herren.
Wenn wir sie in alten Filmen sehen, fällt an ihrem Erscheinungsbild vor allem
auf, daß der Typus des überfütterten Bundis noch völlig fehlte. Blaß, dünn
und in abgetragenen, gräulichen Anzügen saßen sie da auf Anordnung und unter
Aufsicht der Alliierten zusammen und meinten es mit dem deutschen Volk so
gut, daß sie ihm ein Grundgesetz zimmerten, in dem das Volk unmittelbar überhaupt
nichts zu sagen hat. Sicherlich haben sie "uns alle geliebt." Wer
wollte rückblickend Arges über sie denken? Auch heute noch lieben uns
unsere Parteipolitiker. Sie meinen es so gut mit uns, daß sie gar nicht aufhören
wollen, uns zu beglücken.
Nein, böse Leute sind unsere Parteipolitiker nicht. Der
Fehler steckt im System. Selbst wenn es praktisch möglich wäre, in dieser Republik
die herrschenden Parteien abzuwählen und neue Gesichter ins Rennen zu
schicken, würden diese neuen Menschen und neuen Parteien unter Fortgeltung
der heutigen Spielregeln über kurz oder lang ein ähnlich geschlossenes
System bilden wie das der jetzigen Parteien. Wir haben das Plebiszit bisher
kennengelernt als die Nadel, mit der allein der ganze aufgeblasene
Luftballon des Bonner Parteienfeudalismus zum Platzen gebracht werden
kann. Wir haben es auch als unentbehrlich erkannt, einem Staatsoberhaupt
nebst Regierung die unentbehrliche Weihe demokratischer Zustimmung der
Regierten zu verleihen. Schließlich sahen wir das gesetzgeberische Plebiszit
als vorrangig vor parlamentarischem Gesetzeswerk an.
Die Bedeutung des Plebiszits erschöpft sich keineswegs in
seiner destruktiven Wirkung gegenüber oligarchischen Wildwüchsen. Wenn
die Verfestigung undemokratischer Strukturen auf Dauer verhindert und der
Bildung einer Obrigkeit wie der des jetzigen Parteienkartells entgegengewirkt
werden soll, kann das nur durch direkte Entscheidungsrechte des Volkes auf
allen Ebenen geleistet werden. Jeder Bürger, der nicht zum auserwählten
Kreis der Berufsrepräsentanten gehört, wird die Forderung unmittelbar
einleuchtend und nicht weiter begründungsbedürftig finden, ihm ein direktes
Mitspracherecht über seine Belange einzuräumen. Also: Warum eigentlich
nicht?
Wir müssen hier zwischen wahren und vorgeschobenen Gründen
unterscheiden: Historischer Hauptgrund für den fast völligen Ausschluß
des Volkes von der unmittelbaren Einflußnahme war 1949 die Angst der
alliierten Besatzer, das deutsche Volk könnte trotz Krieg und Niederlage
nicht demokratisch kapitelfest sein und wieder böse Leute wählen oder kraft
Volksabstimmung den Besatzern unliebsame Entscheidungen treffen. So hat
Otmar Jung belegt, daß die Befürworter einer engen Anbindung der Bundesrepublik
an die Westalliierten fürchteten, die Bevölkerung könnte diese nicht mittragen,
und eine Volksabstimmung könnte diese Kluft zwischen den Landtagen und der
Bevölkerung offenbar werden lassen.
Die vorgeschobenen historischen Gründe aus
der Weimarer Zeit verfangen nicht. Es ist ins Reich der Legende zu verweisen,
die Weimarer Republik sei an zu vielen Plebisziten gescheitert. In Wahrheit
hat es damals keine einzige rechtsgültige erfolgreiche Volksabstimmung gegeben.
Aus alliierter Sicht mag sich auch ein ganzes Volk nicht so
einfach manipulieren und kontrollieren gelassen haben wie eine Schar handverlesener
Günstlinge der Besatzungsmächte. Schon im Vorfeld der Ausarbeitung des
Grundgesetzes hatten diese den Deutschen nämlich keineswegs völlige demokratische
Entscheidungsfreiheit eingeräumt, sondern sich durch Vergabe von Lizenzen
an Presseorgane und Parteien den maßgeblichen Einfluß auf die von ihnen jeweils
gewünschte Richtung deutscher Politik gesichert. Auch nachdem die Landtage
mit Vertretern der von ihnen lizenzierten Parteien besetzt und der Parlamentarische
Rat gebildet war, hatten die Alliierten an den eigenen Vorstellungen der
deutschen Parlamentarier einiges auszusetzen und nahmen durch Anweisungen
direkten Einfluß auf einzelne Regelungen des Grundgesetzes.
Auch im mittleren Teil Deutschlands, der damaligen Sowjetischen
Besatzungszone, legte man aus denselben, naheliegenden Gründen keinerlei
Wert auf völlig freie Wahlen oder gar Volksabstimmungen, die mit einem
Fiasko für die Besatzungsmacht geendet hätten. Die Kollaborateure und
Günstlinge der Besatzungsmacht konnten sich so fest in die Regierungssättel
setzen und jede unerwünschte Konkurrenz verdrängen, daß es in der späteren
DDR 40 Jahre lang dauerte, eine parasitäre Kaste in der Moskauer Emigration
geschulter Funktionäre abzuschütteln. Sie sind durch eine handgreifliche
Art von Volksentscheid weggespült worden, und wer das Selbstbewußtsein der
Massen auf jenen Demonstrationen wie montags in Leipzig selbst erlebt hat,
wird den Wert des geschriebenen Verfassungsparagraphen nie wieder überschätzen.
Auch im wiedervereinigten Deutschland könnten die Lehren der
Wendezeit nutzbringend angewendet werden. Es ist in salbungsvollen Reden
der letzten Jahrzehnte zum Überdruß zu hören gewesen, aus der Geschichte
solle man lernen; und nach dem Sturz des Kommunismus in Mitteldeutschland
beschworen gerade sogenannte Bürgerrechtler gern die Erfahrungen aus der
Wendezeit, die in das vereinte Deutschland eingebracht werden sollten. Wenn
hier eine Erfahrung an erste Stelle zu setzen und auf das ganze Deutschland
zu übertragen ist, dann die: Nie wieder gegen das Volk herrschen! Waren sie
nicht alle "Verfassungsfeinde", die da montags auf die Straße gingen
in Leipzig, Dresden, Berlin und anderswo? Haben sie nicht die geschriebene
Verfassung der DDR durch ihr beherztes Handeln zur Makulatur gemacht?
Eine illegitime Verfassung, die nur für eine dünne Schicht von Parteifürsten
das Perpetuum mobile ihrer Machterhaltung bedeutet, kann auch durch zivilen
Ungehorsam beseitigt werden, indem sie ganz einfach niemand mehr anwendet.
Das souveräne Volk steht über seiner Staatsverfassung und hat die Macht und
das Recht dazu, sich den seinen Bedürfnissen adäquaten Staat zu schaffen und
des ihm jeweils nützlichen Systems zu bedienen. Wer ihm dieses Recht verwehrt,
hindert die demokratische Selbstbestimmung. Diese erst verleiht dem
Staatswesen die innere Legitimation und volle Autorität, kraft deren ziviler
Ungehorsam seinerseits illegitim ist. "Insofern das eigene Land, das
eigene Volk, die eigene Nation etwa von einer Partei terrorisiert oder von
einem anderen Staat gamz oder teilweise an der Entfaltung einer eigenen 'Logik
des Leviathan' gehindert wird, wäre ein 'ziviler Ungehorsam' sinnvoll, der
sich, wie Carl Schmitt in der Nachfolge Hobbes' formulierte, als 'Pflicht zum Staate' darstellen könnte."
In einer politischen
Ordnung, die den Gedanken der Volksherrschaft ernst nimmt und Volksabstimmungen
zuläßt, kann eine solche Kluft zwischen dem Volk und mit einer illegitimen
Verfassung herrschenden illegitimen Machthabern nicht so leicht entstehen.
Eine Herrschaftsordnung, die dem Volk jedes
direkte Mitspracherecht versagt, weil sie ihm zutiefst mißtraut oder es,
versteckt oder offen, nur kontrollieren oder in irgendwelche Internationalen
einbinden will, kann nicht auf die Dauer stabil sein. Früher war das einmal
anders. Doch im Zeitalter der Medien und der Massenkommunikationsmittel,
der mündigen, emanzipierten Bürger stößt auch die perfekteste Manipulation
und Meinungslenkung an ihre Grenzen. Die Verfassung muß daher schnellstmöglich
für Plebiszite geöffnet werden, solange sich die Mehrheit in Deutschland
noch an sie hält.
Auch wenn das destruktive Plebiszit gegen jenes Parteienkartell
nicht mehr notwendig sein wird, das so gerne anstelle des souveränen
Volkes die Entscheidungen trifft, bleibt es als konstruktives Plebiszit unverzichtbar.
Legitimität von Repräsentantenentscheidungen wird zunehmend
problematisch in einer Zeit, in der von Mafiastrukturen, Lobbies,
auserwählten Hintermännern und einflußreichen multinationalen
Strukturen eine beklemmende Wirkung auf die verängstigte Psyche mancher
Deutscher ausgeht. Seien derartige Einflüsse real oder eingebildet: Vox populi,
vox dei! Dann kann man wenigstens nachher kein Malheur irgendwelchen Dunkelmännern
in die Schuhe schieben. Soziologisch beschreibbar und real sind aber jene
unliebsamen Parteioligarchien, gegen deren Giftdämpfe das Plebiszit nach
den Worten Robert Michels das beste Heilmittel ist. Solche Machtcliquen und
andere gruppenegoistischen Partikularinteressen beruhen gerade auf dem
strengen Repräsentationsprinzip und können sich umso weniger durchsetzen,
je mehr direktdemokratische Elemente eine Verfassung enthält.
Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist die Verbesserung
des ganzen innenpolitischen Klimas in einem Staat, dessen Bürger und Repräsentanten
stets in dem Bewußtsein leben, die Vertretenen könnten ihre Vertreter jederzeit
aus ihren Luftschlössern mit dem Stimmzettel auf den Boden der Tatsachen
herabholen. Allein schon das Bewußtsein der Repräsentanten, vom Volk jederzeit
in der Sache korrigiert werden können, würde allzu bürgerferne Projekte
verhindern.
Natürlich sollen die Bürger nicht alles und jedes
entscheiden müssen: Es ist ja gerade der Sinn des Plebiszits, die
Parlamentarier dazu zu zwingen, im Sinne der Bürger und nicht verbohrter Ideologen
oder mächtiger Interessenten zu handeln. Soweit sich das Politikerhandeln
mit dem Mehrheitswillen deckt, darf erwartet werden, daß keine ausreichende
Zahl von Bürgern Anstoß nimmt und einen Volksentscheid begehrt. Im Grundsatz
ist von dem oben dargestellten dreistufigen Aufbau des Rechtes zum Erlaß
aller konkreten (Regierungsentscheide oder Volksentscheide
in Regierungsfragen) und aller generellen Regelungen (Gesetze
und Rechtsverordnungen) auszugehen. Danach steht das Parlament über der
Regierung und das Volk über dem Parlament.
Einen ähnlichen dreigliedrigen Aufbau der Gesetzgebungskompetenz
sieht die Verfassung des Landes Brandenburg vom 22.4.1992 vor: Auf gesetzliche Ermächtigung des Parlaments
hin kann die Landesregierung Recht setzen, soweit dieses nicht von gesetzlichen
Vorgaben des Parlaments abweicht. Die auch in den westlichen Bundesländern
übliche Rechtsverordnung ist eine abstrakt-generelle Regelung, also Recht
im materiellen Sinne. Über dem parlamentarisch beschlossenen Gesetz
steht aber der Volksentscheid nach Art.78.
Die praktische Funktion solcher direktdemokratischer
Elemente steht und fällt mit der Höhe des Quorums. Soweit auch in westlichen
Bundesländern seit Jahren in der Verfassungstheorie Volksbegehren
zulässig waren, blockte sie ein zu hohes Quorum schon im Vorfeld politischer
Organisation ab. "Das Volk ist eben insgesamt nicht handlungsfähig;
vielmehr müssen immer wieder aus dem Volk kleine, den Etablierten widersetzliche
Gruppen emporsteigen, die nicht die Medien auf ihrer Seite haben und daher
nicht von vornherein z.B. 20% der Wählerstimmen für ein Volksbegehren
mobilisieren können." So kann man demokratische Offenheit vortäuschen
und sich durch ein zu hohes Quorum doch des ungestörten Genusses oligarchischer
Macht völlig sicher sein.
Wenn es nicht gelingt, diese Ruhe und Sicherheit der Etablierten
nachhaltig durch demokratische Unruhe und systemüberwindende Reformen
zu stören, wird die Kluft zwischen Volk und Parteien immer mehr zunehmen,
die sich bereits heute in laufenden dramatischen Einbußen der Etablierten
bei allen Wahlen zeigt. "Auch den demokratischen Parteien könnte
passieren, was den autoritären Parteiregimen im Osten passierte. Die illegitime
Macht könnte ihnen eines Tages unter den Händen zerbröckeln."
Weitere Teile des Volkes werden sich fragen,
ob es in unserem Lande noch eine wirkliche Chance gibt, die im Bundestag seit
Jahrzehnten regierenden Großparteien abzulösen. Wenn diese ihre Macht weiter
abschotten, wächst die von Carl Schmitt aufgewiesene Gefahr unfriedlicher
Ausbrüche. Wenn dem Volk nicht die nötigen Äußerungsformen zugestanden würden,
wächst die Gefahr, daß die zunehmende und berechtigte Unzufriedenheit
sich unkontrolliert Bahn bricht.
Der einzige Grund für eine Opposition,
sich im Streben zur Regierungsverantwortung bürgerkriegsähnlicher
Methoden zu enthalten, ist nämlich das wirkliche Bestehen der legalen
Chance friedlicher Machtgewinnung
. Wo der Staat von einer formierten gesellschaftlichen
Gruppe erobert ist und den anderen Gruppen den inneren Frieden verweigert,
entfällt für diese jeder rechtfertigende Grund, sich einer solchen Parteiräson
zu beugen und ihrerseits den inneren Frieden zu halten. Ob die Chance heute
für nonkonforme Kräfte besteht, wird die nahe Zukunft zeigen. Andernfalls
gilt: "Wenn die Repräsentativverfassung vor Herausforderungen
versagt, die die Interessen aller berühren, muß das Volk in Gestalt seiner
Bürger
...
in die originären
Rechte des Souveräns eintreten dürfen. Der demokratische Rechtsstaat ist
in letzter Instanz auf diese Hüter der Legitimation angewiesen."
Ù
Zeitschriften:
Criticón,
Hrg.Caspar von Schrenck-Notzing, München, Knöbelstr.36/V.
FAZ =
Frankfurter Allgemeine Zeitung
NJW = Neue
Juristische Wochenschrift, Beck-Verlag, München.
ZRP = Zeitschrift
für Rechtspolitik, Monatsbeilage zur NJW, Hrg.Martin Kriele, Beck, München.
Adam, Konrad, Die Ohnmacht der Macht, 1994.
- Ich kenne nur noch Parteien, FAZ 3.9.1992.
- Wenn der Staat zum Besitz der Parteien wird, FAZ 2.3.1991.
Agnoli, Johannes, in: ders.-Brückner, Die Transformation der
Demokratie, 1967.
Amira, Karl von, Grundriß des germanischen Rechts, 3.Aufl.1913.
Aristoteles, Politik, Hrg.Nelly Tsouyopoulos, Ernesto
Grassi.
Arnim, Hans Herbert von, Die Partei, der Abgeordnete und das
Geld, Mainz 1991.
- Ein demokratischer Urknall, DER
SPIEGEL Nr.51/1993 vom 20.12.1993, S.35.
- Hat die Demokratie Zukunft? FAZ 27.11.1993.
- Staat ohne Diener, 1993.
- Wenn der Staat versagt, FAZ 13.7.1993.
- "Der Staat sind wir!", München 1995.
Aron, Raymond, Demokratie und Totalitarismus, 1965.
Benda, Ernst, Vom rechten Umgang mit rechten Parteien, NJW
1994,22.
Berglar, Peter, Die Wiederkehr der Biographie,
Vergangenheitsanschauung und geschichtliche Orientierung, Criticón 1978,231.
- Wie krank ist die Spätdemokratie? Die Entmündigung des Bürgers,
in: Criticón 1987,153.
Birg, Herwig, Differentielle Reproduktion aus der Sicht
der biographischen Theorie der Fertilität, in: Eckart Voland (Hrg.),
Fortpflanzung, Natur und Kultur im Wechselspiel, 1992, S.189.
Bismarck, Otto von, Gedanken und Erinnerungen Bd.I, Neue
Ausgabe Berlin 1922.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Demokratie und Repräsentation,
Hannover 1983.
- Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat
und Gesellschaft als Bedingung der individuellen Freiheit, 1973.
- Staat, Verfassung, Demokratie, 1991.
Bodin, Jean, Les
Six livres de la République, 1583, Über den Staat, Hrg.Gottfried Niedhardt,
Stuttgart (Reclam) 1976/1982.
Braun, Johann, Recht und Moral im pluralistischen Staat,
Juristische Schulung (JuS) 1994,727.
Brender, Reinhold, Der Staatsstreich als kleineres Übel -
Eine fragwürdige Atempause in Algerien? FAZ 16.5.1992.
Burckhardt, Jacob, Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1905,
Neudruck
Cardano,H., Opera omnia, 1663, De summo bono = Opera I,
zit.nach Kondylis, Metaphysikkritik.
Cortés, Juan Donoso, Essay über den Katholizismus, den
Liberalismus und den Sozialismus, 1851, Hrg.Günter Maschke, 1989.
Depenheuer, Otto, Der Mieter als Eigentümer; Neue
Juristische Wochenschrift (NJW) 1993, 2561.
Dettling, Warnfried, Demokratisierung - Wege und Irrwege,
Hrg.: Institut der deutschen Wirtschaft, Köln, 3. Aufl.1974.
Diwald, Hellmut, Geschichte der Deutschen, 1978.
Dürig, Günter, Grundgesetz, Kommentar, von
Maunz/Dürig/Herzog, München 1994.
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus, Der Mensch, das riskierte Wesen,
1988.
- Wider die Mißtrauensgesellschaft, 1994.
Eisermann, Gottfried, Parteienkrise - Staatskrise, in:
Herder-Initiative Bd.73 (Hrg.Gerd-Klaus Kaltenbrunner) 1988, S.85.
Ellwein-Hesse, Das Regierungssystem der Bundesrepublik
Deutschland, 6.Aufl. 1988.
Engdahl, F.
William, A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World
Order, (dtsch. Ausgabe: Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, 1992).
Enzensberger, Hans Magnus, Aussichten auf den Bürgerkrieg,
1993.
Eyermann-Fröhler, Kommentar zur
Verwaltungsgerichtsordnung, 9.Aufl. 1988.
Fahrenholz, Peter, Wenn ein Journalist Streibls Mißfallen
erregt, in: Frankfurter Rundschau 2.6.1992.
Fest, Joachim, Offene Gesellschaft mit offener Flanke, FAZ
21.10.1992.
Fichte, Johann Gottlieb, Fichtes Reden an die deutsche
Nation, 1808, Hrg.Eucken, 1915.
Fichte, Johann Gottlieb, Staatslehre, 1813, Werke IV.
Forsthoff, Ernst, Verfassungsgeschichte der Neuzeit,
4.Aufl.1961/1972.
Freund, Michael, Eliten und Elite-Begriffe, Herder-Initiative
Bd.29, Hrg.Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Freiburg 1977, S.28 (35).
Friedrich II, Brief, zit.nach Hans Pleschinksi (Hrg.),
Voltaire - Friedrich der Große, Aus dem Briefwechsel, 2. Aufl.1993.
Friedrich, Carl J., Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 1953
Fromme, Friedrich Karl, Präsidentin, Vizepräsident - Ein
verabredetes Rollenspiel bringt eine Frau in das höchste Richteramt, FAZ
27.5.1994, S.12.
- Über die Art des Regierens beunruhigt, FAZ 15.11.1993.
Früchtl, Josef, Klug und gut - Gibt es Menschenrechte? FAZ
29.1.1992.
Fukuyama, Francis, Das Ende der Geschichte - Wo stehen wir?
1992.
- Der Mensch braucht das Risiko, DER SPIEGEL Nr.15/1992,
S.256.
- Die Zukunft des Krieges, FAZ-Magazin 16.12.1994, S.16.
Geck, Wilhelm Karl, Wahl und Amtsrecht der
Bundesverfassungsrichter, 1986.
Gehlen, Arnold, Urmensch und Spätkultur, 1956.
Geitmann, Roland, Volksentscheide auf Bundesebene, ZRP 1988,
S.126 ff.
Gillessen, Günter, Die Rache der Veteranen, FAZ 9.5.1992.
Glotz, Peter, Die deutsche Rechte, 1989.
Göring, Helmut, Tocqueville und die Demokratie, 1928.
Gössner, Rolf, Auch Gesinnungsschnüffelei gegen rechts
führt in eine Sackgasse, Frankfurter Rundschau 26.1.1994.
Grebel, Volkram, Wer kontrolliert die 'Vierte Gewalt? in:
Die politische Meinung, Hrg.K.-Adenauer-Stiftung, Nr.285, Aug.1993, S.79 ff.
Gruhl, Herbert, Die Menschheit ist am Ende, DER SPIEGEL
23.3.1992.
Häberle, Peter, Soziale Marktwirtschaft als "Dritter
Weg", ZRP 1993, 383.
Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung, 1992.
- Ziviler Ungehorsam - Testfall für den demokratischen
Rechtsstaat, in: Peter Glotz (Hrg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat,
1983, S.29 ff.
Heckel, Hans, "Es ist alles noch viel schlimmer",
Ostpreußenblatt 25.9.1993, S.4.
- Das Deutsche wird schließlich erlöschen,
Ostpreußenblatt 6.11.1993, S.2.
Heineccius, Johann Gottlieb, Elementa juris naturae et
gentium, 1737, (Grundlagen des Natur-
und Völkerrechts), Hrg.Christoph Bergfeld, 1994, S.58.
Hennis, Wilhelm, Amtsgedanke und Demokratiebegriff, in:
Staatsverfassung und Kirchenordnung, Festgabe für Rudolf Smend, 1962, S.55 f.
- Auf dem Weg in eine ganz andere Republik, FAZ 26.2.1993.
- Überdehnt und abgekoppelt - An den Grenzen des Parteienstaates,
in: Christian Gr.v. Krockow (Hrg.), Brauchen wir ein neues Parteiensystem,
Frankfurt 1983.
Heptner, Bernd, Öko-Diktatur oder Sturmlauf gegen die
Ökologie? FAZ 27.12.1994.
Herzog, Roman, in: Maunz-Dürig-Herzog, Kommentar zum
Grundgesetz, 1994, Zitierweise: M-D-H.
Herzog, Roman, Staatslehre.
Hesse, Konrad, Bemerkungen zur heutigen Problematik und
Tragweite der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Die
öffentliche Verwaltung (DöV), 1975, S.437 ff., 438.
Hildebrandt, Walter, Der Schmarotzer - ein Symptom unserer
Zeit, in: Herder-Initiative Bd.43 (1981), S.50.
Hilger, Norbert, Armin Mohler und der Neokonservatismus, in:
Die neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte, Heft 8/1991, S.718.
Hippel, Ernst von, Der Rechtsgedanke in der Geschichte,
1955.
Hobbes,
Thomas, Leviathan,
Stuttgart
(Reclam), 1970.
Hoffmann-Lange, Ursula, Eliten und Demokratie in der
Bundesrepublik, in: Max Kaase (Hrg.), Politische Wissenschaft und politische
Ordnung, Opladen 1986.
Hoppe, Werner, Die Regelung der verwaltungsrechtlichen
Organstreitigkeiten, NJW 1980, 1017 ff..
Hornung, Klaus, Eine antitotalitäre Phalanx - Der Kreisauer
Kreis und seine Nachwirkungen in der Bundesrepublik, FAZ 1.11.1993.
- Lorenz von Stein, Criticón 1980,56.
- Über die Effizienz der Demokratie, Criticón 1979,306.
Huber, Ernst Rudolf, Die Einheit der Staatsgewalt, Deutsche
Juristen-Zeitung 1934,950.
Ihering, Rudolf von, Der zweck im Recht, 1. Aufl. I 1877, II 1884.
Illies, Joachim, Der Affenfelsen und wir, Criticón 1982,68.
Isensee, Josef, Die künstlich herbeigeredete
Verfassungsdebatte, in: Die politische Meinung Nr.269, April 1992, S.11
(14), Hrg.Bernhard Vogel.
- Staatsrepräsentation und Verfassungspatriotismus, Criticón
1992, S. 273.
Jäde, Henning, Die Lebenslüge der Demokratie,
Herder-Initiative Bd.20, 1977, S.107.
Jäger, Wolfgang, Für einen Parlamentskanal, in: Die
politische Meinung Nr.270, Mai 1992, S.53 (58).
Jeismann, Michael, Ende des Hochamts, FAZ 28.5.1994.
Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 3.Aufl.1929.
Jung, Ernst Julius, Die Herrschaft der Minderwertigen,
2.Aufl.1930
Jünger, Ernst, Der Arbeiter, 1932, Ausgabe 1982.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, Der schwierige Konservatismus =
ders. (Hrg.) Rekonstruktion des Konservatismus, 1972, S.7.
- Rückblick auf die Demokratie, in: Herder-Initiative
Bd.20, 1977, S.7.
Kant, Immanuel, Metaphysik der Sitten.
- Zum ewigen Frieden, Werkausgabe Bd.XI.
Kimminich, Otto, Verfassungsgerichtsbarkeit und das Prinzip
der Gewaltenteilung, in: Herder-Initiative Bd.33, Hrg. Gerd-Klaus
Kaltenbrunner, 1979, S. 62.
Klein, H.H., Die Grundrechte im demokratischen Staat,
1977.
Klein, Markus, Machiavellis Lageanalyse, in: Politische
Lageanalyse, Festschrift für Hans-Joachim Arndt, 1993, S.129.
Knütter, Hans-Helmuth, Die Faschismus-Keule - Das letzte
Aufgebot der deutschen Linken, 1993.
Kondylis, Panajotis, Die neuzeitliche Metaphysikkritik,
1990.
- Konservativismus, Geschichtlicher Gehalt und Untergang,
1986.
- Macht und Entscheidung, 1984.
- Ohne Wahrheitsanspruch keine Toleranz, Im Widerstreit
sind universales und partikulares Kulturverständnis aufeinander angewiesen,
FAZ 21.12.1994.
- Montesquieu und der Geist der Gesetze, Berlin 1996.
Kraus, Hans Christof, Die politische Lehre des Leviathan,
Criticón 1988, S.197.
Kriele, Martin, "Sekte" als Kampfbegriff, FAZ
6.4.1994.
- Über jeden Grundgesetzartikel einzeln abstimmen;
Aktuelle Probleme der Verfassungsreform, FAZ 21.12.1993.
Krippendorf, Ekkehart, Das Ende des Parteienstaates? in: Der Monat, Heft 160, 1960, S.64.
Krockow, Christian Graf von, Die Entscheidung, Eine
Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, 1958,
2.unveränderte Aufl.1990.
Kroll, Peter, Vor dem Ende des klassischen Journalismus,
Criticón 1988,113
Krüger, H., Allgemeine Staatslehre, 1964, S.542 f.
Kunze, Klaus, Dem Machtmißbrauch wehren! Für eine
Demokratisierung der Volksparteien, in: DER REPUBLIKANER Nr.4 (April) 1989,
S.6.
- Der Staat als Parteienbeute, in: DER REPUBLIKANER
1.9.1989.
- Der totale Parteienstaat, in: Junge Freiheit Nr.2/1992.
- Die Legitimität der Diktatur, Der Putsch von Boris Jelzin
in Rußland, Junge Freiheit 10/1993, S.1.
- Die Teilung der Gewalten, Staatsbriefe 11/1993, S. 8.
- Die Verfassungsschutzprozesse und ihre politische
Funktion für den Parteienstaat, in: Deutsche Annalen, Jahrbuch des Nationalgeschehens,
1994, S.77-111.
- Plebiszite als Weg aus dem Parteienstaat, Junge Freiheit
Oktober 1992, S.23.
- Sozialgeschenke statt echter Volksherrschaft, In
Bonn will man von der verfassunggebenden Gewalt des Volkes nichts
wissen, in: Ostpreußenblatt 11.1.1992, S.3.
- Wege aus der Systemkrise, in: Opposition für Deutschland,
Hrg.Andreas Molau, 1995.
- Mut zur Freiheit - Ruf zur Ordnung, Der schmale Pfad
zwischen Fanatismus und Nihilismus, 1.Auflage Esslingen 1995 ISBN 3-924396-4;
2. neubearb. 2. Auflage Uslar 1998 ISBN 3-933334-02-2.
- Geheimsache Politprozesse, Systemwechsel durch
Uminterpretation: Verfassungsschutz und Gerichtsbarkeit nach dem linken
Marsch durch die Institutionen am Beispiel der Republikanerverfolgung, Uslar
1998, ISBN 3-933334-05-5.
Kutscha, Martin, und Anke Engelbert, Staatliche
Öffentlichkeitsarbeit und Demokratieprinzip, NJW 1993, 1233.
La Bruyère,
Caractères, suivis des caractères de Théophraste.
Lagarde, Paul de, Deutsche Schriften, 1884, zitiert nach
Sammlung Diederichs, Hrg. Friedrich Daab, 1914.
Leesen, Hans-Joachim von, Die Wahrheit über den Bombenkrieg,
Ostpreußenblatt 12.12.1992.
- Wie die Freie und Hansestadt Hamburg die Tötung ihrer
Einwohner im Luftskriegs-Holocaust rechtfertigt, Ostpreußenblatt 24.7.1993.
Leif, Thomas, Hoffnung auf Reformen? Reformstau und Partizipationsblockaden
in den Parteien, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 22.10.1993, S.24.
Levy, David,
David Hume, Criticón 1980,4.
Lorenz, Konrad, Der Abbau des Menschlichen, 1983.
- Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, 1973.
- Die Rückseite des Spiegels, 1973, Sonderausgabe 1975.
Luhmann, Niklas, Chirurg auf der Parkbank, FAZ 9.6.1994.
- Wie haben wir gewählt? FAZ 22.10.1994.
Machiavelli, Niccolò,
Discorsi, I.Buch, 11. Kapitel, Deutsche Gesamtausgabe, Hrg. Rudolf
Zorn, 2.Aufl.1977.
Madison, James, Die Federalist-Artikel, Hrg.Adams, UTB 1994.
Maistre, Joseph de, Betrachtungen über Frankreich, 1796,
Hrg.G.Maschke, 1991.
Martini, Winfried, Das Ende aller Sicherheit, Stuttgart
1954.
Maschke, Günter, Die Verschwörung der Flakhelfer, Criticón
1985,153.
Meier, Horst, Parteiverbote und demokratische Republik 1993.
Mende, Erich, Gedanken zu einer Parlamentsreform, in:
Herder-Initiative Bd.73, S.72.
Michels, Robert, Zur Soziologie des Parteiwesens in der
modernen Demokratie, 1911, 4.Aufl.Stuttgart 1989.
Mielke, Gerd, Plädyer für offene Parteistrukturen;
unveröffentlichtes Manuskript 1993, zit. nach Leif S.26 Fußnote 9.
Mitteis, Heinrich/Heinz Lieberich, Deutsche
Rechtsgeschichte, 15. Aufl.1978.
Mohler, Armin, Die konservative Revolution, 3.Aufl. 1989.
- Liberalenbeschimpfung, 1990.
Molau, Andreas, Alfred Rosenberg, Der Ideologe des Nationalsozialismus,
Eine politische Biografie, 1993.
Montesquieu, Charles-Louis de, Vom Geist der Gesetze, bei
Reclam 1965/1989.
Müller, Adam, Elemente der Staatskunst, 1808/1809.
Neumann, Heinzgeorg, Von der Parteiendemokratie zur
Soziokratie, in: Herder-Initiative Bd.73 (Hrg.Gerd-Klaus Kaltenbrunner) 1988,
S.168.
Nolte, Ernst, Die fortwirkende Verblendung, FAZ 22.2.1992.
- Die Fragilität des Triumphs, FAZ 3.7.1993
- Streitpunkte, 1993.
Oberlercher, Reinhold, Zur Erneuerung des deutschen
Parteiensystems, in: Herder-Initiative Bd.73, S.135.
Oelmann, Michael, Die Steuerung der Information, Bayerischer
Rundfunk nennt Republikaner nicht mehr rechtsradikal - CSU protestiert,
Junge Freiheit 6/1994 v. 4.2.1994, S.1.
Olson, Mancur, The Rise and the Decline of Nations, Yale
University 1982, deutsch: Aufstieg und Niedergang von Nationen, 2.Aufl.
Tübingen 1991.
Orwell, George, "1984", deutsche Ausgabe 1950,
13.Aufl. 1964.
Perelman, Chaïm, Über die Gerechtigkeit, 1945, deutsch
1967.
Platon, Politeia (Staat), Übersetzung von Schleiermacher,
Rowohlt 1958.
Posener, Paul, Einführung in die Rechtswissenschaft und
Rechtsgeschichte, 2.Aufl. 1909.
Preuß, Ulrich K., Die Wahl der Mitglieder des BVerfG als
verfassungsrechtliches und politisches Problem, in: ZRP 1988, 389.
- Plebiszite als Form der Bürgerbeteiligung, ZRP 1993, 131.
Proudhon Pierre
Joseph, Les confessions d'un révolutionnaire. Ed.Nouvelle, Paris 1868.
Pufendorf, Samuel
von, De jure Naturae et Gentium, 1672.
- De officio
hominis et civis juxta legem naturalem, 1673, Hrg.Maier/Stolleis, 1994.
Radbruch, Gustav, Gesamtausgabe (GRGA), Hrg.A.Kaufmann,
Bd.3, Heidelberg 1990.
Ranke, Leopold von, Neueste Geschichte, Sommersemester 1850,
zit. nach Carl Pertz in: Vorlesungseinleitungen, Hrg. Volker Dotterweich u.a.,
1975.
Rebenstorf, Hilke, Steuerung des politischen Nachwuchses
durch die Parteiführungen? in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur
Wochenzeitung Das Parlament,
14.8.1992, S.45.
Reißmüller, Johann Georg, Ein langlebiges Unrecht in
Belgien, Die blutige Repression der Nachkriegszeit, FAZ 10.5.1994.
Ridder, H., Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, 1975,
S.85 ff., 94 ff.
Rohrmoser, Günter, Gibt es eine Alternative zum Staat? in:
Burschenschaftliche Blätter 1984, 135.
Romieu, Auguste, Der Caesarismus, 1850, Hrg.Günter Maschke,
Wien 1993.
Rother, Werner, Die Art, mit Souveränen umzugehen, ZRP 1994,
173.
Rousseau, Jean-Jacques, Der Gesellschaftsvertrag, 1762, (Hrg. Weinstock), 1974.
Rüthers, Bernd, Ein Grundrecht auf Wohnung durch die
Hintertür? Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1993, 2587 ff.
- Ideologie und Recht im Systemwechsel, 1992.
Sander, Hans Dietrich, Die Auflösung aller Dinge, 1988.
- In der Zwickmühle der Restauration, Criticón 1976, 213.
- Vortrag auf dem 3. Marburger Diskurs, 20./22.11.1987,
in: Staatsbriefe 3/1992, S.27.
Schacht, Konrad, Wahlentscheidung im Dienstleistungszentrum.
Analysen zur Frankfurter Kommunalwahl vom 22.März 1981, Opladen 1986.
Schelsky, Helmut, Die Strategie der Systemüberwindung, FAZ
10.12.1971.
- Mehr Demokratie oder mehr Freiheit? FAZ 20.1.1973.
Scheuch, Erwin K. und Ute Scheuch, Angriff auf den Klüngel
am Rhein, Rheinischer Merkur vom 13.2.1992.
- Cliquen, Klüngel und Karrieren, Hamburg 1992 (zit.:
"Cliquen...").
- Parteien und Politiker in der Bundesrepublik (alt)
heute, Hrg.Wirtschaftsvereinigung der CDU in NRW, Düsseldorf 1991 (zit.:
"Studie").
Schiedermair, Hartmut, Hände weg vom Grundgesetz! in: Die
politische Meinung, Hrg. Bernhard Vogel, 37.Jahrgang April 1992, S.17.
Schlierer, Rolf, Für eine rechtsdemokratische Partei, Junge
Freiheit Nr. 24/1994 vom 10.6.1994, S.11.
Schmidt-Hieber, Werner und Ekkehard Kiesswetter, Parteigeist
und politischer Geist in der Justiz, NJW 1992, 1790.
Schmitt Glaeser, Walter, in: Mahrenholz u.a., Stern, 40
Jahre Grundgesetz, 1990.
Schmitt, Carl, Die Diktatur, 2.=5.Aufl. 1928/1989
- Der Begriff des Politischen, 1932.
- Die
geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 1923,
7.Aufl.1926/1991.
- Verfassungslehre, 1928, 8.Aufl.1993.
- Der Hüter der Verfassung, Tübingen 1931.
- Legalität und Legitimität, 1932, 4.Aufl. 1988.
- Politische Theologie, 1934, 4.Aufl.1985.
- Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, 1938/
1982.
- Staat, Großraum, Nomos,
Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Hrg. Günter Maschke, Berlin 1995.
Schmoeckel, Reinhard. Die Hirten, die die Welt veränderten,
1985.
Schönberger, Christoph, Der Staat, Bd.33, 1994, Heft 1,
S.124.
Schreckenberger, Waldemar, Ein Staats- und Gesellschaftsbild
aus Karlsruhe, FAZ 3.3.1995.
- Sind wir auf dem Weg zu einem Parteienstaat? FAZ 5.5.1992.
Schrenck-Notzing, Caspar von, Abschied vom
Dreiparteiensystem, in: Herder-Initiative Bd.73 (Hrg.Gerd-Klaus
Kaltenbrunner) 1988, S.121.
- Abschied vom Parteienstaat, 1988.
Schröer, Friedrich, Deutsche Volkszugehörigkeit von
Minderjährigen, Bayerische Verwaltungsblätter 1973, 148.
Schulz, Til, Der liebe Ultra: Günter Maschke, in: Die neue
Gesellschaft - Frankfurter Hefte, Heft 8/1991, S.730.
Schweisfurth, Theodor, Der Staat soll in Zukunft für den
Menschen da sein, Die russischen Wähler stimmen über eine Verfassung präsidialdemokratischen
Zuschnitts ab, FAZ 9.12.1993.
Seiters, Rudolf, Mehr innere Sicherheit, in: Die politische
Meinung Nr.285, August 1993, S.27.
Stein, Erwin, Staatsrecht, 12.Aufl.1990.
- Verfassungsgerichtliche Interpretation der Grundrechte als
Konkretisierung des Rechtsstaates, in: Herder-Initiative Bd.33, Hrg.Gerd
Klaus Kaltenbrunner, 1979, S.83.
Stelzmann, Arnold, Illustrierte Geschichte der Stadt
Köln, 7.Aufl.1976
Stolz, Werner, Die persönlichen Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten
- ein neues Feld verdeckter Parteienfinanzierung? ZRP 1992,372.
Stubbe-da Luz, Helmut, Parteiendiktatur - Die Lüge von der
innerparteilichen Demokratie, 1994.
Sunic, Tomislav, Videopolitik, Die neue Dimension des
Politischen, Criticón 1993,292.
Thoma, Richard, Rechtsgutachten betreffend die Stellung des
BVerfG, in: Peter Häberle (Hrg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, 1976.
Vandergucht, Jeef, Nihilismus - Normenerhöhung - Nullpunkt,
Ernst von Salomon und seine Zeit, in: Die Achte Etappe, Hrg.Heinrich-Theodor
Homann, April 1992, S.57 f.
Venohr, Wolfgang, Der Öko-Staat kommt bestimmt, in: Junge
Freiheit 5/1993, S.23.
Vernuls, Nicolas
de, De una et diversa religione, 1646.
Vierhaus, Hans Peter, Die Identifizierung von Staat und
Parteien - eine moderne Form der Parteidiktatur? ZRP 1991, S.468.
Vitzthum, Wolfgang Graf von, Demokratie, Parteien und Parteiendemokratie,
FAZ 21.11.1994.
Weißmann, Karlheinz, Edgar J. Jung, Criticón 1987,245.
Weizsäcker, Richard von, Im Gespräch, mit Gunter Hofmann und
Werner A.Perger, Frankfurt 1992.
- Wird unsere Parteiendemokratie überleben? 1983.
Wiesendahl, Elmar, Volksparteien im Abstieg, Nachruf auf
eine zwiespältige Erfolgsgeschichte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
14.8.1992, S.3.
Wild, Dieter, Doch wie Weimar? DER SPIEGEL Nr.51/1993 vom
20.12.1993, S.38.
Willms, Bernard, Thomas Hobbes - Das Reich des Leviathan,
München 1987.
Wolff, Hans Julius, Organschaft und juristische Person,
Bd.II, Theorie der Vertretung, 1934.
- und Otto Bachof, Verwaltungsrecht Bd.II, 4.Auflage 1976.
Yser, Cornelia, CDU-MdB, Stolz auf das Grundgesetz, in: Die
politische Meinung Nr.270, Mai 1992, S.61.
Ziemske, Burckhardt, Ein Plädoyer für das
Mehrheitswahlrecht, ZRP 1993, 369.
Zitscher, Wolfram, Ämterpatronage - Krise der
Rechtspflege, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1991, S.100
Über
den Autor
Geb.1953 in
Bahrendorf bei Magdeburg, verheiratet, 6 Kinder 1979-1996
1972 Abitur
am altsprachlichen Hölderlin-Gymnasium in Köln
1972-1975 Polizeibeamter
in NRW, zuletzt Hauptwachtmeister Polizeipräsidium Köln
1974 Sommersemester
Immatrikulation Universität Köln, Jura
1974 Wintersemester,
aktiv bei der Kölner Burschenschaft Germania,
1976 Stipendiat
der Konrad-Adenauer-Stiftung
1976/77 Mitglied
des Hochschulpolitischen Ausschusses der Deutschen Burschenschaft
1977 Mitgründer
des Ring Freiheitlicher Studenten in
Köln
1979 1.
juristische Staatsprüfung, Köln
1981 2.
juristische Staatsprüfung, Köln; Zulassung als Rechtsanwalt in Göttingen
1984- Rechtsanwalt
in Uslar
1970-71 Herausgeber
eines Science-Fiction-Fanmagazins
1977-79 Korrespondent
der Zeitung student in Köln
seit 1978 diverse
Beiträge in genealogischen und heimatkundlichen Fachzeitschriften
seit 1989 diverse
Beiträge für politische Zeitschriften
|
|
 |