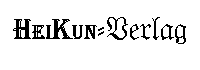Jedweder, der diese Stimme
vernimmt,
fasse diesen Entschluß bei sich
selbst und für sich selbst,
gleich als ob er allein dasei
und alles allein tun müsse.
Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814)
Die
konkrete Ordnung, nach der wir fragen, ist eine menschliche Werteordnung.
Das muß keine Über- oder Unterordnung von Werten sein. Intellektualistisch
und idealistisch inspirierte Philosophie hatte sich seit Platon
verzweifelt abgemüht, so etwas wie ein ideales Gedankensystem
abstrakter Werte zu errichten. Dieses Unterfangen ist vergeblich
und sinnlos. In jedem Menschen sind verschiedene, einander widersprechende
Gefühle und Werte der Möglichkeit nach angelegt. Darum kann
jede rationalistische An-Ordnung, Überordnung oder Unterordnung
abstrakter Werte nur zu einer Verkürzung menschlichen Potentials
führen.
"Das
Ideal liegt in demjenigen Menschen, der das heute ist, was er heute
sein soll. Der auf der Höhe seiner Aufgabe stehende Mensch ist der
Erbe, der Inbegriff, die reife Frucht alles dessen, was vor ihm
war, und darum der Ahne, die Wurzel der Zukunft, und darum, weil
er Erbe und Ahne zu gleicher Zeit ist, ist er ein Ideal. Abstrakte
Ideale gibt es nicht."
[2]
Nicht der
Mensch an sich ist das Maß aller Dinge, sondern jeder einzelne
kann sich für das Seine frei entscheiden. Was dezisionistische Philosophie
vom idealen Sollen schon immer wußte, bestätigt uns der Konstanzer
Biologe Markl
für das reale Sein: Wir werden "allesamt ungleich geboren, was
immer uns die politisch korrekte Unkorrektheit darüber anderes sagen
will. Die wirklich fundamentale genetische Botschaft ist jedoch,
daß es für die Spezies Mensch wie für jede andere Spezies keine genetisch
definierbare Norm oder keinen Idealtyp gibt."
[3]
Es
kann darum nicht Aufgabe der Philosophie sein, auf Grundlage eines
starren Systems eine ideale Staats- oder Gesellschaftsverfassung
zu entwerfen. Lediglich ethische Hilfestellungen mag die Philosophie
geben, Werte anbieten und die Bedingungen ihrer konkreten Verwendbarkeit
erfragen. So wird ein Optimum an praktischem Nutzen aus der Philosophie
ziehen, wer das Wechselspiel zwischen emanzipatorischen Denkweisen
und der Rekonstruktion einer neuen, eigenen Ordnung erkennt. Was
zur Befreiung von einer Herrschaft und zur Zerstörung ihrer Werte
unentbehrlich ist, erkannte Comte, taugt nicht gleichzeitig für
die Errichtung einer neuen sozialen Ordnung. Man gibt die alten
Prinzipien letztlich nur auf, um neue zu bilden.
[4]
Vorsicht
ist dabei umso ratsamer, je umfassender eine bekämpfte Herrschaft
die Gesellschaft regiert. Descartes
riet einmal einem Freund: "Ich möchte auf alle Fälle, daß Du
Deine neuartigen Gedanken nicht offen vorträgst, sondern Dich
äußerlich an die alten Prinzipien hältst. Du sollst Dich damit
begnügen, zu den alten neue Argumente hinzuzufügen. Dies kann
Dir niemand übelnehmen; und diejenigen, die Deine Argumente
verstehen, werden von sich aus darauf schließen können, was Du
ihnen klarmachen wolltest." Daß sein Leser verstehend mitdenkt
und zu Ende denkt, muß ein Schreibender vor allem unter totalitären
Herrschaften hoffen. Spätere Generationen erkennen die
geistige Handschrift solcher Zeiten daran, daß zwischen Zeilen
mehr steht als in ihnen. Wer sich gezwungenermaßen der Sprache
des Gegners bedienen muß, läuft allerdings Gefahr, dessen "Denkinhalte
wenigstens zum unumgänglichen Bezugspunkt eines auf soziale
Wirksamkeit gerichteten Denkens" zu machen und sich so die
Bedingungen des Gesprächs diktieren zu lassen.
[5]
Jenseits
von Transzendenz und Metaphysik fehlt es noch an einer allgemein
verständlichen Begriffssprache. Wenn wir die Urfrage jeder Morallehre
beantworten müssen, wie sich der Mensch verhalten solle, besteht darum die Gefahr des Mißverständnisses. Morallehren
pflegen deren Inhalt durch einen einfachen Trick zu erzeugen: Sie
gehen stillschweigend vom erwünschten Wert aus. Um diesen basteln
sie das passende Weltbild eines Seins, aus dem das gewünschte Sollen
abgeleitet werden kann. Dieses fiktive Sein ist, je nach Zeitgeschmack,
Gott oder die Natur. Jedenfalls aber muß das gewünschte Sollen dem
Wesen des Gott ebenbildlichen
Menschen oder der menschlichen
Natur entsprechen. Sie projizieren also in das Wesen Gottes oder
der Natur des Menschen jeweils, was zur gewünschten Moral führt. Erst
machen sie das Sollen zum Sein, um aus diesem Sein das gebotene
Sollen wieder abzuleiten. Diesen logischen Fehler können wir nur
vermeiden, wenn wir darauf verzichten, die von uns angenommene
Natur des Menschen zur Sollensregel zu machen. Das können nur konsequent
angewandter Nominalismus und Dezisionismus leisten.
Wenn
wir so etwas wie eine Moral nicht aus einer metaphysischen Natur des
Menschen ableiten können und jedes kategorische Sollen mit Schopenhauer
als theologisch ablehnen, bleibt nur der Rückgriff auf die empirische
Natur des Menschen: nämlich die rein deskriptive Frage, wie Moral
sich bildet, was ihr Inhalt ist und auf welchen menschlichen Eigenheiten
sie beruht. Jeder mag sich dann für oder gegen sie entscheiden. Schopenhauer
fährt über die empirisch festgestellten moralischen Handlungen fort:
"Diese sind sodann als ein gegebenes Phänomen zu betrachten,
welches wir richtig zu erklären, d.h. auf seine wahren Gründe zurückzuführen,
mithin die jedenfalls eigentümliche Triebfeder nachzuweisen haben,
welche den Menschen zu Handlungen dieser von jeder andern spezifisch
verschiedenen Art bewegt. Diese Triebfeder, nebst der Empfänglichkeit
für sie, wird der letzte Grund der Moralität und die Kenntnis derselben
das Fundament der Moral sein."
[6]
Diese
Triebfedern sind der Freiheitsdrang des Menschen und seine Gemeinschaftsbezogenheit,
oder mit den Worten Schopenhauers
: sein Egoismus und seine Menschenliebe. Wir nehmen diese Eigenschaften
als Fakten zur Kenntnis, ohne den Anspruch zu erheben, alle Menschen sollten freiheitsliebend
und sollten gemeinschaftsliebend sein.
Wir stellen nur lapidar fest: Diese Gefühle sind vorhandene,
aber widersprüchliche Grundmöglichkeiten menschlichen
Seins. Wenn wir sie für uns für nützlich halten, nennen wir sie unsere
Tugenden. Als ein Sollen empfehlen wir sie nur in aller diesseitigen
Bescheidenheit, und nur unseren Freunden. Sie sind somit keine metaphysischen
Werte im Sinne überkommener Moral, sondern sozial erwünschte Verhaltensweisen.
Es
kommt auf unsere Entscheidung an: Wer die menschliche Gemeinschaft
willentlich akzeptiert, in die er unwillentlich hineingeboren
wurde, wird bestimmte Tugenden als Pflichten gegenüber dieser sozialen
Gemeinschaft für notwendig anerkennen müssen. "Daran hat
er ein egoistisches Interesse", meldet sich unser Nützlichkeitssinn.
Wir müssen darum ein "System von öffentlichen und privaten
Gewohnheiten einzurichten" suchen, die "geeignet sind,
das Gefühl für die soziale Gemeinschaft zu entwickeln."
Solche Konventionen wollen aber keine Offenbarungen sein, sondern
bleiben sich ihrer Relativität stets bewußt.
[7]
Comte meinte mit derartigen Systemen
konventioneller Gewohnheiten die traditionell überlieferten,
konkreten gesellschaftlichen Ordnungen in ihrer historischen
Mannigfaltigkeit. Diese beruhen auf sozialen Institutionen wie
der Familie, die für ihren Bestand wieder Wertsetzungen und die
allgemeine Anerkennung ihres Wertes als Norm erfordern. Kraft
Entscheidung werden die Institution und ihr immanenter Wert
zum Normalfall erklärt. Solches nominalistische Denken in konkreten, nicht universalierten Ordnungen
[8]
ist also bei näherer Betrachtung
ein dezisionistisches mit nur sekundärer normativer Komponente.
Die
beiden Grundmöglichkeiten, wie wir uns Mitmenschen gegenüber in
angeborener Weise verhalten können, sind das sogenannte freundlich-affiliative
und das aggressiv-agonale Verhalten.
[9]
Wie die Stachelschweine in Schopenhauers
lustigem Bilde mögen unsere Ahnen frierend in einer Höhle gesessen
und sich aneinandergekuschelt haben, bis sie sich auf die Nerven
gingen und Abstand hielten - der Stacheln wegen. Distanz oder Annäherung:
zwischen diesen beiden Polen spielt sich soziales Verhalten ab.
Das
Agonale, Widerstreitende schafft einzelgängerische Distanz und strebt
nach - im Ernstfall auch gewaltsamer - Dominanz.
Das
affiliative, also das liebevolle, "mitmenschliche" Verhalten
dagegen hat seine stammesgeschichtlichen Wurzeln im Brutpflegetrieb.
Sein sozialer Ort ist die Familie, und darum ist sein spezifisches
Ethos das familiäre. Hier liegt die Wurzel aller Bereitschaft zur
Selbstaufopferung für einen "Nächsten". Die Familienbindung
erfordert den Verzicht auf individuelle Freiheit. Es setzt weitgehende
materielle Gleichheit voraus: Niemand am Tisch darf hungrig bleiben.
Mindestens innerhalb der engen Familienbindung sind wir Menschen
"von Natur aus auch freundliche, gesellige Wesen."
Der Mensch entwickelt im vertrauten Kleinverband jene Werthaltungen,
die es ihm "schließlich erlauben, selbst in ihm fremden
Personen Brüder und Schwestern zu sehen. Letztlich basiert
das Staatsethos auf einer Erweiterung des biologisch begründeten
Familien- und Sippenethos.
...
Die Fähigkeit zum engagierten Einsatz für die größere Gruppe
setzt die Fähigkeit zu Liebe und Vertrauen voraus, und beide
sind familiares Erbe. Verkümmert diese Basis, dann läßt sich
auch kein Sinn für die größere Gemeinschaft entwickeln."
[10]
Die ideellen Grundlagen des demokratischen
Gedankens und der Gleichheitsforderung bauten sich um die wirkliche
Urzelle menschlicher Gemeinschaftsbildung auf: Wie in einer einzigen,
großen Familie sollen alle gleich satt und glücklich sein.
Beide
Geschlechter, Männer und Frauen, verhalten sich je nach Situation
entweder agonal oder affiliativ. Vorwiegend jedoch begegnet der Mann
der Welt agonal, nämlich - mit den Worten der Linguistin
Tannen - wie einem "Wettkampf, bei dem es um die Bewahrung von
Unabhängigkeit und die Vermeidung von Niederlagen geht."
[11]
In einer solchen Welt sind Gespräche "Verhandlungen, bei denen
man die Oberhand gewinnen und behalten will und sich gegen andere
verteidigt, die einen herabsetzen und herumschubsen wollen."
- Frauen dagegen nähern sich der Welt "als Individuum in einem
Netzwerk zwischenmenschlicher Beziehungen", in der "Gespräche
Verhandlungen über Nähe" sind, "bei denen man Bestätigung
und Unterstützung geben und erhalten möchte und Übereinstimmung
erzielen will. Man will sich davor schützen, von anderen weggestoßen
zu werden. So gesehen ist das Leben eine Gemeinschaft, ein Kampf um
die Bewahrung der Intimität und die Vermeidung von Isolation."
Die typisch weibliche Sehnsucht nach Nähe, Intimität und Gemeinschaft
bietet vorwiegend familiäre, affiliative Strategien auf; die männliche
Auffassung von Sieg und Dominanz faßt die Welt als Leistungshierarchie
auf und begegnet jedem Konkurrenten agonal.
Um
die beiden menschlichen Grundmöglichkeiten: die agonale und die affiliative,
ranken sich alle politischen Theorien. Die üblich gewordene Gleichsetzung
der Phänomene Demokratie und
Liberalismus versperrt
die Sicht darauf, daß sie antagonistischen Grundgedanken entspringen.
Es besteht ein in der Tiefe unüberwindlicher Gegensatz
[12]
zwischen liberalem Einzelmensch-Bewußtsein
und demokratischem Gedankengut. Gedanklich sauber herauspräpariert
läßt der Gegensatz sich folgerichtig ableiten aus den beiden Grundmöglichkeiten
sozialer Distanz oder Annäherung: Das agonale
Handlungsmuster sieht den Menschen in Auseinandersetzung
gegen andere. Seine Liebe ist Eigenliebe. Es setzt den konkreten einzelnen
absolut und mißt ihm potentiell unendlichen Persönlichkeitswert
zu. Es erlaubt dem Individuum, sich gegen andere durchzusetzen.
Ob diese anderen eine Mehrheit bilden, spielt keine Rolle. Es hält
darum Abstand vom anderen und betrachtet ihn als potentiellen Gegner.
Wer diese innere Haltung einnimmt, gelangt zum Egoismus, Anarchismus
oder - wenn Besitzende so denken - zum Liberalismus. Seine
Idealvorstellung ist die individualistische Distanz zu den als
ungeliebte Masse empfundenen Mitmenschen. Er sucht daher vornehmlich
die persönliche Freiheit. Diese findet er zum Beispiel im liberalen
Rechtsstaat. Dieser darf nur noch privaten Bedürfnissen einer absoluten
Gesellschaft dienen.
Es
kann aber nicht alles menschliche Handeln auf persönliches Interesse
zurückgeführt werden. Es gibt auch uninteressierte, rein wohlwollende
Neigungen:
[13]
Das affiliative
Handlungsmuster sieht den Menschen in friedlichem Miteinander
mit anderen. Seine Liebe ist Nächstenliebe. Es setzt das Miteinander
absolut und mißt der Gemeinschaft potentiell unendlichen Wert bei.
Es fordert vom Individuum, sich mit anderen freundlich zu arrangieren.
Im Zweifel hat es sich in die Anschauungen und Belange der Mehrheit
einzufügen. Es läßt die Menschen sich annähern und betrachtet sie
als potentielle Familienangehörige. Wer diese innere Haltung
einnimmt, gelangt gefühlsmäßig zur Vaterlandsliebe oder gar zur
allumfassenden Menschheitsliebe; politisch zur Demokratie. Sein
Ideal bildet das völlige Aufgehen des Individuums im Kollektiv
geliebter Mitmenschen und deren umfassende Übereinstimmung.
Er sucht daher vornehmlich die Gleichheit im Kollektiv. Diese
findet er in demokratischen, sozialistischen und organischen
Staatsideen. Sie kulminieren im absoluten Staat, der rudimentäre
Reste gesellschaftlichen Lebens nur noch als dienende Rädchen im
Getriebe duldet. -
Will
man agonale Distanz und zugleich familiäre Nähe zu Prinzipien innerhalb
einer Gruppe machen, widersprechen sie einander. Dagegen können
sich diese Grundgefühle im Widerstreit verschiedener Gruppen mächtig
verbinden. Es wird dann die Aggression nach außen gewandt und
die liebevolle Verbundenheit nach innen. "Kampf ist der Moment,"
gibt offenherzig ein Anarchist zu, "in dem der einzelne Mensch
zum ersten Mal das Gefühl der gemeinsamen Stärke spürt."
[14]
Die antiken Griechen ließen im Heer
bevorzugt nahe Verwandte Seite an Seite kämpfen. So schaukelten
sich die familiäre Bereitschaft zur eigenen Aufopferung und das
agonale Potential zu einem Rauschgefühl von Verbundenheit und Macht
hoch. Innerhalb ein- und derselben Gruppe wird eine auf Menschen
und ihre Bedürfnisse zugeschnittene Gesellschaftsordnung beide
Grundmöglichkeiten - Distanz und Zuwendung - ermöglichen müssen.
Ihnen entsprechen als Fundamentalwerte einer freiheitlichen und
sozialbezogenen Ordnung die Geistesfreiheit und als ihr gedanklicher
Gegenpol die Gemeinschaftsliebe. Sie müssen im Gleichgewicht
gehalten werden. Wenn wir sie nicht durch eine dritte, bewußte Wertsetzung
miteinander verbinden, werden sie sich nie vertragen. Wegen der
zwischen den Kardinaltugenden bestehenden natürlichen Spannung
bedürfen sie als dritter Kardinaltugend dessen, was die Römer virtus und ihre Nachkommen virtù nennen: Es ist das spezifisch auf
die Mitwirkung am Staatswesen gerichtete republikanische Ethos.
Wenn wir unter unserem Guten den Inbegriff der für den Menschen als soziales Wesen erforderlichen
Tugenden verstehen und unter unserem Bösen deren Gegenteil, dann ist das Böse die Verneinung der Willensfreiheit
schlechthin, der Gemeinschaftsliebe schlechthin und die Verweigerung
der tätigen Verantwortlichkeit für das Gemeinwesen. Inbegriff
des Guten ist hingegen eine Haltung, die sich frei für den Bestand
des Volkes entscheidet und eine politische Ordnung mitgestaltet,
welche sich an die Freiheit des einzelnen rückbindet.
Die
Idee einer Verbindung für Kardinaltugenden gehaltener empirisch vorgefundener
"Werte" ist keineswegs neu. Schon Comte
unterschied eine individuelle Moral von der häuslichen und der sozialen
und brachte die erste mit der Erhaltung des einzelnen in Verbindung.
Die zweite, in der Familie verwurzelte, strebe nach einem "Übergewicht
des Mitgefühls über den Egoismus". Die letzte habe immer die
Gesamtheit im Auge, "so daß sich alle Kraft unserer Natur nach
deren Gesetzen für das gemeinsame Ziel vereinen läßt."
[15]
Der individualistische Antrieb
strebt zur völligen Freiheit und zur Macht. Die Familienliebe
erweitert sich auf Liebe zum eigenen Volk; sie ist aber wie jede
Liebe blind. Erst die staatsbildende bürgerliche Tugend führt
zur Idee der Gemeinsamkeit von Werk und Verantwortung. Diese antagonistischen
Werte können nur von Fall zu Fall gegeneinander abgewogen und
zweckgerichtet verwendet werden. Eibl-Eibesfeldt
ordnet die Tugenden nach ihrer Funktion in die agonalen, die affiliativen
und "schließlich die zivilisierenden Tugenden der Selbstbeherrschung
und Mäßigung."
[16]
Als drittes sittliches Gut schlechthin
neben der Freiheit des einzelnen und der überindividuellen
Gemeinschaft sah auch Radbruch
"die Gemeinschaft kultureller Wertschöpfung" an, die
er sich "in Form einer Bauhütte" vorstellte, "in
der die Bauleute nicht unmittelbar von Mensch zu Mensch, sondern
mittelbar durch ihr gemeinsames Werk verbunden sind."
[17]
Ein solches Werk, eine immerwährende
Aufgabe zur tätigen Verbindung von Menschen ist auch das politisch
verfaßte Staatswesen. Wer an seiner Freiheit hängt, wird sich
weder für die liberale Verabsolutierung des Individuums,
noch für eine kollektivistische Verabsolutierung entscheiden.
Er wird vielmehr diese Werte in ihrem Zusammenwirken den Inhalt
des Rechts gestalten lassen.
[18]
Dieses sichert die auf das Gemeinwesen
gerichtete republikanische Tugend. Sie verbindet die Menschen
und ihren Eigensinn als Bürger in ihrem gemeinsamen Werk: dem
freiheitlichen Staate.