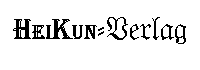Entia non sunt multiplicanda
praeter necessitatem.
Wilhelm von Ockham (1285-1349)
Wer
für Ordnung eintritt, kann nur zwei philosophische und damit
staatspolitische Richtungen einschlagen: Er kann sich den
Normendienern anschließen oder den Normenbenutzern. Die
ersten: die
Normativisten, glauben
an die Einordnung des Menschen in einen von einer
metaphysischen Ordnung erfüllten Kosmos. Sie wähnen ihn
und damit auch sich selbst einer objektiven, aus sich selbst
heraus geltenden Seinsordnung unterworfen: Gottes
Schöpfungsordnung oder der ewigen Wiederkehr des Gleichen
oder dem dialektisch-materialistischen Gesetz der Geschichte;
der Vernunftnatur des Menschen oder dem Gesetz des Stärkeren;
der Gleichheit aller, die Menschenantlitz tragen oder der Höher-
und Minderwertigkeit von Rassen; der westlichen Wertegemeinschaft
und unzählige andere mehr. Die einen verweisen für den Ursprung
einer angeblichen metaphysischen Seinsordnung auf ein
transzendentes Jenseits. Andere vermuten eine im "wahrhaften
Wesensgrund" des Diesseits enthaltene: eine
immanente Ordnung. Deren Einzelwerte sind ihre Ideale:
Ihnen dienen sie wie etwas Heiligem. Als lästige Quälgeister
verlangen sie allen anderen Menschen ab, denselben Göttern
zu opfern. Ihr penetranter
Idealismus will alle Menschen nach seiner Façon selig machen.
Der
Dezisionist ist dagegen
Realist: Er dient keinen Idealen. Die für ihn geltenden moralischen
Normen schafft er sich selbst "voluntaristisch":
also kraft seines Willens. Er hält sie sich unterworfen und
benutzt sie. Ordnung findet er nützlich, glaubt aber nicht
an ein allem Sein innewohnendes, darum universal verbindliches
Sollen. Jede gesellschaftliche Werteordnung bedarf einer
Person, die sie stiftet. Der Dezisionist hört auf keine Gebote
aus einem Jenseits und fühlt sich keiner "Natur seines
Seins" unterworfen. Keine soziale Ordnung stellt sich
von selbst ein. Er muß Ordnung daher stets neu durch eine bewußte
Willensentscheidung selbst schaffen und erhalten.
-
Beide
setzen sie dem Chaos die Ordnung entgegen: der Normativist
eine - seinem Glauben nach - in den Dingen selbst liegende
Ordnung und der Dezisionist eine Ordnung, die jemand
willkürlich geschaffen hat. Der Vorwurf des Normendieners
gegen den Dezisionisten lautet darum, blind zu sein vor
einer wahren göttlichen oder natürlichen Ordnung und
willkürlich seine eigene zu erfinden. Das kontert der Dezisionist
mit dem Gegenvorwurf: So viele Normativisten es gibt,
so viele angeblich objektive, einander aber widersprechende
ewige Seinsordnungen gebe es. Deshalb müsse sich jeder entscheiden,
auch der Normenbenutzer: Gibt es überhaupt metaphysische
Wahrheiten; und wenn ja: Welche der vielen Offenbarungen
von "Wahrheit" ist für mich die "wahre Wahrheit"
und welche Irrtum oder Lüge?
Der
Gedankenkosmos des Normativisten ist die Metaphysik: das "Wesen
der Dinge", angebliche "Dinge hinter den Dingen"
oder das wahre, ewige "Sein an sich". Theologen
der mittelalterlichen Scholastik meinten, gesicherte Aussagen
über die göttliche Ordnung machen zu können. Neuzeitliche Denker
brachten ihre Glaubensgewißheiten ins Wanken. Spätestens mit
den Religionskriegen relativierten widerstreitende Theologen
ihre Ansprüche auf letzte Weltdeutungen wechselseitig.
Auch
in der beginnenden Aufklärung mühte sich die abstrakte
Vernunft vergeblich ab, aus der menschlichen Natur moralische
Gewißheiten zu gewinnen: Damals löste das Naturrecht die
Theologie ab und wurde zur herrschenden normativen
Lehre. Es kann sich alles Naturrecht nur mit einem Zirkelschluß
halten, indem es aus einem angeblich "natürlichen"
Sein ein normatives Sollen folgert. "Die Natur"
läßt sich aber weder für noch gegen normative Prinzipien ausspielen.
Wenn etwa die Soziobiologie sie beobachtet, vermag sie zwar
festzustellen, welche kausal wirkenden genetischen Programme
die Tiere und uns Menschen beherrschen. Welche Prinzipien und
Normen das menschliche Zusammenleben aber regeln sollen, kann uns die Beobachtung unseres
stammengeschichtlich gewordenen Seins niemals lehren. Nur ein falsch verstandener normativierender
Biologismus fällt auf den naturalistischen Fehlschluß herein,
man könne vom Istzustand der menschlichen Natur auf ein Sollen
unserer Ethik schließen.
[1]
Gegen
die ideologiekritischen Argumente der Dezisionisten können
Normativisten keinen zwingenden Beweis führen. Trotzdem
soll die normative Ordnung auf Biegen und Brechen gerettet
werden mit einer grandiosen Glaubensakrobatik: Moralische
Gebote dürften keinesfalls ins Belieben des einzelnen gestellt
werden. Sie seien auch - um Himmels willen! - nicht von Menschen
erfunden oder gemacht: "Hiergegen spricht in erster
Linie, daß sie Deutungsversuche des transzendenten Sollens
sind, daß also das Sollen es ist, das den Menschen zum Sinnentwurf
seines Daseins in Anspruch nimmt, so daß er sich ihm gar nicht
entziehen kann." Damit wird klar: Das Sollen selbst ist
es, das uns "im Gewissen verpflichtet."
[2]
Für den Normativisten existiert
das Sollen, weil es existieren soll; so einfach denkt er: nicht
logisch, sondern theologisch. Unerträglich ist ihm die Vorstellung,
hinter allen geistigen Schöpfungen könnte sich nichts verbergen
als ein menschlicher Schöpfer. Weil moralische Ideen nicht
bloße "Manifestationen des Willens zur Macht"
sein dürfen, schließt er messerscharf, daß sie es nicht sein
können.
Den
Dezisionisten beeindruckt eine Metaphysik nicht, die ihre Gewißheiten
immer nur aus dem Hut zaubern kann wie einen deus ex machina. Für ihn sind Seinsordnungen
bloße Hirngespinste. Er lehnt es ab, seine intimsten Wünsche
und Hoffnungen in die Wundertüte der Metaphysik zu stecken
und als Glaubenswahrheiten wieder hervorzuzaubern. Wenn
es überhaupt eine metaphysische Ordnung gebe, sei diese jedenfalls
für Menschen nicht erkennbar und beweisbar, eben weil sie
transzendent wäre. Wie eine fata
morgana flimmert sie beständig am Horizont des Denkens.
Wenn wir uns ihr aber nähern und zupacken wollen, verflüchtigt
sie sich. Sollte sie überhaupt eine Realität außerhalb unserer
Köpfe sein, dann ist sie jedenfalls deshalb für uns praktisch
bedeutungslos. Seit der griechischen Antike halten Philosophen
die Vernunft oder aber den Willen für "das Wesen des Menschen".
Dem einen Glauben entspricht die Idee einer vernünftigen Seinsordnung,
dem anderen die eines nur durch Ordnungswillen zu zähmenden
Chaos. Die einen fühlen sich vom Vernunftideal abhängig,
die anderen ordnen sich ihrer selbstgeschaffenen Ordnung
über.
Der
Normenbenutzer gelangt zu ganz verschiedenen Konsequenzen,
je nach dem, ob er die Existenz einer normativen Ordnung überhaupt
bestreitet oder sie bloß für nicht erkennbar oder nicht nachweisbar
hält. Dezisionisten sehen den vorgefundenen Kosmos als Chaos.
Eine jeden eigenständigen Sinnzusammenhanges und
jeder geistigen Ordnung verlustige Welt, völlig angewiesen
auf menschliche Bedeutungsstiftung, muß nicht nur ohne
von Menschen gesetzte Ordnung in unseren Augen zu einem
formlosen Chaos auseinanderfallen: Sie ist dieses Chaos.
[3]
Es gibt keine ethische Norm,
die auf ein solches Chaos anwendbar wäre.
[4]
Darum muß die Norm gegen das
Chaos immer wieder neu geschaffen und durchgesetzt werden
durch die Kraft des bewußten Willens. Der Dezisionist kann
gegen das Chaos seinen Willen zum Formen und Gestalten setzen.
Er ist der bewußte Erzeuger und Stifter des für ihn geltenden
Lebenssinnes. Den Seufzer der Normativisten: wenn Transzendenz
bloßer Schein wäre, könne der Mensch nicht sinnvoll verstanden
werden,
[5]
weist er als unsinnige Tautologie
zurück: Seinem eigenen Leben gibt er nämlich selbst seinen
subjektiven Sinn. -
Zum
Leidwesen der Normendiener bieten sich viele ganz unterschiedliche
Götter und Gebotsnormen zur Auswahl an. Viele verschiedene Normativismen
nehmen für sich in Anspruch, allein wahr zu sein und selig zu
machen. Selbst ein konsequenter Normativist müßte dem Dezisionisten
darum ehrlicherweise zugeben, daß man auch den Glauben an
eine bestimmte normative Ordnung zunächst annehmen, sich
also für ihn entscheiden muß. Solche Ehrlichkeit würde ihn
aber in die logische Sackgasse eines Paradoxons führen:
Man kann seine heiligsten Güter nicht der Entscheidungswillkür
anheimfallen lassen und gleichzeitig Normativist bleiben.
Die typische Geste des Normendieners ist darum das Bestreiten,
daß da überhaupt etwas zu entscheiden ist. Es gebe nur eine
Wahrheit, darum auch nur ein höchstes Gut und die aus ihm
folgenden Normen. Diese Wahrheit gelte es allenfalls zu erkennen
und zu vollstrecken. Gegenüber einem solchen universalistischen
Wahrheitsbegriff muß jede abweichende Wertentscheidung,
die zum Glauben an eine andere Wahrheit führt, als Irrtum,
Ketzerei, Häresie oder Lüge erscheinen. "Jene selbstsicheren
Zeiten" sind nämlich längst vorbei, als Normativisten
"zuzugeben wagten, daß die
Axiome ihrer Lehre willensmäßig gesetzt waren - jene Zeiten, in denen offen gesagt wurde: Diese
Sätze sind verkündigt worden, und Ihr habt sie zu glauben,
erst von da ab dürft Ihr denken."
[6]
Das
von jedem in die Diskussion mitgebrachte metaphysische Vorverständnis
hängt weitgehend von seiner individuellen Persönlichkeit
ab: Wer Halt sucht, verteidigt seine Wahrheit normativ, weil
er ohne Glaubensgewißheit nicht leben mag. Sein dezisionistisches
Gegenüber ist der militante "Romantiker der Entscheidung",
der, "manchmal nicht ohne autobiographische Anspielungen,
das existentiell äußerste, gleichsam heroische Moment in
ihr"
[7]
hervorhebt. Während der Normendiener an eine harmonische
Seinsordnung glaubt, in der sich Ungläubige allenfalls als
Störenfriede hervortun und gegen die anzukämpfen sinnlos
und verwerflich wäre, glaubt der militante
Dezisionist: Das innerste Wesen des Kosmos folge antagonistischen
Prinzipien. Sich für oder gegen etwas zu entscheiden, wird
darum zur Pflicht und die kämpferische Haltung zur nur noch
metaphysisch begründbaren Lebenseinstellung. Sie beweist
sich in Worten wie Ernst Jüngers:
"Nicht wofür wir kämpfen ist das Wesentliche, sondern
wie wir kämpfen." Der heroische Mensch benötigt den Feind
geradezu existentiell, um mit ihm zu einer höheren Einheit
zu verschmelzen. Er "bejaht sich selbst und den Feind"
und "lebt im Ganzen und in den Teilen zugleich."
[8]
So bleibt dem militanten Dezisionisten
als Feind im metaphysischen Sinne allenfalls noch der Normendiener,
der "an sittlichen Prinzipien festhält, der um Gut
und Böse im materiellen Sinne ringt. Er ist der Abseitige,
Andersartige, mit dem es schlechthin keine Verständigung
gibt. Er ist der moralisierende Bürger, der sich birgt in seinem
Ideengehäuse."
[9]
-
-
Hinter
der Frage: "Ist dem Menschen aufgegeben, sich für eine Normenordnung zu entscheiden?",
steckt aber die Falle eines normativen
Sollens. In diese Falle tappt der Dezisionist, wenn
er militant wird: Ein Willensmensch wie Nietzsche
etwa begnügt sich nicht mit seiner persönlichen Entscheidung
nach Belieben. Für ihn gibt es sie doch: jene normative Ordnung,
der sich niemand entziehen kann. Sie steckt im Menschen:
Sein innerstes Wesen selbst sei sein Wille - also soll er wollen! Der Glaube, das Gesetz
des Kosmos sei der Widerstreit oder das Gesetz des Menschen
sei sein Wille, ist aber genauso Metaphysik wie der Glaube
an eine kosmische Harmonie. Wer keinen Kampfeswillen
aufbringt, handelt aus voluntaristischer Sicht nicht
menschlich: Wir sollen unserem Willen alles unterordnen,
sonst werden wir nie über uns hinauswachsen und wahre
Menschen - Übermenschen! - werden. Wird der Wille selbst
zur Norm erhoben, kippt der Dezisionismus logisch um
in einen extremen Normativismus. Indem der militante
Dezisionist den Willen zum Sollen und zum Muß erhebt - "Du sollst wollen!" - hat er sich bereits einer Willensmetaphysik
untergeordnet. Er hat seine freie Entscheidungsgewalt
bloß geliehen von einer normativen Menschennatur, die
ihn zum Wollen verdammt: "Je mehr Wille, desto mehr Existenz",
schrieb Kierkegaard
. Trotzdem fühlt er sich frei: Er merkt nicht, daß er sich
selbst einer normativen Ordnung unterworfen hat. Während
fernöstliche Lehren den Menschen vom Wollen erlösen möchten,
verdammt ihn der Voluntarist dazu: Jeder Mensch soll wollen,
weil es seine normative Natur sei. Die Willensmetaphysiker
Schopenhauer
und Nietzsche
oder der Existenzialist Kierkegaard
sind nur sekundäre Dezisionisten: Normativistisch ist
ihr Denkstil, dezisionistisch bloß der zufällige Denkinhalt.
Militante Dezisionisten merken nicht, daß sie selbst von einem
normativen Vorverständnis ausgehen: sie könnten sich dem Primat
des Wollen-Sollens gar nicht entziehen. Wir sollten sie darum
begrifflich ausklammern und besser als Willensmetaphysiker
bezeichnen.
Von
der anderen Seite her denkt der fideistische Dezisionist: Dezisionistisch ist sein Denkstil,
normativ der auswechselbare Inhalt. Sein Glauben - fides - richtet sich inbrünstig auf die
gottgeschaffene normative Ordnung. Gegenüber der Vernunft
gibt er dem Willen den Vorzug: Gottes Offenbarung kann nur
geglaubt, nicht rational bewiesen werden. Dieser Skeptizismus
erschüttert die Zuversicht des Denkens aber nur, um das
Vertrauen in den Glauben zu schützen:
[10]
Ein kleiner franziskanischer
Trick der Mönche Duns
und Ockham
hatte bis heute nicht zu überschätzende Auswirkungen: Gottes
Wesen sei sein allmächtiger Wille. Dieser sei die letzte
Ursache der normativen Schöpfungsordnung. Alles Gut und Böse sei ein beliebiges Produkt göttlicher Willkür! Damit wandte
Ockham sich ab von Platon
und Thomas
: Dieser hatte Gott für die unwandelbare Idee des Guten
selbst erklärt und damit seine Allmacht verkürzt: Gottes
Willen steckte damit im Käfig einer idealen Vernunftidee,
über die selbst Gott sich nicht hinwegsetzen konnte. Gottes
innerstes Wesen sei die berechenbare Vernunft. Nein, widersprach
ihm Duns
: Sein Wesen sei die Liebe: Sie beruht auf einem nicht rational
ableitbaren, also freien Willensakt. Schließlich befreite
Ockham Gottes Willen endgültig und setzte ihn über alles Gut
und Böse: Es gebe kein Gut und Böse aus der Natur der Sache
selbst und keine vorwillkürliche, vernünftigem Kalkül zugängliche
Bewertung in Gut und Böse. Gott selbst sei es, der Gut und Böse
willkürlich aus dem normativen Nichts erzeuge. Ockham selbst
war tief gläubig: Er brauchte kein berechenbar vernünftiges
Gutes, weil er sich der christlichen Offenbarung und Gottes
Liebe sicher war. Die ungeheueren Konsequenzen seiner Lehre
traten später zu Tage: Denkt man Gott aus seinem Weltbild weg,
tritt der Einzelmensch sein Erbe als alleiniger Normenschöpfer
an.
So
wagte doch tatsächlich im "tiefsten" Mittelalter
ein Partisan der Geistesfreiheit, das kleine franziskanische
Mönchlein Wilhelm von Ockham,
frech seine Stimme zu erheben und vorlaut zu behaupten: Wenn
Gott wirklich allmächtig ist, dann hat er sogar die Entscheidungsfreiheit,
das Gute böse und
das Böse gut sein
zu lassen. Gott hätte auch eine ganz andere moralische Ordnung
schaffen können.
[11]
Das Böse ist nur böse, und das
Gute ist nur gut, weil Gott es will und solange er es will. Gottes Wille ist geradezu das Wesen seines
Wirkens. Gegenüber Gott gibt es keine Berufung auf irgendwelche
Normen der Sittlichkeit oder des Gesetzes, weil sie alle seiner
grenzenlosen Allmacht und Willkür unterworfen sind. Damit
war ein geistiger Sprengsatz mit Langzeitwirkung gelegt:
Schließlich glaubte man, Gott habe die Menschen nach seinem
Ebenbilde geschaffen. Wenn Gott an keine Idee des Guten
gebunden ist und an kein ethisches Gesetz, ist er die Freiheit
schlechthin. Daraus ergibt sich unmittelbar die Aufforderung des Menschen
zur Freiheit. Wäre der Wille der Vernunft untergeordnet, wie
Thomas
lehrte, gäbe es keine Freiheit. Jede Vernunfteinsicht ist
nämlich kausal vorbestimmt und festgelegt; frei ist nur der
Wille.
[12]
Für Ockham
steht daher die Freiheit auch des menschlichen Willens "im
Mittelpunkt seiner Freiheitstheologie."
[13]
Das gedankliche Modell, nach
dem moralische Ordnungen nur gelten, weil es da jemanden gibt,
der ihre Geltung will, begründete bereits im Mittelalter den
neuzeitlichen Dezisionismus.
Fideistische
Dezisionisten sind auch die fundamentalistischen Katholiken.
Namentlich Carl Schmitt geht
von der gottgegebenen menschlichen Entscheidungsfreiheit
aus: Zwar gehört zum Wesen dieser Freiheit, sich auch gegen
die göttliche Ordnung entscheiden zu können. Indem der Mensch
Teil der göttlichen Ordnung und mit freiem Willen beschenkt
ist, kann er sich zwar gegen Gott entscheiden. Damit entscheidet
er sich aber zugleich gegen sich selbst: nämlich gegen das
in ihm angelegte Göttliche. So gesehen wird es geradezu
zur religiösen Pflicht, sich erstens überhaupt zu entscheiden,
und zweitens für die göttliche Ordnung. Das Weltbild des katholischen
Christen unterscheidet die göttliche Ordnung von der bösen
Unordnung. Ein Ausweichen vor der Entscheidung für Gott
oder Satan kann und darf es da nicht geben, denn wer sich nicht
für Gottes Ordnung entscheiden will, hat sich damit bereits
gegen sie entschieden. "Sage mir nicht," mahnte
Donoso
, "Du wollest nicht kämpfen, denn im gleichen Augenblick,
wo Du dies sagst, kämpfst Du bereits; noch, daß Du nicht wüßtest,
auf welche Seite Du Dich schlagen sollst, denn im gleichen
Augenblick, wo Du dies sagst, hast Du Dich bereits einer Seite
zugewandt; noch erkläre mir, daß Du neutral bleiben wollest,
denn wenn Du denkst, es zu sein, bist Du es bereits nicht mehr."
[14]
In
dieser Vorstellung wurzelt das bekannte Diktum Schmitts:
"Wer in der Frage: Neutralität oder Nicht-Neutralität neutral
bleiben will, hat sich eben für die Neutralität entschieden.
Wertbehauptung und Neutralität schließen einander aus. Gegenüber
einer ernst gemeinten Wertbehauptung und -bejahung bedeutet
die ernst gemeinte Wertneutralität eine Wertverneinung."
Daraus folgt zum Beispiel konkret: "Erklärt ein Teil
des Volkes, keinen Feind mehr zu kennen, so stellt er sich nach
Lage der Sache auf die Seite der Feinde und hilft ihnen, aber
die Unterscheidung von Freund und Feind ist damit nicht aufgehoben."
[15]
Diese Behauptung Schmitts setzt
den Glauben an zwei antagonistische Prinzipien bereits
voraus, sonst wäre eine Entscheidung eben nicht unausweichlich.
Die dem Dezisionismus entgegenstehende Vorstellung des ewigen
Gesprächs: durch Diskussion könnte so etwas wie die Wahrheit
gefunden werden, hätten katholische Staatsphilosophen
wie de Maistre, Bonald und Donoso Cortés, mit Schmitts Worten,
"wohl eher für ein Phantasieprodukt von grausiger Komik
gehalten."
"Am entscheidenden Punkt die Entscheidung suspendieren,"
interpretiert Schmitt authentisch seine geistigen Ahnen de
Maistre
und Donoso,
"indem man leugnet, daß hier überhaupt etwas zu entscheiden
sei, mußte ihnen als eine seltsame pantheistische Verwirrung
erscheinen."
[16]
Der
konsequenteste ist der
deskriptive Dezisionismus seines Begriffsschöpfers Kondylis.
Die Zumutung, sich für eine Norm zu entscheiden, weist er
zurück und möchte überhaupt keine eigene Stellung beziehen.
Während ein Nihilist wie La Mettrie
noch im Glücklichsein und ein Dezisionist wie Jünger
im entschlossenen Entscheiden höchste Werte sahen, weist
ihnen Kondylis einen darin versteckten Normativismus nach.
Konsequent erklärt er sämtliche Wertentscheidungen für
relativ, allerdings um einen hohen Preis: Wer sogar sein
eigenes Leben und die tiefsten Beweggründe seines Handelns
zur beliebigen Disposition stellt, verzichtet damit auf
aktive Teilnahme am Leben und auf die kalkulierte Anwendung
von Ideen als Waffen in der polemischen Auseinandersetzung.
Das kann er nicht ohne logische
Aporien durchhalten: Wenn sowieso alles relativ ist, ist die
Relativität zwar nicht als falsch widerlegt,
[17]
aber doch selbst relativ. Dürfen
wir dann nicht wenigstens einmal am Geist der Relativität
sündigen, indem wir etwas absolut setzen?
Tatsächlich
erlaubt uns das der deskriptive Dezisionismus: Er enthält sich
jeder Sollensmaxime
und geht nicht in die logische Falle, die Relativität selbst
zum Sollen zu erklären. Logisch folgerichtig übt er metaphysische
Askese: Alle Werte erklärt er für relativ, durch die Perspektive
des Betrachters bedingt und für Produkte gesellschaftlicher
Konventionen. Jede konsequente antimetaphysische Position
muß "antiintellektualistisch und antiidealistisch"
eingestellt sein. Kein Intellekt ist so erhaben, das Sein
in seiner Einheit objektiv zu erfassen und zu deuten. Selbst
wer vorurteilsfrei rein
positive Wissenschaft betreiben will, schleppt doch zwangsläufig
seine methodischen Vorverständnisse und metaphysischen
Prämissen mit. Indessen hat diese ernüchternde Einsicht
eine tröstende Hintertür: Indem sie hinter allem und jedem
menschlichen Denken metaphysische Entscheidungen erkennt,
warnt sie zwar vor letzten Gewißheiten, erteilt aber der bewußten
Entscheidung für einen Wert Generalpardon. Die offene Hintertür
entläßt uns in die Entscheidungsfreiheit, wenn diese auch
nur eine "von Skeptikern geschenkte, also unsichere
Narrenfreiheit"
[18]
ist.
Nur
der ist aber berechtigt, die theoretisch überlegene Haltung
des wertneutralen Beobachters einzunehmen, der nicht mehr
glaubt, "es gebe doch etwas zu verteidigen, etwas, das
mit dem (wenigstens faktisch angenommenen) Sinn des Lebens
zusammenhänge."
[19]
So blieb Kondylis in seiner theoretisch völlig wertfreien
und relativistischen Attitüde kein anderer Lebensinhalt
als das spekulative Genießen und unbeteiligte Beschreiben
fremder Lebensentwürfe. In dieser beschaulichen Tätigkeit
manifestiert sich der Geltungsanspruch des Theoretikers,
der für sich in Anspruch nimmt, in die Händel dieser Welt nicht
unmittelbar einbezogen zu werden. Es ist die freie Wertsetzung
des intellektuellen Genießers, dessen Lebenswelten die Heidelberger
Universitätsbibliothek und der griechische Strand sind.
Zwischen denen reiste Kondylis hin- und her, um die Früchte
abendländischer Geistesgeschichte einzuschmelzen und
regelmäßig in Form eigener Geisteswerke ungeheueren
Gewichts wieder auszustoßen.
fortsetzendes
Unterkapitel: Toleranz durch
freie Wertsetzung