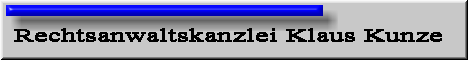|
Publikation genealogischer Daten und Datenschutz
|
| |
| |
Zuweilen
wirft das ruhige Hobby des Ahnenforschers beunruhigende
Rechtsfragen auf. Je umfassender die Früchte der Arbeit des Genealogen sind, desto eher möchte er sie publizieren.
Seit dem 25.5.2018 sorgt die europäische
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für Ängste, Unklarheit und
Verwirrung. Zu ihr lesen Sie bitte vor dem Weiterlesen hier zunächst
die Sonderseite DSGVO |
|
| |
|
| |
|
| Verstößt das Publizieren genealogischer Daten gegen Rechtsvorschriften? |
Aus Art. 2 und 5 GG folgt das Recht, Forschungsergebnisse zu publizieren. Es ist nicht einschränkungslos gewährleistet und endet, wo gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
Die Benutzungsrechte an staatlichen und kirchlichen Archivalien ist eine andere als die Rechtsfrage, ob und welche Angaben veröffentlicht werden dürfen. |
| Welche Benutzungsrechte an staatlichen und Kirchlichen Archivalien gibt es? |
Das Personenstandsgesetz vom 19.2.2007 hat die Rechtslage grundsätzlich geändert.
Nach § 5 PStG in Verbindung mit § 61 PStG sind frei benutzbar alle Standesurkunden außerhalb dieser Fristen:
1. Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister 80 Jahre; 2. Geburtenregister 110 Jahre; 3. Sterberegister 30 Jahre.
Die Benutzung richtet sich im einzelnen nach den jeweiligen Landesarchivgesetzen.
Entsprechende Regelungen mit anderen Fristen enthalten die jeweiligen Kirchengesetze der einzelnen Landeskirchen für die Benutzung der Kirchenbücher. |
Kann mir jemand das Publizieren "seiner Daten" verbieten?
§ 27 IV BDSG
Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerläßlich ist. |
|
|
Wer auch nur eine Familiengeschichte publiziert, wird Lebensdaten über viele noch lebende Menschen veröffentlichen. Nicht jeder entfernte Verwandte oder Angeheiratete wird das vielleicht wollen oder gefragt werden können, weil er unbekannt verzogen ist.
Noch schärfer stellt sich die Frage bei der Publikation von Ortssippenbüchern bzw. Ortsfamilienbüchern. Die Erfahrung lehrt, daß die allermeisten Bewohner eines Ortes größten Wert darauf legen, in einem Buch vertreten zu sein. Könnte aber jemand von Rechts wegen Einwendungen erheben und (sich be-)klagen?
Fraglich war bis zu neuen Urteilen des BGH, ob er sich auf § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 1990) (jetzt § 27 IV BDSG 2017) berufen könnte. Das ist bei Buchpublikationen aber nicht der Fall. |
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
§ 57 Rundfunkstaatsvertrag
(1) Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse als
Anbieter von Telemedien personenbezogene Daten ausschließlich
zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen
Zwecken erheben, verarbeiten oder nutzen, gelten nur die §§ 5,
7, 9 und 38a des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe,
daß nur für Schäden gehaftet wird, die durch die Verletzung des
Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes
oder durch unzureichende technische oder organisatorische
Maßnahmen im Sinne des § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes
eintreten. |
|
|
Am 9.2.2010 hat der BGH zu VI ZR 243/08 über die vergebliche Klage des Sedlmayr-Mörders entschieden, ein Dossier über ihn und seine Täterschaft nicht mehr zu publizieren: § 4 BDSG gilt nicht bei literarischen Werken, weil seine Geltung in § 56 RStV ausgeschlossen wurde:
"Gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 RStV gelten [,,,] die §§ 5, 7, 9 und 38 a BDSG mit der Maßgabe, daß nur für Schäden gehaftet wird, die durch die Verletzung des Datengeheimnisses nach § 5 BDSG oder durch unzureichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des § 9 BDSG eintreten. § 4 BDSG, wonach die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig sind, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat, kommt dagegen nicht zur Anwendung."
Es sind "sind die Recherche, Redaktion, Veröffentlichung, Dokumentation und Archivierung personenbezogener Daten zu publizistischen Zwecken umfassend geschützt. Das durch die Presse- und Rundfunkfreiheit verfassungsrechtlich vorgegebene Medienprivileg schützt insbesondere auch die publizistische Verwertung personenbezogener Daten im Rahmen einer in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 Satz 2 EMRK fallenden Veröffentlichung".
|
| |
|
§ 28 BDSG 1990:
Datenerhebung und -speicherung für eigene Geschäftszwecke
(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig
- [..] 2.
-
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, daß das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder
- 3.
-
wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.
|
|
|
Die Erstellung und Übermittlung eines genealogischen Werkes unterfiel überdies § 28 BDSG BDSG 1990.
Auch ohne Einwilligung des Betroffenen war eine Publikation zulässig:
Der BGH hat in seinem weiteren Urteil vom 23.6.2009 -VI ZR 196/08- (Zulässigkeit der Bewertung von Lehrern durch Schüler auf einer Internetseite) grundsätzliche Ausführungen gemacht, die auch hier gelten:
(1) Die Speicherung der Bewertungen ist nach § 29 Abs.1 Nr.1 BDSG zulässig, wenn ein Grund zu der Annahme eines schutzwürdigen Interesses an dem Ausschluß der Datenerhebung und -speicherung nicht gegeben ist. Der wertausfüllungsbedürftige Begriff des "schutzwürdigen Interesses" verlangt eine Abwägung des Interesses des Betroffenen an dem Schutz seiner Daten und des Stellenwerts, den die Offenlegung und Verwendung der Daten für ihn hat, mit den Interessen der Nutzer, für deren Zwecke die Speicherung erfolgt, unter Berücksichtigung der objektiven Wertordnung der Grundrechte. Dabei sind Art, Inhalt und Aussagekraft der beanstandeten Daten an den Aufgaben und Zwecken zu messen, denen die Datenerhebung und -speicherung dient. Legt die Daten erhebende Stelle dar und beweist sie erforderlichenfalls, daß sie die Daten zur Erreichung des angestrebten rechtlich zulässigen Zwecks braucht, darf sie die Daten erheben, solange entgegenstehende schutzwürdige Interessen des Betroffen nicht erkennbar sind. Das Vorliegen von schutzwürdigen Interessen des Betroffenen läßt sich nur in Bezug auf den zukünftigen Verwendungskontext der Daten bestimmen. Schutzwürdige Interessen des Betroffenen können in der Wahrung seines Persönlichkeitsrechts, aber auch in der Abwehr von wirtschaftlichen Nachteilen liegen, die bei der Veröffentlichung der Daten zu besorgen sind. Wendet sich der Betroffene gegen die Datenerhebung, hat er darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, daß er des Schutzes bedarf. Bietet die am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausgerichtete Abwägung keinen Grund zu der Annahme, daß die Speicherung der in Frage stehenden Daten zu dem damit verfolgten Zweck schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt, ist die Speicherung zulässig[...]
Danach genießen besonders hohen Schutz die sogenannten sensitiven Daten, die der Intim- und Geheimsphäre zuzuordnen sind. Geschützt ist aber auch das Recht auf Selbstbestimmung bei der Offenbarung von persönlichen Lebenssachverhalten, die lediglich zur Sozial- und Privatsphäre gehören Allerdings hat der Einzelne keine absolute, uneingeschränkte Herrschaft über "seine" Daten; denn er entfaltet seine Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft. In dieser stellt die Information, auch soweit sie personenbezogen ist, einen Teil der sozialen Realität dar, der nicht ausschließlich dem Betroffenen allein zugeordnet werden kann. Vielmehr ist über die Spannungslage zwischen Individuum und Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und -gebundenheit der Person zu entscheiden. Deshalb muß der Einzelne grundsätzlich Einschränkungen seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung hinnehmen, wenn und soweit solche Beschränkungen von hinreichenden Gründen des Gemeinwohls oder überwiegenden Rechtsinteressen Dritter getragen werden und bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze des Zumutbaren noch gewahrt ist.
|
| Kein einschränkungsloses Recht an "meinen Daten" |
Soweit eine Publikation sich auf "nicht sensitive Daten" beschränkt, zu denen jedenfalls die Tatsachen des Namens, Geburtsorts und -datums, der Heirat und des Todes zählen dürften, sind "schutzwürdige Belange" eines Betroffenen auf Geheimhaltung nicht erkennbar.
Das gilt umso mehr gerade dann, wenn der Betroffene selbst diese Daten hat in die Öffentlichkeit gelangen lassen, etwa durch eine Geburts-, Heirats- oder Todesanzeige in einer Zeitung oder einem Gemeindeblatt. Wer seine Privatsphäre in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zugänglich macht, kann sich nicht gleichzeitig auf den von der Öffentlichkeit abgewandten Privatsphärenschutz berufen (BGH U.v. 9.12.2003, NJW 2004,762 -VI ZR 373/02-, LG Berlin U.v. 26.7.2005 -27 O 301/05-). |
| Schutz der Forschungs- und Publikationsfreiheit |
Auf der anderen Seite hat der Publizierende ein durch Art. 5 GG geschütztes Interesse an der wissenschaftlichen Publikation seiner Forschungsergebnisse. Dementsprechend schützen die Landespressegesetze wissenschaftliche Publikationen, zu denen auch Ortssippenbücher zählen. Zum Beispiel dürfen nach § 11 Abs. II Niedersächsisches Datenschutzgesetz vom 16.5.2018 personenbezogene Daten für wissenschaftliche Forschungsvorhaben veröffentlicht werden, wenn dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte
unerläßlich ist. Dies ist bei einem Ortssippenbuch beispielhaft der Fall.

|
| Kein Unterlassungsanspruch |
Darum ist es von Rechts wegen grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn ein Einwohnerverzeichnis, wie es zum Beispiel ein genealogisches Ortssippenbuch ist, frei zugängliche Lebensdaten (Geburt, Heirat, Tod) veröffentlicht. Eine betroffene Person hätte dagegen keinen Unterlassungsanspruch, weil „die Äußerung wahrer Tatsachen, zumal solcher aus dem Bereich der Sozialsphäre, regelmäßig hingenommen werden muß (vgl. BVerfGE 97, 391 <403>; 99, 185 <196 f.>)“ so BVerfG B.v. 18.2.2010 1 BvR 2477/08.
Richterlich geklärt ist diese Frage bezüglich genealogischer Daten nicht. Offenbar hat noch niemand geklagt. Die hier vertretene Ansicht dürfte auch auf Genwiki publizierter Meinung entsprechen, die allerdings das neue PStG und die neuen Entscheidungen des BGH noch nicht berücksichtigt. |
|
|