“Die solidarische Nation – wie Soziales und Nationales ineinandergreifen” von Klaus Kunze
Erstpublikation auf „Pluriversum“ 22. Oktober 2024
Ja liebe Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge von “PlURIVERSUM – Denken ohne Grenzen”, heute habe ich, Michael Dangel (MD), die Ehre ein Gespräch mit Herrn Rechtsanwalt Klaus Kunze (KK) zu führen, mit dem ich insbesondere über sein Buch: “Die solidarische Nation – wie Soziales und Nationales ineinandergreifen”, sprechen möchte.
MD: Herr Kunze, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser heutiges Gespräch nehmen. Ich möchte unsere heutige Befragung mit einer relativ trivialen Frage beginnen: Gab es einen besonderen Anlass, warum sie das Buch die solidarische Nation geschrieben haben?
KK: Der Publizist Günter Maschke sagte mir einmal, letztlich schreibe man jedes Buch für sich selbst. Ich habe Bücher immer dann geschrieben, wenn ich einer Frage unbedingt auf den Grund gehen wollte und es noch kein Buch gab, mir meine Fragen zu beantworten. Während ich jedes Buch schreibe, lese zu meiner Fragestellung ein Vielfaches dessen, was ich dann schreibe.
Das war bei der Frage nach dem Wesen von Nationalem und Sozialen und ihrer Beziehung zueinander auch unbedingt erforderlich. Das Thema läßt sich nicht klären ohne Berücksichtigung von Philosophie, Geschichte, Soziologie, Politologie, Verfassungsrecht und natürlich unserer Demografie, Biologie und Genetik. Wir werden aussterben, wenn wir aus dem notwendigen Zusammenspiel von Solidarität nach innen und Abgrenzung nach außen nicht die gebotenen Konsequenzen ziehen.
Weil es keine nachhaltige Fortexistenz gibt außer der genetischen, läßt sich dieses Buch auch als Hilfsmittel im Kampf um unsere Existenz deuten. Das ist allemal ein zwingendes Motiv.
MD: Zunächst einmal hat es mich überrascht, dass sie zwischen Vaterlandsliebe und Nationalismus unterscheiden. Es ist hinreichend bekannt, dass ich mit dem Begriff Nationalismus aufgrund seiner negativen Konnotation nichts anfangen kann, sondern hier lieber von “nationaler Idee” spreche. Sie stellen aber in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen den Begriff Vaterland bzw. Nationalgefühl. Ist das denn nicht – ketzerisch gefragt – etwas gefühlsduselig oder pathetisch?
KK: Vaterlandsliebe ist, wie jede Liebe, ein starkes Gefühl. Nationalismus ist eine politische Maxime, die besagt, daß die Menschheit sich in Nationen gliedert ist gut so und soll so bleiben. Natürlich definieren Menschen mit gewissen Ideologien beides ganz anders. Meistens kritisieren sie beides aber, weil sie selbst etwas ganz anderes darunter verstehen. Vor 300 Jahren hieß man das Vaterland einer Person ihren Herkunftsort oder das Territorium wie vielleicht Hessen-Kassel. Heute kann der Begriff nicht anknüpfen an ein Territorium, seine Städte und grünen Hügel, sondern an die Menschen, die es im Laufe der Generationen gestaltet haben, ihre Wesensart, Kultur und Identität.
Ich identifiziere mich mit meinen Eltern, Voreltern und meinen Nachkommen. Das ist die Keimzelle auch der Liebe zu meinem ganzen Volk. Man kann das alle rational erklären als evolutives Erfordernis, zu überleben und nicht auszusterben. Alle Rationalisierungen können aber Liebe nicht erzeugen.
MD: Ich pflichte ihnen natürlich bei, dass das Nationalgefühl – manche bezeichnen dies auch als Patriotismus – etwas sehr Wichtiges für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft darstellt. Wie aber kommen wir bei unserer nationsvergessenen Pseudo-Gesellschaft überhaupt wieder zu dem, was sie als Vaterlandsliebe bezeichnen? Woran soll man ansetzen?
KK: Die emotionale Bindung an seine Gruppe war seit unseren Primatenzeiten eine Übelebensvoraussetzung, weil ein Einzelner ohne den Schutz seiner Gruppe nicht existenzfähig war. In der Epoche der Massengesellschaften benötigen wir eine hinreichend große Personenzahl, um unsere gemeinsamen Interessen durchzusetzen. Vor allem aber benötigen wir den Willen zur Gemeinschaft. Eine Gesellschaft verhält sich wie Partygäste: Sie schmausen die Häppchen und ziehen weiter. Sie verpflichtet zu nichts. Eine Gemeinschaft aber lebt davon, daß sie den Einzelnen schützt, aber auch Opferbereitschaft für andere abverlangt, sonst funktioniert sie nicht. Eine Massengesellschaft kann sich nur in Form eines Staates organisieren, der ihren Zusammenhalt organisiert.
Wenn man ein Volk zerstören will, muß man die Liebe der Einzelnen zu ihrer Gemeinschaft ausmerzen und sie durch Selbsthaß ersetzen. Das geschieht in Deutschland seit etwa 70 Jahren systematisch. Den Menschen soll das Gefühl genommen werden, daß es da etwas wertvolles zu verteidigen gibt. Gleichzeitig wird das eigene Volk als Bezugspunkt unserer Eigenliebe ersetzt durch Menschen, mit denen sich die meisten Deutschen nicht identifizieren und die sie auch nicht lieben, für die sie keine Opfer zu bringen bereit sind und vor denen sie sich inzwischen – häufig zu Recht – auch fürchten.
MD: Ich komme nun zum Begriff Solidarität. Wir machen im Rahmen unserer Befragungen natürlich auch politische Grundlagenarbeit. Können Sie insbesondere unseren jungen Lesern erläutern, woher evolutionsbiologsich bzw. verhaltensbiologisch die Solidarität oder das Soziale überhaupt herrührt? Zum Hintergrund: Ich selbst bin ein Scheidungskind und stelle fest, dass es traditionelle Familien immer weniger gibt und stattdessen diese mehr als fragwürdigen Patchwork-Konstruktionen zur neuen Normalität werden? Wie kommt es dann zu gelebter familiärer Solidarität, wenn diese immer weniger vorgelebt wird?
KK: Jede Weltanschauung, die solidarische wie die libertäre, beruht auf der Umwelt, die der Mensch sich anschaut. Sie verarbeitet die Funktionsweise unserer jeweiligen sozialen Umwelt und spiegelt sie. Wer im Wasser ist, muß eben schwimmen, und an Land muß er laufen. Kommen sie weit in der kanadischen Einöde an ein Haus, werden seine Bewohner vermutlich gastfreundlich sein, in einem Duisburger Hochhaus mit 200 Wohnungen aber nicht. Je mehr Menschen man zusammenpfercht, desto schneller fallen die höheren sozialen Antriebe aus.
Der Sozialtrieb ist uns zwar angeboren. Wenn er aber bei jemandem von Kindesbeinen an keine Anwendungsmöglichkeit hat, kann er sich nicht entfalten. Wer den Kitt unserer Sozialstruktur auflösen will, um diese zu zerschlagen, wird immer mehr Menschen die Möglichkeit nehmen, Liebe und Solidarität zu empfangen und selbst aufbringen zu können. Er wird die vorhandene sozialen Institutionen wie die Familien und Sippen verunglimpfen, relativieren und schwächen und ihnen ihre sozialen Funktionen nehmen, indem er diese einer anonymen staatlichen Umverteilungsmaschine überträgt. Dadurch läßt er eine Generation nach der anderen als soziale Nichtschwimmer zurück.
MD: Wenn wir dann von der Familie oder Sippe weggehen eine vielleicht auf den ersten Moment überraschende Frage: Halten Sie in der Postmoderne auch eine Solidaritätsgemeinschaft allein auf spiritueller Ebene für möglich?
KK: Wenn man unter Solidarität diejenige Aufopferungsbereitschaft versteht, die auf blutsmäßiger Familienbindung notfalls unter Einsatz seines Lebens beruht, nein. Genau das ist aber die Solidarität, die ein nationaler Staatsverband zum Beispiel früher durch die Wehrpflicht jedem abverlangen durfte. Blut ist dicker als Tinte. Auch ein Fußballfan oder das Mitglied einer Partei ist irgendwie bis zu einem Punkt “solidarisch”, aber eben nur bis zu diesem Punkt. Was eine Solidaritätsgemeinschaft auf spiritueller Ebene angeht, halte ich den Glauben an spiritistischen Ersatz für reale Verwandtschaft für eine Pathologie, vergleichbar wenn eine kinderlose Frau siebzehn Katzen hält, um ihre Fürsorgebereitschaft an ihnen abzureagieren.
Der ideale Zustand ist natürlich, wenn diese Solidargemeinschaft bzw. die soziale Idee sich auf den gesamten Nationalstaat erstreckt. Wann glauben Sie war dies in der Vergangenheit tatsächlich Realität?
Es spielt grundsätzlich keine Rolle, ob die Gruppenloyalität sich auf eine vorgeschichtliche Horde bezieht, eine kleine Grafschaft oder eine große Nation. Das ist nur eine Frage der historischen Situation. Darum würde ich das Wort ideal hier vermeiden. Jede Epoche hat ihre adäquate Bezugseinheit. Seit der französischen Revolution gab es die Levée en masse und damit die Idee, die gesamte Volksmasse am Krieg zu beteiligen. Das hat sich als so zukunftsweisend erwiesen, daß seitdem alle erfolgreichen Staaten sie benutzt haben. Die reinen Kabinettsarmeen unser damaligen Duodezfürsten gingen sang und klanglos unter. Die begeisterte Beteiligung der ganzen Nation an ihren Schicksalsfragen funktioniert bis heute, weil sie unserer Epoche der Massengesellschaft angemessen ist.
MD: Sie arbeiten in anschaulicher Weise heraus, dass das Soziale und Nationale keine Gegensätze sind, sondern einander bedingen und wie sie schreiben “komplementäre Prinzipien” sind. Womit ich als Libertärer natürlich ein Problem habe, ist dann die naheliegende Idee einer sozialen Gleichheit innerhalb der Nation. Gibt es denn in der bunten Republik nicht ein Zuviel an Umverteilung und teilweise sinnentleertem Gesülze über soziale Gerechtigkeit?
KK: Das gibt es aus zwei Gründen. Die linke Ideologie beruht auf Neid und dem Bestreben, alle gleich zumachen. Dann kann man sie selbstberufener Interpret des wahren Sozialismus auch besser lenken. Aber auch der Linksliberalismus der Massendemokratie benötigt die heutige Hypertrophie des Sozialstaats zu seinem Funktionieren. Ohne ihn würde der erbarmungslose internationale Finanzkapitalismus gar nicht funktionieren. Wenn irgendwo mal wieder tausende Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, muß dann die Allgemeinheit die hungrigen Mäuler stopfen. Mit der Solidarität, die ich gegenüber jedem meiner Landsleute gegenüber empfinde, hat das nichts zu tun. Nationale Solidarität ist keine Gleichheitsideologie.
Sie besagt, daß ich mit meiner Arbeitskraft dazu beitrage, Schulen, Universitäten und zum Beispiel Museen und Staatsarchive über die Zeiten hinweg auf Dauer zu stellen, die innere und äußere Sicherheit vor Barbarenhorden zu gewährleisten und mich auch dann der Mehrheit zu beugen, wenn ich anderer Meinung bin als sie. Ein Eldorado für Sozialparasiten, mit denen ich mich gar nicht solidarisch fühlen kann, ist im Gedanken der Solidarität nicht vorgesehen. Sie ist nämlich keine Schranken- und grenzenlose Solidarität, sondern kann nur funktionieren in einer klar definierten Einheit wie einem Staat, der sie auf Wechselseitigkeit stellt und organisiert. Die Nation bildet das Gefäß, innerhalb deren Solidarität funktioniert. Darum bedingen sich der Nationale und der solidarische Gedanke wechselseitig.
MD: Und noch deutlicher: Ist es denn nicht ein konservatives Prinzip, der Überzeugung zu sein, dass alle Menschen von Natur aus ungleich sind, dass auch in einer Nation ein hierarchisches Prinzip innerhalb der Gemeinschaft der Staatsbürger gelten muss?
KK: Ich kenne kein solches konservatives Prinzip, denn Prinzipien sind ihrer Natur nach Sollensforderungen. Es entspricht aber realitätsbezogenem, also rechtem Denkstil, die Menschen als faktisch ungleich wahrzunehmen. Auch Hierarchie stellt sich faktisch in jeder freien Gesellschaft ganz von allein ein. Dazu benötige ich kein normatives, also kein Sollensprinzip.
MD: Ich bin jetzt mit Sicherheit aus ihrer Sicht ein “rechter Sozialmuffel” wie sie in ihrem Buch schreiben und damit eigentlich gar kein Rechter mehr, sondern ein “verkappter Liberaler”. Aber ich kann mit Ludwig Erhard nichts Falsches daran finden, wenn er die These aufgestellt hat, sozial sei, was Arbeit schafft. Ist es nicht so, dass beispielsweise in den Nachkriegsjahren ein ganz anderer Arbeitsethos vorgeherrscht hat und daher im Heute knallharte Sozialkürzungen notwendig sind, um die Menschen zur Arbeit und zum Preis zu zwingen?
KK: Not schafft ein anderes Arbeitsethos als das Schlaraffenland. Das heutige Bürgergeld hebt heute jeden Empfänger auf einen sozialen Stand weit über demjenigen, den ich als Kind in meiner Familie gewöhnt war. Das ist nicht Solidarität, sondern ein Sozialismus, der die Kaste derjenigen an der Macht hält, die diese Milliardensummer zwangsweise eintreiben und nach ihrem Gusto wieder verteilen.
Liberale und Rechte gehen vom Individuum und nicht von einem Kollektiv aus und betonen seine persönliche Freiheit. Rechte lieben aber nicht nur sich selbst als Individuum, sondern ebenso die Gemeinschaft, in die sie hineingeboren wurden, ihre Kultur, Geschichte und Wesensart. Sie benötigen diese Gemeinschaft, weil sie sich mit ihrer Identität unlöslich verbindet.
MD: Was sie sehr interessant ausführen, ist, dass die soziale Frage der Rechten eine andere ist wie die der Linken. Können Sie diesen Gedanken näher ausführen?
KK: Für Linke lautet die soziale Frage immer nur, wie man faktische Ungleichheit abbauen kann. Sie versprechen sich davon die Aufhebung jeglicher Herrschaft von Menschen über Menschen, weil diese nur durch Ungleichheiten möglich sei. Für Rechte muß die soziale Frage aber lauten: Worin besteht der nötige Kitt, der eine Gemeinschaft freier, also ungleicher Menschen zusammenhält? Die Antwort lautet: in der kameradschaftlichen Solidarität, die niemanden hilflos am Wegrand zurückläßt. Diese Solidarität entfaltet ihre Funktionslogik innerhalb unseres nationalen Gehäuses, ist aber wachsam und abwehrbereit nach außen. Unsere Menschen vor ausländischen Drogenbanden, Messerstechern oder fanatischen Gotteskriegern zu schützen, gehört auch zur beschützenden Solidarität.
MD: Bei ihnen schwingt immer ein gehöriges Maß an Kritik am häufig so bezeichneten Kapitalismus mit. Ist es denn nicht ein genereller Fehler Kapitalismus – und sie präzisieren es Finanzkapitalismus – mit Marktwirtschaft gleichzusetzen?
KK: Gegen Marktwirtschaft ist nichts einzuwenden, weil ihr Gegenteil gescheitert ist, nämlich die Versuche staatlicher Zentralverwaltungswirtschaft. Der internationale Finanzkapitalismus kann aber die innerhalb eines Landes geltenden Gesetze des Marktes außer Kraft setzen, wenn er seine Konkurrenten einfach aufkaufen und dann schließen kann. Wenn er zu einem Monopol- oder Oligopolkapitalismus entartet, vereinigt sich in Händen seiner Eigentümer mehr Macht als viele scheinbar souveräne Staaten sie haben. Diese Macht ist nicht demokratisch kontrollierbar und wird auch häufig eingesetzt, um Staaten und Regierungen zu destabilisieren oder zu stützen.
MD: Und noch etwas präziser: Würden Sie nachfolgender These zustimmen? Winston Churchill sagte: “Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen – mit Ausnahme aller anderen.” Daran anknüpfend meine These: “Die Marktwirtschaft ist die schlechteste aller Wirtschaftsformen – mit Ausnahme einer anderen.”
KK: Solange die Macht einzelner Marktteilnehmer nicht über das demokratisch kontrollierbare Maß hinauswächst, ja.
MD: Mit der sozialen Idee verbinden viele unweigerlich und ausschließlich den Staat. Ist es denn nicht ein Ausdruck der Staatsvergottung von uns Deutschen als verspätete Nation, dass diese soziale Idee allein beim Staat verortet wird?
KK: Ich gebe Ihnen die rhetorische Frage nach einer besseren Wirtschaftsform als der Marktwirtschaft zurück: Kennen Sie eine andere Institution als einen Staat, der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einer Massengesellschaft organisieren, den Schutz der Bürger nach innen und außen gewährleisten und die Bürger an seiner Willensbildung vom Volk hin zu den Staatsorganen teilnehmen lassen kann? Die Hypertrophie der Sozialstaatlichkeit ist ein Extrem, das man durch Reformen beseitigen muß, aber nicht indem man das Kind mit dem Bade ausschüttet.
MD: Zum Schluss natürlich die Königsfrage: In einer auch nur halbwegs ethnisch und kulturell homogenen Nation halte ich den Solidaritätsgedanken für umsetzbar. Fakt ist aber, dass die demographische Selbstauslöschung von uns Deutschen schon seit Jahrzehnten, spätestens nach dem Pillenknick, in vollem Gange ist und in dramatischer Weise mit arithmetischer Präzision und Unerbittlichkeit voranschreitet. Ist also der Solidaritätsgedanke in dieser völlig fragmentierten, zunehmend ethnisch entkernten, angeblich multikulturellen Gesellschaft überhaupt noch umsetzbar?
KK: Solidarität und Hilfsbereitschaft ist ein starker, angeborener Antrieb. Als in meiner Gegend Anfang August mehrere Dörfer durch Hochwasser völlig überflutet worden waren, machten sich Bewohner der ganzen Umgegend mit Traktoren und Gerät spontan freiwillig und unaufgefordert zur Schlamm- und Schadenbeseitigung auf, darunter auch ein junger Neffe meiner Frau. Menschen sind immer solidarisch. Nur erfordert Solidarität jemanden, mit dem man sich solidarisch fühlen kann. Mit Feinden oder bedrohlichen Fremden fühlt sich niemand solidarisch, weil man sie und sich selbst nicht als ein Wir empfinden kann.
MD: Sehr geehrter Herr Kunze, ich möchte mich bei Ihnen noch einmal ganz herzlich für ihre Zeit und dieses Gespräch bedanken.

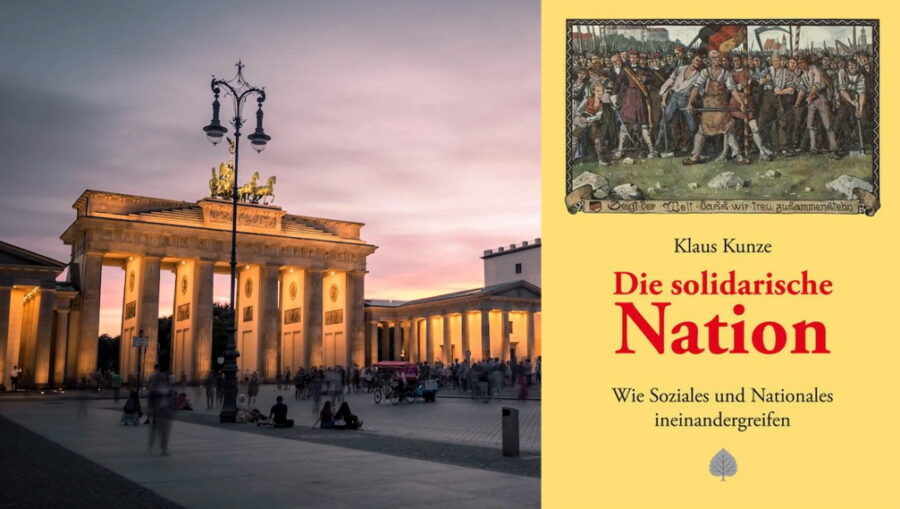
Schreibe einen Kommentar